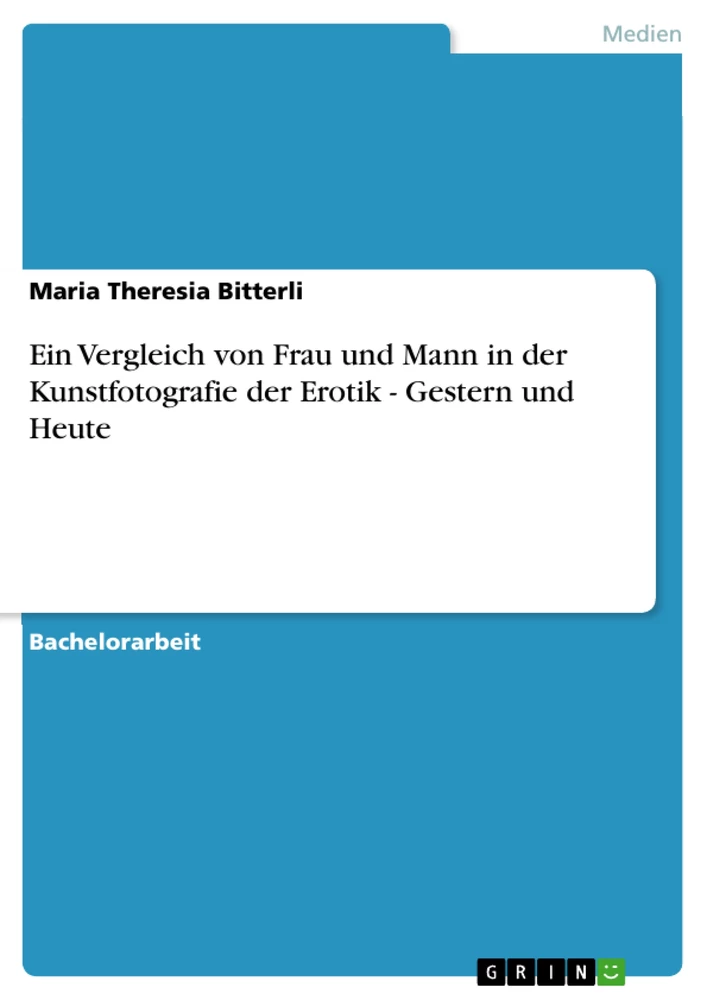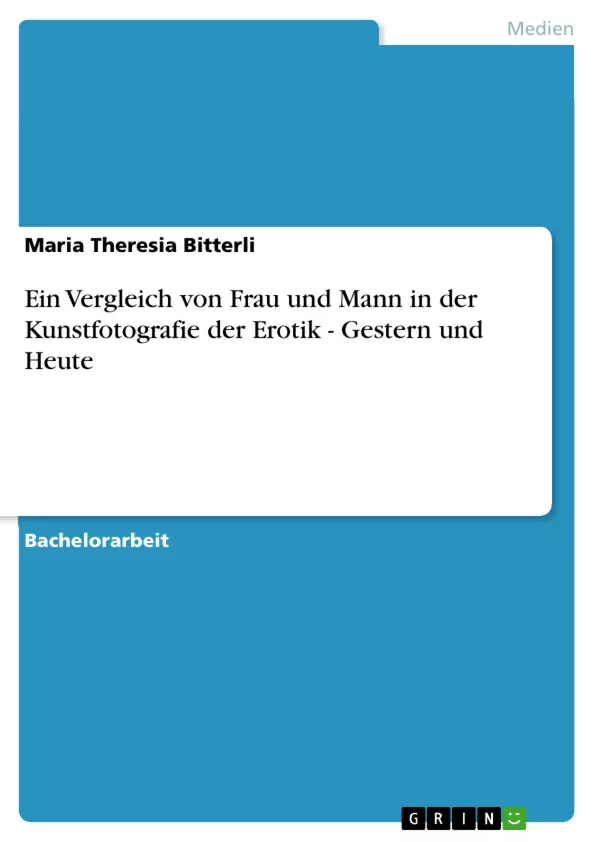Das vorliegende Buch befasst sich mit der geschlechtlich-spezifischen Perspektive in der Aktfotografie. Es geht um den sozialen Stand, den die Frau sowohl als Akt-Fotografin als auch als Akt-Modell im Verlaufe der Zeit in der Gesellschaft erreicht hat. Das Interesse von Maria Theresia Bitterli richtet sich auf die „kleine soziale Lebenswelt“ dieser Frauen, auf ihre Teilnahmen in der Geschichte des Aktes, sowie ihre Ansichten, Verhaltensweisen und Strategien, die sie im Zusammenhang mit dem Akt entwickelt oder in ihrem lebensgeschichtlichen Verlauf bereits angewandt haben. Der Beschluss, diese Frauen in ihrer Lebenswelt zu erfassen, wurde bekräftigt, als Maria Theresia Bitterli feststellte, dass es an spezifischer Literatur über Aktfotografinnen und Aktmodellen weitgehend fehlt. Es ist schon einiges zum Thema der Frau in der Fotografie geschrieben worden, aber was die Aktfotografie betrifft, gibt es noch vieles zu entdecken und zu ergänzen. Um die Alltagswirklichkeit, die Welt des Handelns und den damit verknüpften Sinn der verschiedenen Frauen aus ihrer Perspektive und in ihrer Sprache zu erfassen, kann nur eine möglichst offene Forschungsmethode dienlich sein, die durch Subjektivität gekennzeichnet wird. Daher wählt sie als Erhebungsverfahren das autobiographische Interview, welches als inzwischen anerkanntes Forschungsverfahren bereits vielfältig angewandt worden ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Teil
- 2.1 Die Entwicklung der Fotografie
- 2.2 Die Entwicklung der Aktfotografie
- 2.3 Verschiedene Ansichten des Körpers
- 2.4 150 Jahre Aktfotografie
- 2.5 Fotografie und Frau
- 2.6 Der gesellschaftliche Stellenwert der Frau in der Kunst
- 3. Epistemologischer Teil
- 3.1 Weibliche Perspektive des Körpers
- 3.3 Die männliche Perspektive des Körpers
- 3.4 Unterschiede zwischen der weiblichen und der männlichen Perspektive
- 4. Interviews
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschlechtsspezifische Perspektive in der Aktfotografie, fokussiert auf den sozialen Status von Frauen als Aktfotograf*innen und -Models im Laufe der Zeit. Die Autorin analysiert die Lebenswelten dieser Frauen, ihre Rolle in der Geschichte des Aktes, sowie ihre Ansichten und Strategien. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich der weiblichen und männlichen Perspektive in der Aktfotografie.
- Geschlechtsspezifische Perspektiven in der Aktfotografie
- Der soziale Status von Frauen in der Aktfotografie
- Vergleich der weiblichen und männlichen Perspektive
- Entwicklung der Aktfotografie im historischen Kontext
- Einfluss der Frauenbewegung auf die Aktfotografie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit – die geschlechtsspezifische Perspektive in der Aktfotografie und den sozialen Status der Frau als Aktfotografin und -modell. Die Motivation der Autorin rührt aus ihren persönlichen Erfahrungen als Aktmodell und Hobbyfotografin. Ein Grundlagendefizit an spezifischer Literatur zu Aktfotograf*innen und -Models wird als Forschungsanreiz genannt. Die Autorin erläutert ihr wissenschafts-theoretisches Vorgehen (induktiv) und die Wahl der autobiographischen Interviews als Forschungsmethode, wobei zwei zentrale Forschungsfragen formuliert werden: die Verhaltensweisen von Frauen in der Erotik und der Vergleich der weiblichen und männlichen Perspektive in der Aktfotografie.
2. Historischer Teil: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Fotografie und der Aktfotografie, beginnt mit der Camera obscura und verfolgt die technischen Entwicklungen bis zum Negativ-Positiv-Verfahren. Die Entwicklung der Aktfotografie wird von der antiken Kunst bis ins 20. Jahrhundert nachgezeichnet, wobei verschiedene Ansichten des Körpers im Aktfoto beleuchtet werden (Daguerreotypie, Akademien, frühe Pikanterien, Völkerkunde, Kunstfotografien, Freikörperkultur, etc). Der gesellschaftliche Stellenwert der Frau in der Kunst wird ebenfalls analysiert, wobei der lange verweigerte Zugang zu Kunstakademien und die Rolle der Frau in der "niedrigeren" Kunst hervorgehoben werden.
3. Epistemologischer Teil: Dieser Teil analysiert die weibliche und männliche Perspektive des Körpers in der Aktfotografie. Anhand von Biografien und Beispielen von Fotograf*innen wie Diane Arbus, Annie Leibovitz, Imogen Cunningham und Francesca Woodman sowie Robert Mapplethorpe und Helmut Newton wird die unterschiedliche Darstellung des weiblichen und männlichen Körpers in der Fotografie erörtert und der Einfluss der jeweiligen Perspektive auf die Bildgestaltung untersucht. Der Unterschied zwischen der weiblichen und männlichen Perspektive wird diskutiert, wobei Klischees und Vorurteile als Einflussfaktoren benannt werden.
4. Interviews: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführten Interviews mit Fotograf*innen und Wissenschaftler*innen. Die Autorin erläutert ihre Wahl der autobiografischen Interviews und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu den Perspektiven auf Aktfotografie, Erotik, Pornografie und Kunst im Allgemeinen.
Schlüsselwörter
Aktfotografie, geschlechtsspezifische Perspektive, Frauenbewegung, soziale Anerkennung, Erotik, Pornografie, weibliche Perspektive, männliche Perspektive, Fotografiegeschichte, Kunst, Klischees, Vorurteile.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Geschlechtsspezifische Perspektiven in der Aktfotografie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die geschlechtsspezifische Perspektive in der Aktfotografie, insbesondere den sozialen Status von Frauen als Aktfotograf*innen und -Models im Laufe der Zeit. Sie analysiert die Lebenswelten dieser Frauen, ihre Rolle in der Geschichte des Aktes, sowie ihre Ansichten und Strategien und vergleicht die weibliche und männliche Perspektive in der Aktfotografie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: geschlechtsspezifische Perspektiven in der Aktfotografie, den sozialen Status von Frauen in diesem Bereich, einen Vergleich der weiblichen und männlichen Perspektive, die Entwicklung der Aktfotografie im historischen Kontext und den Einfluss der Frauenbewegung auf die Aktfotografie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Historischer Teil (Entwicklung der Fotografie und Aktfotografie, verschiedene Ansichten des Körpers, gesellschaftlicher Stellenwert der Frau in der Kunst), 3. Epistemologischer Teil (weibliche und männliche Perspektive des Körpers, Vergleich beider Perspektiven), 4. Interviews und 5. Zusammenfassung und Ausblick.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Autorin verwendet ein induktives wissenschafts-theoretisches Vorgehen und autobiografische Interviews als Forschungsmethode. Die Interviews wurden mit Fotograf*innen und Wissenschaftler*innen geführt.
Welche zentralen Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit untersucht das Verhalten von Frauen in der Erotik und vergleicht die weibliche und männliche Perspektive in der Aktfotografie.
Welche historischen Aspekte werden beleuchtet?
Der historische Teil verfolgt die Entwicklung der Fotografie von der Camera obscura bis zum Negativ-Positiv-Verfahren und die Entwicklung der Aktfotografie von der antiken Kunst bis ins 20. Jahrhundert. Verschiedene Ansichten des Körpers im Aktfoto werden beleuchtet (Daguerreotypie, Akademien, frühe Pikanterien, Völkerkunde, Kunstfotografien, Freikörperkultur etc.). Der gesellschaftliche Stellenwert der Frau in der Kunst wird ebenfalls analysiert.
Wie wird die epistemologische Perspektive behandelt?
Der epistemologische Teil analysiert die weibliche und männliche Perspektive des Körpers in der Aktfotografie anhand von Biografien und Beispielen von Fotograf*innen wie Diane Arbus, Annie Leibovitz, Imogen Cunningham und Francesca Woodman sowie Robert Mapplethorpe und Helmut Newton. Der Unterschied zwischen den Perspektiven wird diskutiert, wobei Klischees und Vorurteile als Einflussfaktoren benannt werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aktfotografie, geschlechtsspezifische Perspektive, Frauenbewegung, soziale Anerkennung, Erotik, Pornografie, weibliche Perspektive, männliche Perspektive, Fotografiegeschichte, Kunst, Klischees, Vorurteile.
Wo findet man die Einleitung der Arbeit?
Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit – die geschlechtsspezifische Perspektive in der Aktfotografie und den sozialen Status der Frau als Aktfotografin und -modell. Die Motivation der Autorin wird erläutert und das wissenschafts-theoretische Vorgehen (induktiv) und die Wahl der autobiografischen Interviews als Forschungsmethode beschrieben. Zwei zentrale Forschungsfragen werden formuliert.
- Quote paper
- Bachelor Maria Theresia Bitterli (Author), 2004, Ein Vergleich von Frau und Mann in der Kunstfotografie der Erotik - Gestern und Heute , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152119