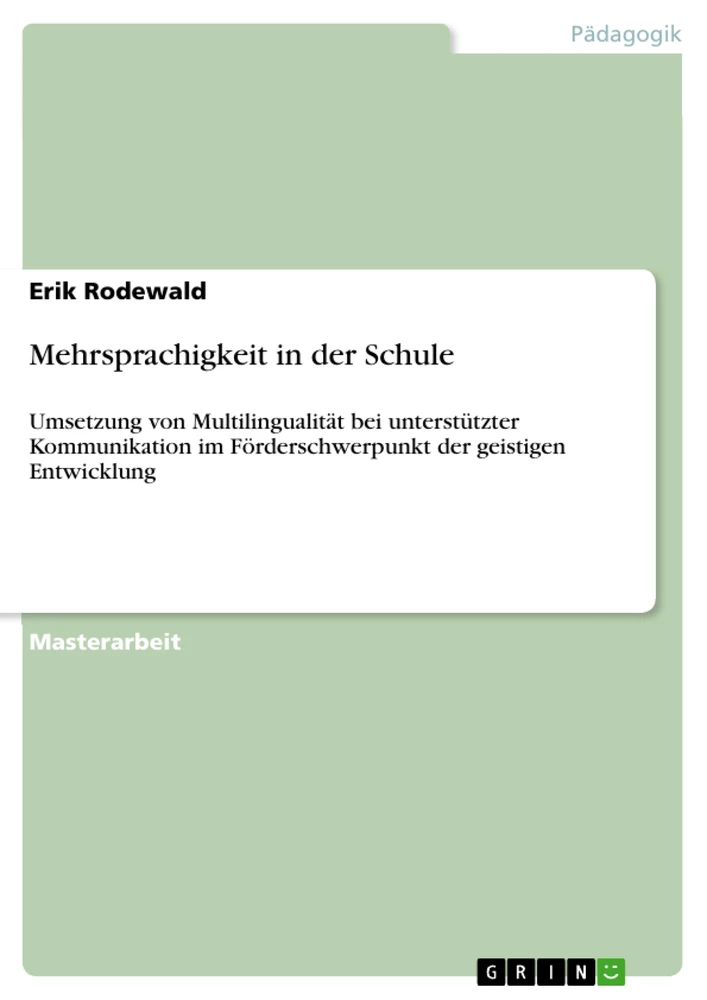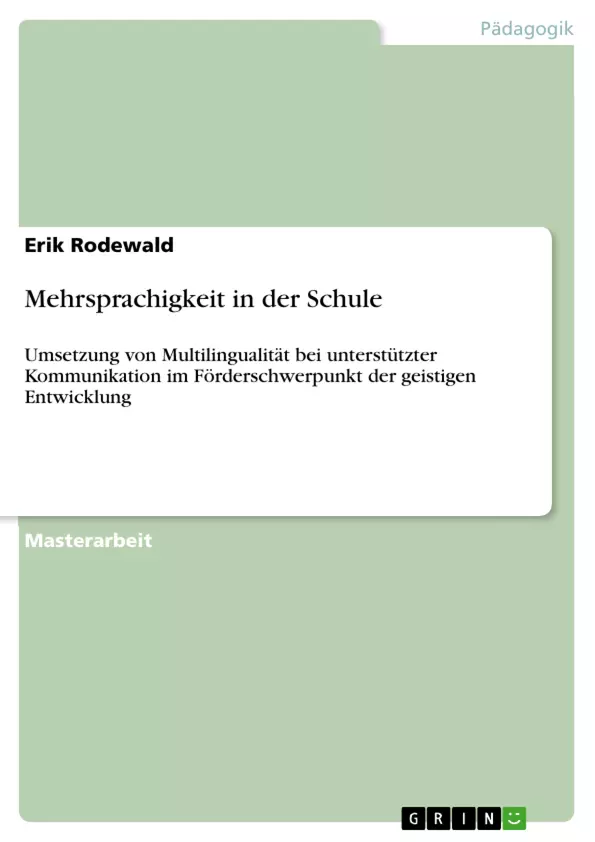Diese Masterarbeit untersucht die Implementierung von Mehrsprachigkeit bei Unterstützter Kommunikation im Förderschwerpunkt der Geistigen Entwicklung. Ziel der Forschung war es, ob und mit welchen Methoden und Strategien, mehrsprachige Schüler*innen bei der Nutzung Unterstützer Kommunikation aufgefangen werden, um eine effektive Kommunikation zu ermöglichen. Die Studie basiert auf einer quantitativen Vorerhebung und einer anschließenden qualitativen Analyse aus verschiedenen Förderschulen des Freistaates Thüringen mittels Interviews mit Lehrkräften. Die Ergebnisse zeigen, dass vor Allem der Einsatz symbolisch-visueller Hilfsmittel und nicht-elektronische Kommunikationsformen zum Tragen kommen. Elektronische Hilfsmittel, wie Tablets, finden eher selten Verwendung und diese auch meist in deutscher Ausgabesprache. Darüber hinaus wird deutlich, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern unverzichtbar ist, um individuelle sprachliche Bedürfnisse zu berücksichtigen und zu fördern. Die Erhebung unterstreicht, dass, obwohl es Umsetzungserfolge und -bemühungen gibt, diese noch gesteigert werden müssen. Zukünftige Forschungen sollten darauf abzielen, flächendeckend zu untersuchen, inwiefern die Umsetzung verbessert werden kann um diesen Schüler*innen im schulischen und lebensweltlichen Alltag gerecht zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
- 2.1.1 Herkunft und Terminologie
- 2.1.2 Schüler*innenbild des Förderschwerpunktes
- 2.1.3 Beschulung
- 2.2 Unterstützte Kommunikation
- 2.2.1 Kommunikation
- 2.2.2 Definition
- 2.2.3 Zielgruppen für Unterstützte Kommunikation
- 2.2.4 Relevanz im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
- 2.3 Multilingualismus / Mehrsprachigkeit
- 2.3.1 Begrifflichkeit
- 2.3.2 Relevanz im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
- 3 Aktueller Forschungsstand
- 4 Empirische Datenerhebung
- 4.1 Fragestellung
- 4.2 Online-Umfrage
- 4.2.1 Gütekriterien
- 4.2.2 Probandenauswahl
- 4.2.3 Erhebungsinstrument
- 4.2.4 Durchführung
- 4.2.5 Ergebnisse
- 4.3 Experteninterviews
- 4.3.1 Gütekriterien qualitativer Forschung
- 4.3.2 Probandenauswahl
- 4.3.3 Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl
- 4.3.4 Kategorienbildung der qualitativen Inhaltsanalyse
- 4.3.5 Ergebnisse
- 5 Diskussion
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Umsetzung von Mehrsprachigkeit bei Unterstützter Kommunikation (UK) im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Ziel ist es, Methoden und Strategien zu identifizieren, die mehrsprachigen Schüler*innen den Zugang zu effektiver Kommunikation ermöglichen. Die Studie analysiert, welche Hilfsmittel und Kommunikationsformen in der Praxis Anwendung finden.
- Implementierung von Mehrsprachigkeit in der Unterstützten Kommunikation
- Einsatz von Hilfsmitteln (symbolisch-visuell, elektronisch)
- Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern
- Sprachliche Bedürfnisse mehrsprachiger Schüler*innen mit geistiger Behinderung
- Verbesserungsmöglichkeiten der Umsetzung in Schule und Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Masterarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Untersuchung von Mehrsprachigkeit bei Unterstützter Kommunikation im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Sie skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit, die sowohl quantitative als auch qualitative Forschungsmethoden einsetzt. Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und begründet die Notwendigkeit, die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit in diesem spezifischen Kontext zu untersuchen.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Es beleuchtet den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, inklusive der Herkunft und Terminologie, des Schüler*innenbildes und der Beschulung. Ausführlich wird das Konzept der Unterstützten Kommunikation definiert, einschließlich relevanter Zielgruppen und dessen Bedeutung im Kontext geistiger Behinderung. Schließlich wird der Begriff des Multilingualismus/der Mehrsprachigkeit erläutert und dessen Relevanz für Schüler*innen mit geistiger Behinderung herausgestellt. Dieses Kapitel dient als fundierte Basis für die anschließende empirische Analyse.
3 Aktueller Forschungsstand: Das Kapitel fasst den aktuellen Forschungsstand zum Thema Mehrsprachigkeit und Unterstützte Kommunikation bei geistiger Behinderung zusammen. Es analysiert bestehende Literatur und Studien und identifiziert Forschungslücken, die die vorliegende Arbeit adressiert. Die Darstellung des Forschungsstandes dient dazu, die eigene Arbeit im Kontext der bisherigen Forschung einzuordnen und deren Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion zu verdeutlichen. Hier werden relevante Theorien und empirische Befunde kritisch bewertet und in Beziehung zueinander gesetzt.
4 Empirische Datenerhebung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Forschungsfrage, die eingesetzten Methoden (Online-Umfrage und Experteninterviews), die Probandenauswahl, die Gütekriterien und die Auswertung der Daten. Es werden die Durchführung der Studie, die verwendeten Erhebungsinstrumente sowie die angewandten Analyseverfahren detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Datenerhebung werden zusammenfassend präsentiert.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Unterstützte Kommunikation (UK), Geistige Entwicklung, Förderschule, inklusive Bildung, symbolisch-visuelle Hilfsmittel, elektronische Kommunikationshilfsmittel, Lehrer-Eltern-Zusammenarbeit, qualitative Forschung, quantitative Forschung, Thüringen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die Umsetzung von Mehrsprachigkeit bei Unterstützter Kommunikation (UK) im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Ziel ist es, Methoden und Strategien zu identifizieren, die mehrsprachigen Schüler*innen den Zugang zu effektiver Kommunikation ermöglichen. Die Studie analysiert, welche Hilfsmittel und Kommunikationsformen in der Praxis Anwendung finden.
Was sind die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Themenschwerpunkte umfassen die Implementierung von Mehrsprachigkeit in der Unterstützten Kommunikation, den Einsatz von Hilfsmitteln (symbolisch-visuell, elektronisch), die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern, die sprachlichen Bedürfnisse mehrsprachiger Schüler*innen mit geistiger Behinderung und Verbesserungsmöglichkeiten der Umsetzung in Schule und Alltag.
Was beinhaltet die Einleitung?
Die Einleitung führt in das Thema der Masterarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Untersuchung von Mehrsprachigkeit bei Unterstützter Kommunikation im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Sie skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit, die sowohl quantitative als auch qualitative Forschungsmethoden einsetzt. Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und begründet die Notwendigkeit, die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit in diesem spezifischen Kontext zu untersuchen.
Was wird in den theoretischen Grundlagen behandelt?
Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Es beleuchtet den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, inklusive der Herkunft und Terminologie, des Schüler*innenbildes und der Beschulung. Ausführlich wird das Konzept der Unterstützten Kommunikation definiert, einschließlich relevanter Zielgruppen und dessen Bedeutung im Kontext geistiger Behinderung. Schließlich wird der Begriff des Multilingualismus/der Mehrsprachigkeit erläutert und dessen Relevanz für Schüler*innen mit geistiger Behinderung herausgestellt.
Was beinhaltet der aktuelle Forschungsstand?
Das Kapitel fasst den aktuellen Forschungsstand zum Thema Mehrsprachigkeit und Unterstützte Kommunikation bei geistiger Behinderung zusammen. Es analysiert bestehende Literatur und Studien und identifiziert Forschungslücken, die die vorliegende Arbeit adressiert. Die Darstellung des Forschungsstandes dient dazu, die eigene Arbeit im Kontext der bisherigen Forschung einzuordnen und deren Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion zu verdeutlichen.
Was wird in der empirischen Datenerhebung beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Forschungsfrage, die eingesetzten Methoden (Online-Umfrage und Experteninterviews), die Probandenauswahl, die Gütekriterien und die Auswertung der Daten. Es werden die Durchführung der Studie, die verwendeten Erhebungsinstrumente sowie die angewandten Analyseverfahren detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Datenerhebung werden zusammenfassend präsentiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen Mehrsprachigkeit, Unterstützte Kommunikation (UK), Geistige Entwicklung, Förderschule, inklusive Bildung, symbolisch-visuelle Hilfsmittel, elektronische Kommunikationshilfsmittel, Lehrer-Eltern-Zusammenarbeit, qualitative Forschung, quantitative Forschung, Thüringen.
- Citation du texte
- Erik Rodewald (Auteur), 2024, Mehrsprachigkeit in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1521767