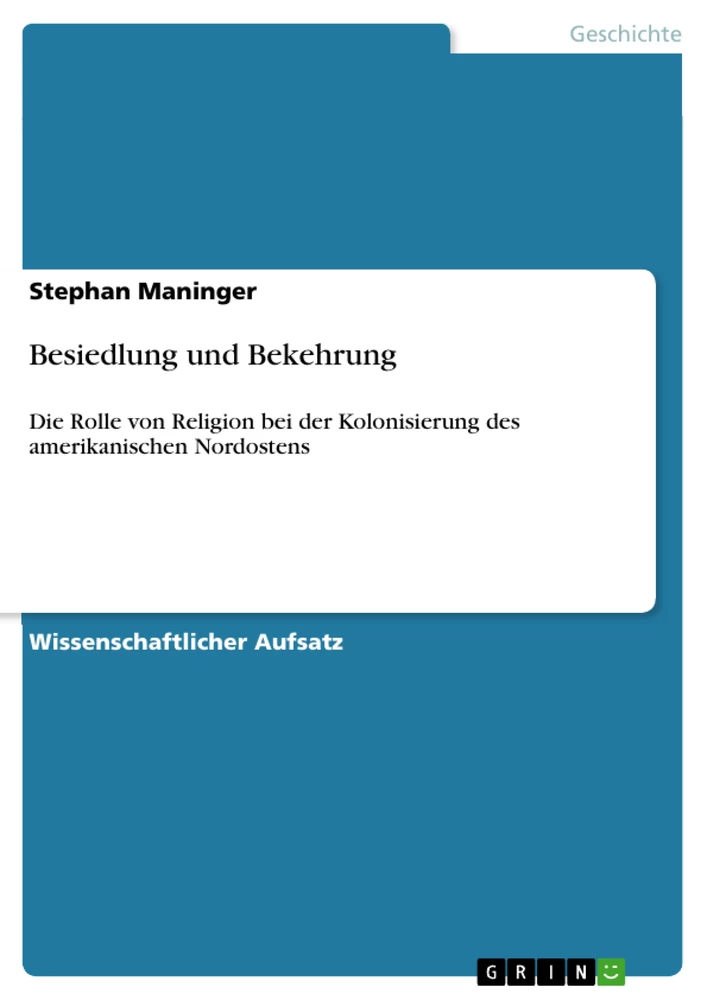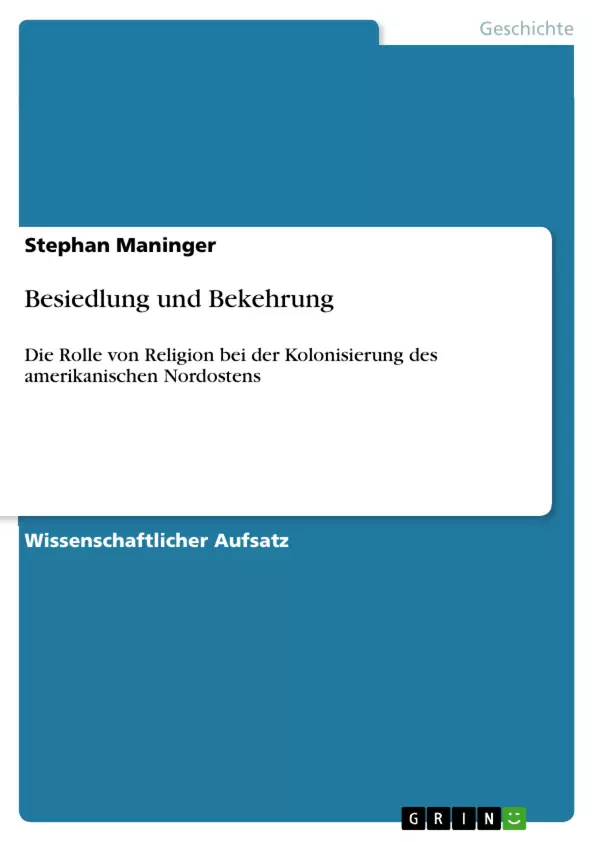In der Gründungs- und Entdeckungsphase des 16. und 17. Jahrhunderts wurden fast alle Kolonisierungsunternehmen in der „neuen Welt“ von Vertretern des christlichen Glaubens begleitet und in entscheidenden Fragen beeinflusst. Das frühe Kolonialzeitalter erlebte ein expansives Christentum, das sich mit dem gegenwärtigen humanistisch/pazifistisch geprägten Christentum nur bedingt vergleichen lässt. Als ergiebigste Quelle von Werten bot Religion ohnehin viel Konfliktpotenzial.
Was heute als religiöse Intoleranz betrachtet würde, wurde jedoch zur Zeit der europäischen Besiedlung allgemein als moralisch legitim akzeptiert. Religion war zu diesem Zeitpunkt für die Europäer der wichtigste Identifikationsschwerpunkt, die Identifikation mit der eigenen Nation oder Klassenzugehörigkeit weit weniger ausschlaggebend. Anfangs bestand auch keine klare Trennung zwischen Religion und Regierung – erst nach Abschluss des westfälischen Friedens 1648 begann sich diese im europäischen Wertesystem langsam zu etablieren. Insofern kann man zumindest die europäischen Kolonien, vor allem die puritanischen Kolonien Neuenglands, bis zum Ende des 17. Jahrhunderts teilweise als theokratisch „abstempeln“. Trotzdem war die Trennung zwischen dem Weltlichen und dem Spirituellen unter den Zuwanderern immer noch wesentlich deutlicher als unter den Einheimischen. Dies zeigte sich insbesondere in den jeweils gegensätzlichen Ansichten zur Natur und deren Funktion. Die Ureinwohner des Kontinents praktizierten Naturreligionen, denen zufolge jedes Lebewesen und jedes Objekt über eine Seele verfügte, die es auch zu gegebenen Anlass zu besänftigen galt. Diese wurden seitens der Neuankömmlinge bzw. Eroberer als inakzeptabler Aberglaube betrachtet, den es zu bekämpfen galt. Folgender Beitrag schildert den Verlauf dieses Konflikts.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenprall der Glaubensvorstellungen
- Der Verlauf der Glaubensfragen
- Bekehrungsversuche
- Die Katholiken
- Die Protestanten
- Religion im Konflikttransfer
- Bekehrungsversuche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Rolle der Religion bei der Kolonisierung des amerikanischen Nordostens im 16. und 17. Jahrhundert. Er untersucht den Zusammenprall der christlichen Glaubensvorstellungen der europäischen Kolonisten mit den Religionen der indigenen Bevölkerung und analysiert die Folgen für die Beziehungen zwischen den beiden Gruppen.
- Der Einfluss des christlichen Glaubens auf die Kolonisierung
- Die Konflikte zwischen den unterschiedlichen christlichen Konfessionen
- Der Umgang der Kolonisten mit den Religionen der Ureinwohner
- Die Rolle der Missionierung in der Kolonisierung
- Der Diskurs über die moralische Rechtfertigung der Kolonisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kolonisierung des amerikanischen Nordostens ein und stellt die Rolle der Religion in diesem Prozess heraus. Das zweite Kapitel analysiert den Konflikt zwischen den christlichen Glaubensvorstellungen der europäischen Kolonisten und den Religionen der Ureinwohner. Das dritte Kapitel beleuchtet die verschiedenen Bekehrungsversuche der Kolonisten, sowohl seitens der Katholiken als auch der Protestanten, und die Rolle der Religion im Konflikttransfer.
Schlüsselwörter
Kolonisierung, Religion, Christentum, Ureinwohner, Bekehrung, Konflikt, Missionierung, Nordamerika, Moral, Theokratie, Naturreligion.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte die Religion bei der Besiedlung Amerikas?
Religion war im 16. und 17. Jahrhundert der wichtigste Identifikationspunkt der Europäer und legitimierte moralisch die Kolonisierung und Missionierung.
Wie unterschieden sich die Ansichten zur Natur zwischen Siedlern und Ureinwohnern?
Die Ureinwohner praktizierten Naturreligionen (Animismus), während die Siedler die Natur als rein weltliches Objekt betrachteten, das es zu beherrschen galt.
Waren die frühen Kolonien Theokratien?
Besonders die puritanischen Kolonien Neuenglands können bis Ende des 17. Jahrhunderts teilweise als theokratisch bezeichnet werden, da es keine klare Trennung von Kirche und Staat gab.
Wie verliefen die Bekehrungsversuche der Ureinwohner?
Sowohl Katholiken als auch Protestanten versuchten, die indigenen Völker zum Christentum zu bekehren, was oft zu kulturellen Konflikten und Widerstand führte.
Was änderte der Westfälische Friede von 1648?
Nach 1648 begann sich in Europa langsam die Trennung zwischen Religion und Regierung im Wertesystem zu etablieren.
- Citar trabajo
- Dr. Stephan Maninger (Autor), 2010, Besiedlung und Bekehrung , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152228