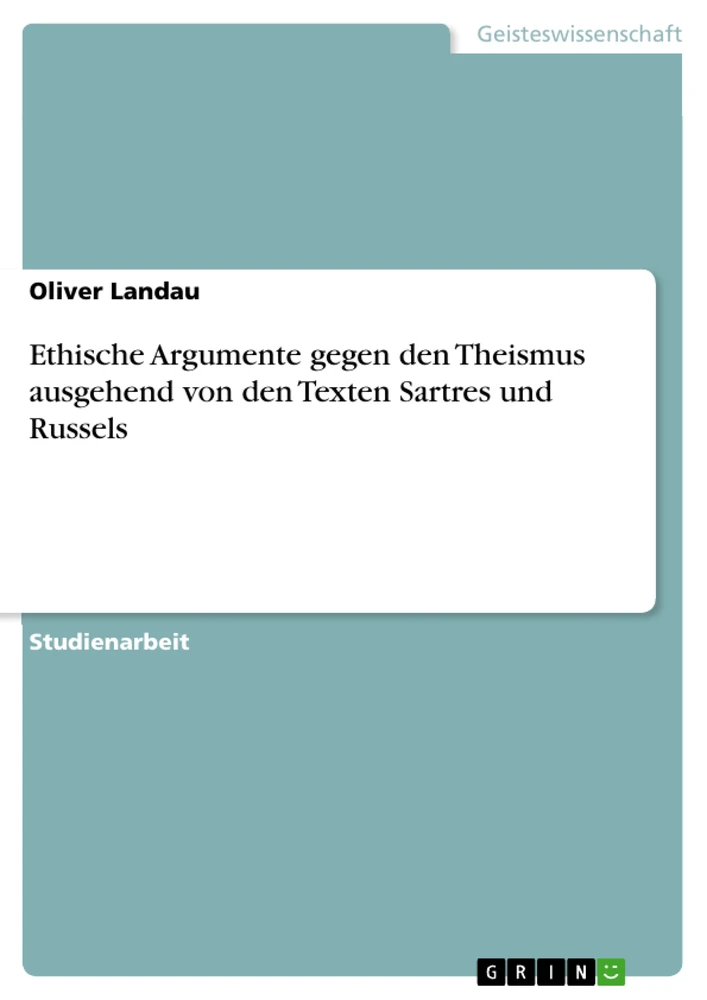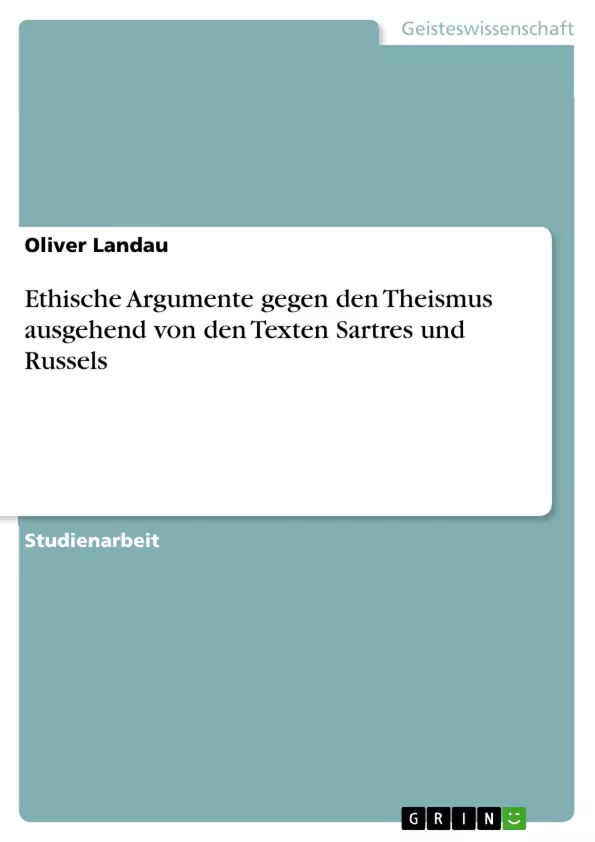Menschliches Dasein wird wesentlich durch sein Handeln bestimmt. Und dieses menschliche Handeln wird sowohl von dem Handelnden selbst, als auch von dessen Umwelt als „gut“ oder „schlecht“ bzw. „böse“ bewertet. Solche Bewertungen einer menschlichen Handlung kommt also eine sittlich-moralische Bedeutungsqualität zu.
Diese unmittelbaren normativen Aussagen verlangen ihrerseits zwangsläufig nach einer Instanz, an der sich diese sittlich-moralischen Qualitäten messen lassen.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der für das Abendland prägendsten Instanz für die Letztbegründung von Handlungsnormen, nämlich der Göttlichen.
Ausgehend von Sartres „Der Existenzialismus“ und Russells kleinen Abhandlungen „Warum ich kein Christ bin“ sowie „Hat die Religion nützliche Beiträge zur Zivilisation geleistet“ und darüber hinaus gestützt auf Mackies „Ethik – Die Erfindung des moralisch Richtigen und Falschen“ wird zu Beginn die Frage nach der Möglichkeit von Gottesbeweisen und deren Gegenargumenten des Theismus gestellt.
Im Anschluss daran wird die Frage behandelt, ob eine Ethik ohne Theismus begründbar ist. Hierbei muss zuerst der Gegenstand der Ethik bestimmt werden, um diesem folgend die Ausführungen der o. g. Philosophen auf die Grundfragen der Ethik hin zu analysieren.
Zum Schluss dieser Hausarbeit wird untersucht, ob eine Ethik ohne Theismus begründbar ist und inwiefern die bis dahin analysierten Argumente dazu dienlich sind.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE GÖTTLICHE EXISTENZ
- ARGUMENTE FÜR DEN THEISMUS
- Das kosmologische Argument
- Das teleologische Argument
- Das ontologische Argument
- Das moralische Argument
- Der Theismus bei Swinburne
- ARGUMENTE GEGEN DEN THEISMUS
- Sartre
- Russell
- Mackie
- IST EINE ETHIK OHNE ANNAHME DER EXISTENZ GOTTES BEGRÜNDBAR?
- ETHIK
- Moral/Sitte
- Moralität/Sittlichkeit
- BEGRÜNDUNG DER ETHIK DURCH ENDLICHE VERNUNFT
- Glück
- Freiheit
- Das Gute
- KRITIK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht ethische Argumente gegen den Theismus, ausgehend von den Schriften von Sartre und Russell, und analysiert die Begründbarkeit einer Ethik ohne Annahme der Existenz Gottes. Sie stellt dabei die Frage nach der Möglichkeit von Gottesbeweisen und beleuchtet Gegenargumente zum Theismus, bevor sie die Begründbarkeit der Ethik durch endliche Vernunft erörtert.
- Ethische Argumente gegen den Theismus
- Beweise für und gegen die Existenz Gottes
- Begründbarkeit einer Ethik ohne Theismus
- Analyse der Schriften von Sartre und Russell
- Die Rolle der endlichen Vernunft in ethischen Fragen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der ethischen Bewertung menschlichen Handelns vor und beleuchtet die Bedeutung der göttlichen Instanz für die Begründung von Handlungsnormen. Sie führt die zentralen Autoren und ihre Werke ein und skizziert die wichtigsten Fragestellungen der Arbeit.
- Die göttliche Existenz: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Argumente für den Theismus, wie das kosmologische, teleologische, ontologische und moralische Argument sowie die Argumentationslinie von Swinburne. Es werden die grundlegenden Prämissen und Zugänge zu Gottesbeweisen erörtert.
- Argumente gegen den Theismus: Dieses Kapitel analysiert die Argumente von Sartre, Russell und Mackie gegen den Theismus, die die Freiheit des Menschen und die Begründbarkeit von Moral ohne göttliche Instanz in den Vordergrund stellen.
- Ist eine Ethik ohne Annahme der Existenz Gottes begründbar?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs "Ethik" und untersucht die Möglichkeit einer Begründbarkeit von Moral durch endliche Vernunft. Dabei werden die zentralen Aspekte von Glück, Freiheit und dem Guten im Kontext der ethischen Argumentation betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Theismus, Atheismus, Ethik, Moral, Freiheit, Verantwortung, Gottesbeweise, Sartre, Russell, Mackie und Begründbarkeit von Moral ohne Gottesglauben.
Häufig gestellte Fragen
Können ethische Normen ohne Gott begründet werden?
Ja, die Arbeit untersucht, wie Ethik durch endliche Vernunft, menschliche Freiheit und das Streben nach Glück auch ohne theistische Instanz legitimiert werden kann.
Was ist Sartres Hauptargument gegen den Theismus?
Sartre argumentiert, dass die Existenz eines schöpferischen Gottes die absolute Freiheit und Verantwortung des Menschen einschränken würde („Der Existenzialismus ist ein Humanismus“).
Warum lehnt Bertrand Russell das Christentum ab?
Russell kritisiert in „Warum ich kein Christ bin“ die logischen Mängel von Gottesbeweisen und betont die schädlichen Auswirkungen organisierter Religion auf den zivilisatorischen Fortschritt.
Was sind die klassischen Gottesbeweise?
Dazu zählen das kosmologische (Ursache), das teleologische (Zweckmäßigkeit), das ontologische (Wesen) und das moralische Argument.
Was bedeutet „Ethik als Erfindung“ bei J.L. Mackie?
Mackie vertritt einen moralischen Skeptizismus und argumentiert, dass moralische Werte keine objektiven Tatsachen in der Welt sind, sondern menschliche Konstruktionen.
- Citation du texte
- M.A. Oliver Landau (Auteur), 2002, Ethische Argumente gegen den Theismus ausgehend von den Texten Sartres und Russels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152237