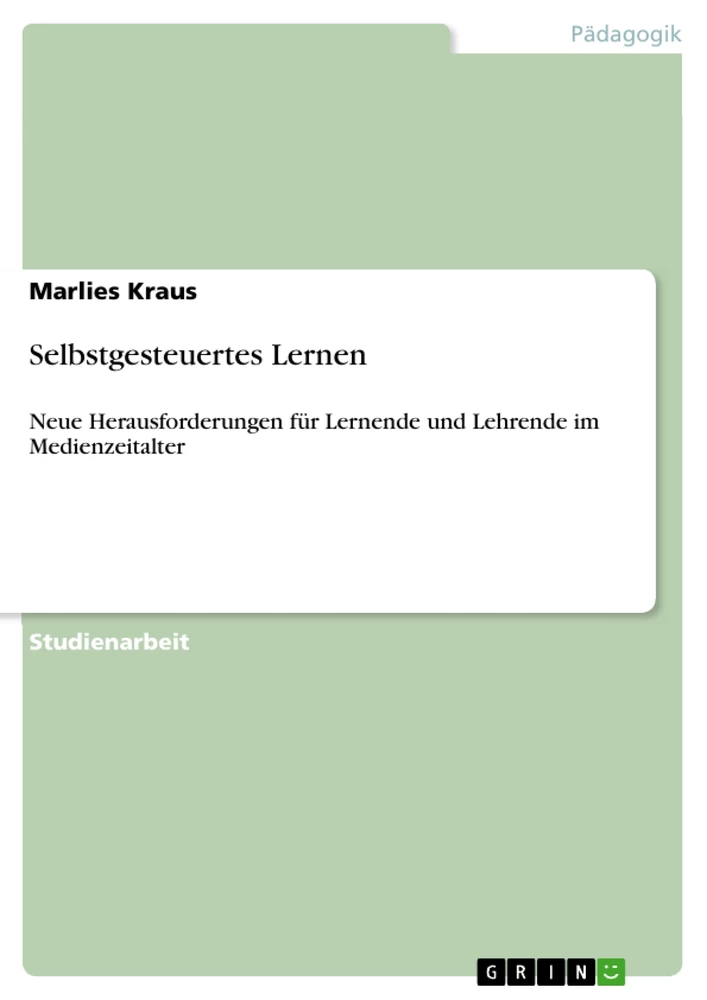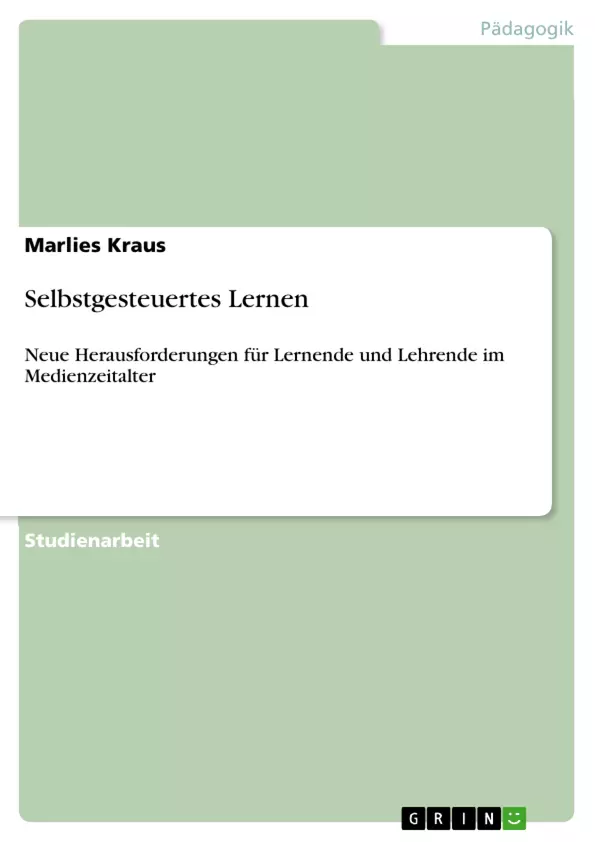Die Dynamik der technologischen Neuerungen und die große Menge des Wissens machen heutzutage eine andere Art der Vermittlung von Kompetenzen sowie lebenslanges Lernen erforderlich.
Unter diesen veränderten Rahmenbedingungen unserer heutigen Wissensgesellschaft ist deshalb ein auf Vorrat gespeichertes Fachwissen nach wie vor unentbehrlich, jedoch liegt der Fokus auf methodischen, kommunikativen und emotionalen Kompetenzen sowie auf der Fähigkeit zur gezielten Informationsbeschaffung und -nutzung.
Den Lehrenden fällt bei der Gestaltung der Lehr-Lernprozesse die Aufgabe zu, durch geeignete didaktische Aufbereitung des Lernstoffs und durch Lernberatung Selbstlernprozesse beim Teilnehmer zu entwickeln und zu fördern.
Mit dieser Abkehr von der traditionellen Belehrungsdidaktik hin zur Ermöglichungsdidaktik erhalten die Lernenden die Möglichkeit, sich die für Selbstlernprozesse notwendigen Kompetenzen anzueignen.
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
1.1 Gesellschaft und Arbeitswelt im Wandel
1.1.1 Globalisierung
1.1.2 Demographischer Wandel
1.1.3 Wissensexplosion und -veralterung
1.2 Lebenslanges Lernen
1.2.1 Teilhabe an der Gesellschaft
1.2.2 Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit
2 VERGLEICH AKTUELLER LERNTHEORIEN
2.1 Die behavioristische Lerntheorie
2.2 Die sozial-kognitive Lerntheorie
2.3 Die kognitive Lerntheorie
2.4 Die konstruktivistische Lerntheorie
3 LERNEN IM MEDIENZEITALTER
3.1 Die frühe Phase des Medienzeitalters
3.2 Die Neuen Medien
3.3 Wandel der Lernkultur
4 SELBSTGESTEUERTES LERNEN
4.1 Die Historie des Selbstgesteuerten Lernens
4.2 Kaiserslauterer Forschungsprojekt Selbstlernkompetenzen
4.3 Anforderungen an die Lernenden
4.3.1 Das Modell der Selbstlernkompetenz
4.3.2 Die Elemente des Modells der Selbstlernkompetenz
4.3.3 Kompetenz für die Wissensgesellschaft: Medienkompetenz
4.4 Anforderungen an die Lehrenden
4.4.1 Die subjektorientierte Lerntheorie von Holzkamp
4.4.2 Von der Vermittlungs- zur Ermöglichungsdidaktik
4.4.3 Lernberatung durch die Institution
5 ZUSAMMENFASSUNG
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Häufig gestellte Fragen
Was ist selbstgesteuertes Lernen?
Es ist eine Lernform, bei der die Lernenden die wesentlichen Schritte ihres Lernprozesses (Ziele, Methoden, Erfolgskontrolle) selbst planen und steuern.
Warum wird lebenslanges Lernen in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger?
Wissensexplosion, Globalisierung und technologischer Wandel führen dazu, dass Fachwissen schneller veraltet und kontinuierliche Kompetenzentwicklung für die Beschäftigungsfähigkeit essenziell ist.
Was versteht man unter "Ermöglichungsdidaktik"?
Im Gegensatz zur Belehrungsdidaktik schafft die Ermöglichungsdidaktik Rahmenbedingungen, in denen Lernende sich Wissen eigenständig aneignen und Kompetenzen entwickeln können.
Welche Anforderungen stellt selbstgesteuertes Lernen an die Lernenden?
Lernende benötigen Selbstlernkompetenzen, darunter methodische Fähigkeiten, Medienkompetenz sowie die Fähigkeit zur Selbstmotivation und Informationsnutzung.
Welche Rolle haben Lehrende beim selbstgesteuerten Lernen?
Lehrende fungieren weniger als Wissensvermittler, sondern eher als Lernberater, Begleiter und Gestalter von lernförderlichen Umgebungen.
- Quote paper
- Marlies Kraus (Author), 2009, Selbstgesteuertes Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152652