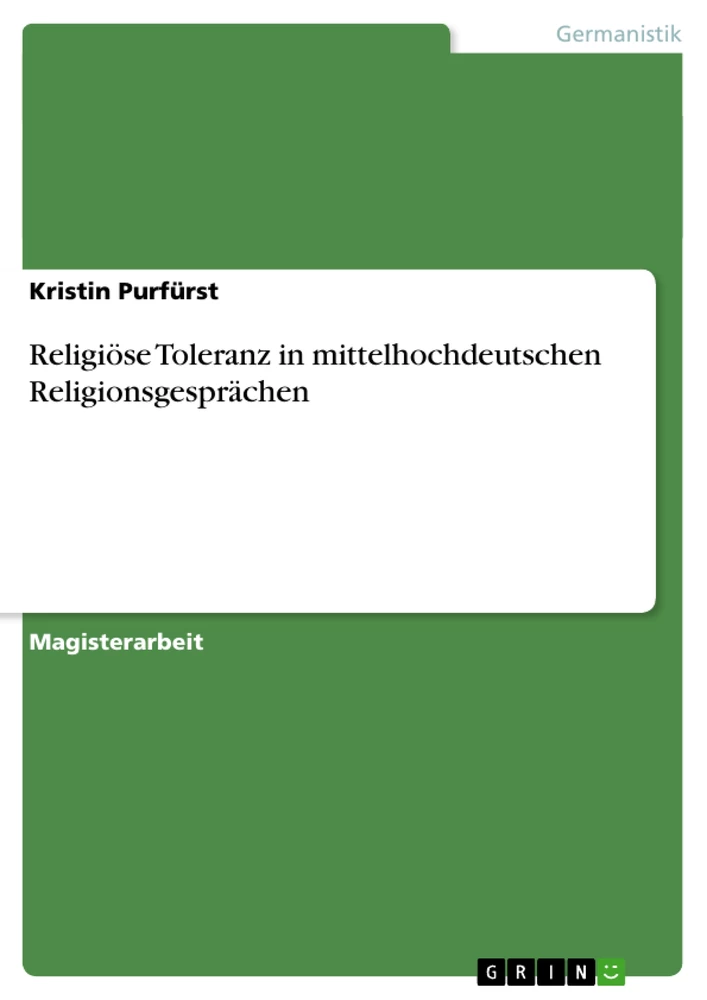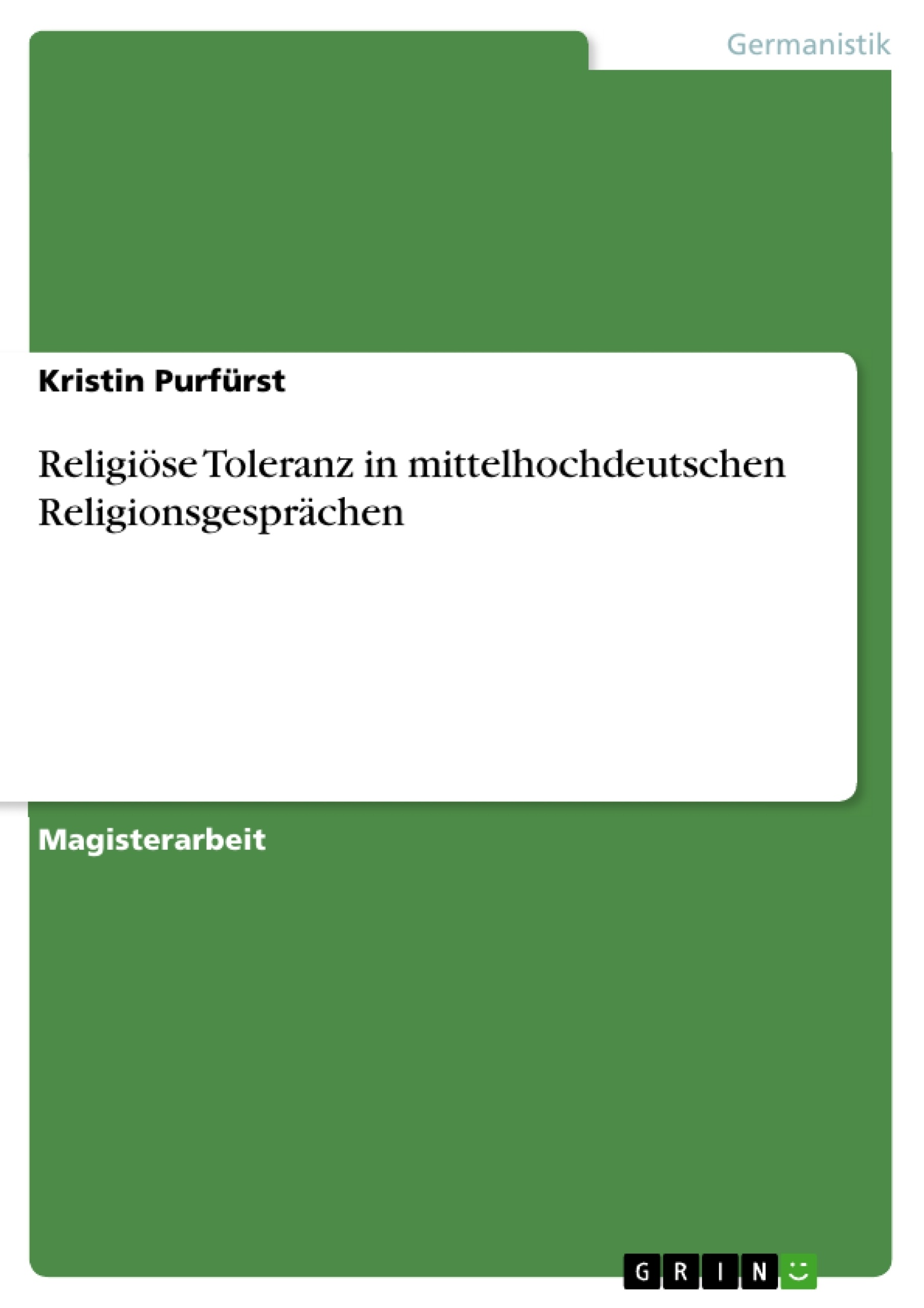Mit der in Deutschland entbrannten Diskussion um religiöse Toleranz/Intoleranz angesichts der zunehmend religiös pluralistischen Gesellschaft sowie mehr oder weniger friedlichem Aufeinandertreffen, in der Hauptsache von orientalischem und okzidentalischem Kulturraum, stehen auch Mediävisten erneut vor dem „Toleranzproblem“ als einer historische Größe. Es gilt zu erörtern, ob sich anhand mittelhochdeutscher und lateinischer Dichtungen Rückschlüsse auf mittelalterliches Denken und damit auf das geistige Erbe des 21. Jh.s schließen lassen. [...] Die hier vorgestellte Arbeit konzentriert sich auf die Religionsgespräche der "Silvesterlegende aus der Kaiserchronik". Im Mittelpunkt stehen die Fragen, ob das 11.-13. einen Spielraum für von der christlich-katholischen Lehre abweichende Glaubensformen kannte, ob religiös tolerantes Denken in mittelhochdeutschen Dichtungen dieses Zeitraumes allgemein und speziell in den Religionsgesprächen der für diese Arbeit ausgewählten Dichtung zu finden ist oder ob der „Stempel Toleranz“ zu schnell vergeben wird. Als Einführung in die Problematik betrachtet das erste Kapitel das Wortfeld Toleranz sowie die Bedeutungsvielfalt des Begriffes 'tolerantia' in mittelalterlichen Texten. Das darauf folgende (zweite) Kapitel betrachtet Modelle von Welt- und Fremddeutung im Mittelalter, um geistesgeschichtliche Ansätze toleranten Denkens in mittelhochdeutschen Dichtungen erkennen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Toleranz im Mittelalter
- I.1 Toleranz - Begriff und Problematik
- I.2 Verwendung und Bedeutungsvielfalt der Vokabel tolerantia in mittelalterlichen Texten - ein Einblick
- I.3 Zusammenfassung
- II. Welt- und Fremdwahrnehmung im Mittelalter
- II.1 Welt- und Fremddeutung im Mittelalter - erste Einblicke und Problemanalyse
- II.1.1 Zusammenfassung
- II.2 Modelle von Welt- und Fremddeutung im Mittelalter
- II.2.1 Geschaffen nach dem Ebenbild Gottes
- II.2.2 Schonungsgebot und Gottesfeindschaft
- II.2.2.1 Toleranz, Nächstenliebe und Rationalität
- II.2.2.1.1 die neutestamentliche caritas-Forderung und die Zwei-Reiche-Lehre
- II.2.2.1.2 Peter Abailard und die mittelalterliche Dialogliteratur
- II.2.2.1.3 Augustinus und das Unkraut-Weizen-Gleichnis
- II.2.2.1.4 Thomas von Aquin - Unterschiedlichkeit der Dinge ist gut!
- II.2.2.2 Ideologie des Kreuzzugs
- II.2.2.3 Der Edel Heide und die Literatur der Ritterdichter
- II.2.2.1 Toleranz, Nächstenliebe und Rationalität
- II.3 Zusammenfassung
- II.1 Welt- und Fremddeutung im Mittelalter - erste Einblicke und Problemanalyse
- III. Toleranz in mittelhochdeutschen Religionsgesprächen?!
- III.1 Die Religionsgespräche der Silvesterlegende
- III.1.1 Vernunft und ubirmuot
- III.1.2 Duldung, Anerkennung und Grenzen von Toleranz innerhalb der Religionsgespräche der Silvesterlegende
- III.1.3 Zusammenfassung
- III.1 Die Religionsgespräche der Silvesterlegende
- IV Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht den Begriff der Toleranz im Mittelalter, insbesondere in mittelhochdeutschen Religionsgesprächen. Ziel ist es, die verschiedenen Facetten von Toleranz im Kontext der damaligen Welt- und Fremdwahrnehmung zu beleuchten und deren Ausdruck in literarischen Texten zu analysieren.
- Der Begriff der Toleranz im Mittelalter und seine Problematik
- Welt- und Fremdwahrnehmung im Mittelalter und deren Einfluss auf die Konzeption von Toleranz
- Die Darstellung von Toleranz in mittelhochdeutschen Religionsgesprächen
- Analyse verschiedener Modelle von Welt- und Fremddeutung im Mittelalter
- Die Rolle von Vernunft und Nächstenliebe im Verständnis von Toleranz
Zusammenfassung der Kapitel
I. Toleranz im Mittelalter: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es den komplexen und vielschichtigen Begriff der Toleranz im mittelalterlichen Kontext definiert und die damit verbundenen Schwierigkeiten beleuchtet. Es untersucht die Verwendung und Bedeutungsvielfalt des Wortes "tolerantia" in mittelalterlichen Texten und bietet eine erste Annäherung an das Thema, indem es die Herausforderungen einer zeitgenössischen Interpretation mittelalterlicher Denkweisen aufzeigt. Die Zusammenfassung des Kapitels soll dabei die Ambivalenz des Toleranzbegriffes im Mittelalter herausstellen und die methodischen Herausforderungen der Untersuchung bereitstellen.
II. Welt- und Fremdwahrnehmung im Mittelalter: Dieses Kapitel analysiert die Welt- und Fremdwahrnehmung des Mittelalters als essentiellen Kontext für das Verständnis von Toleranz. Es beleuchtet verschiedene Modelle der Weltdeutung, wie die Schöpfungsgeschichte und die Vorstellung des Menschen als Ebenbild Gottes, sowie Konzepte wie das Schonungsgebot und die Gottesfeindschaft. Die Auseinandersetzung mit zentralen theologischen Figuren wie Augustinus, Thomas von Aquin und Peter Abailard, sowie die Betrachtung der Ideologie der Kreuzzüge und der literarischen Darstellung des "Edelheiden", verdeutlichen die komplexen und oft widersprüchlichen Haltungen gegenüber Andersgläubigen. Das Kapitel liefert eine fundierte Grundlage für die anschließende Analyse der mittelhochdeutschen Religionsgespräche.
III. Toleranz in mittelhochdeutschen Religionsgesprächen?!: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung von Toleranz in ausgewählten mittelhochdeutschen Religionsgesprächen, insbesondere in der Silvesterlegende. Es analysiert die Rolle von Vernunft und "ubirmuot" (Übermut) in den Dialogen und beleuchtet die Ambivalenz zwischen Duldung, Anerkennung und den Grenzen von Toleranz, die in diesen Texten zum Ausdruck kommen. Die Kapitelzusammenfassung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutiert deren Bedeutung für das Verständnis von Toleranz im mittelalterlichen Diskurs.
Schlüsselwörter
Toleranz, Mittelalter, Religionsgespräche, mittelhochdeutsch, Welt- und Fremdwahrnehmung, Theologie, Dialogliteratur, Augustinus, Thomas von Aquin, Peter Abailard, caritas, Zwei-Reiche-Lehre, Kreuzzüge, Silvesterlegende, Vernunft, ubirmuot.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Toleranz im Mittelalter
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Begriff der Toleranz im Mittelalter, insbesondere in mittelhochdeutschen Religionsgesprächen. Sie beleuchtet die verschiedenen Facetten von Toleranz im Kontext der damaligen Welt- und Fremdwahrnehmung und analysiert deren Ausdruck in literarischen Texten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Begriff der Toleranz im Mittelalter und dessen Problematik, der Welt- und Fremdwahrnehmung im Mittelalter und deren Einfluss auf die Konzeption von Toleranz, der Darstellung von Toleranz in mittelhochdeutschen Religionsgesprächen, der Analyse verschiedener Modelle von Welt- und Fremddeutung im Mittelalter und der Rolle von Vernunft und Nächstenliebe im Verständnis von Toleranz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Kapitel I legt den Grundstein, indem es den Toleranzbegriff im mittelalterlichen Kontext definiert und die damit verbundenen Schwierigkeiten beleuchtet. Kapitel II analysiert die Welt- und Fremdwahrnehmung des Mittelalters als essentiellen Kontext für das Verständnis von Toleranz. Kapitel III untersucht die Darstellung von Toleranz in ausgewählten mittelhochdeutschen Religionsgesprächen, insbesondere in der Silvesterlegende. Kapitel IV bildet das Fazit.
Welche zentralen mittelalterlichen Figuren werden untersucht?
Die Arbeit befasst sich mit zentralen theologischen Figuren wie Augustinus, Thomas von Aquin und Peter Abailard und ihren jeweiligen Konzepten von Toleranz, Nächstenliebe und dem Umgang mit Andersgläubigen.
Welche Texte werden analysiert?
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Analyse mittelhochdeutscher Religionsgespräche, insbesondere der Silvesterlegende. Die Arbeit untersucht, wie in diesen Texten Toleranz, Duldung, Anerkennung und deren Grenzen dargestellt werden.
Welche Konzepte werden im Zusammenhang mit Toleranz diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Konzepte wie das Schonungsgebot, Gottesfeindschaft, die neutestamentliche caritas-Forderung, die Zwei-Reiche-Lehre, die Ideologie des Kreuzzugs und die literarische Darstellung des „Edelheiden“. Die Rolle von Vernunft und „ubirmuot“ (Übermut) in den Dialogen wird ebenfalls untersucht.
Welche methodischen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die methodischen Herausforderungen, die sich aus der zeitgenössischen Interpretation mittelalterlicher Denkweisen und dem komplexen, vielschichtigen Begriff der Toleranz ergeben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Toleranz, Mittelalter, Religionsgespräche, mittelhochdeutsch, Welt- und Fremdwahrnehmung, Theologie, Dialogliteratur, Augustinus, Thomas von Aquin, Peter Abailard, caritas, Zwei-Reiche-Lehre, Kreuzzüge, Silvesterlegende, Vernunft, ubirmuot.
- Citar trabajo
- Kristin Purfürst (Autor), 2009, Religiöse Toleranz in mittelhochdeutschen Religionsgesprächen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153209