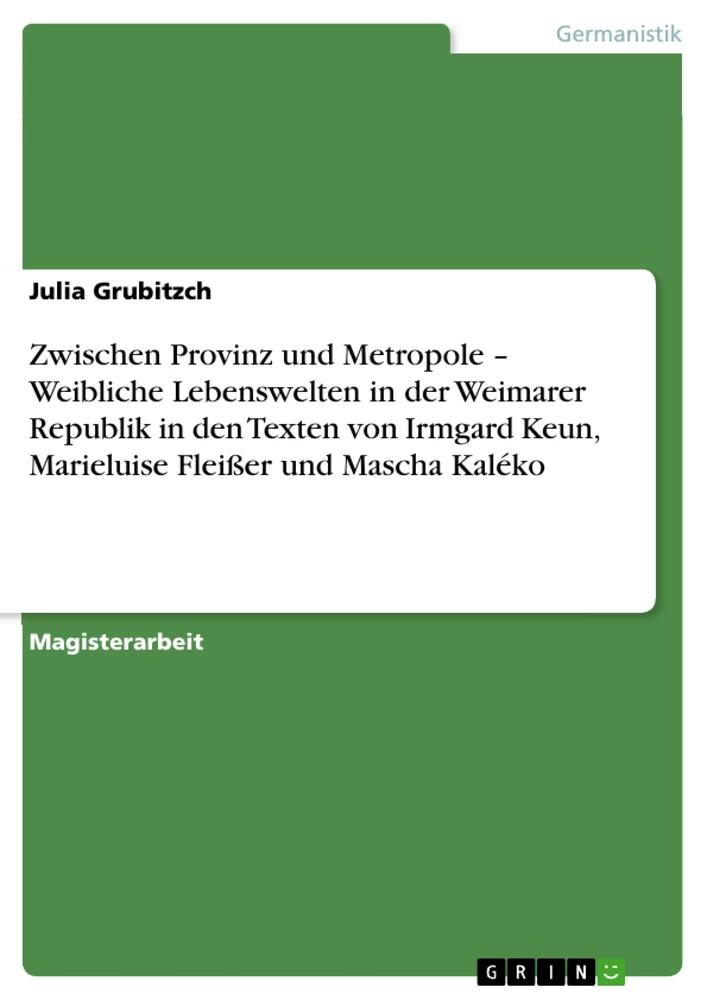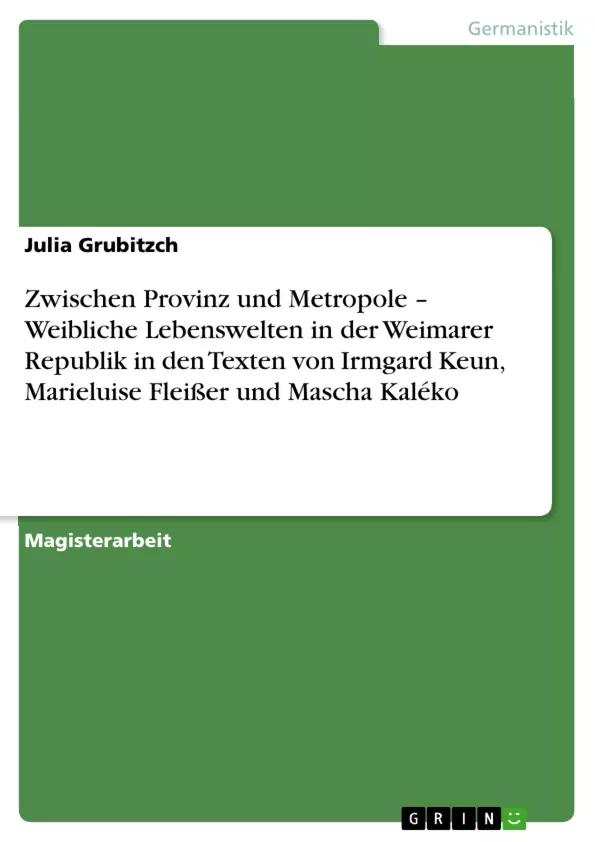Der Erste Weltkrieg war eines der einschneidendsten Erlebnisse für die Menschen am Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine Situation des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs entstand, die ganz besonders für Frauen weitreichende Auswirkungen hatte. Die unzähligen männlichen Todesopfer des Weltkrieges hinterließen große Lücken, die bald den Arbeitsmarkt grundlegend verändern sollten. Für die Frauen ergaben sich ungeahnte Möglichkeiten, neue Berufsfelder entstanden und verbesserte Ausbildungsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund des Umbruches und des Aufbruchs entsprang das Schlagwort der ‚Neuen Frau’, das „noch heute als Synonym für das Frauenbild der Zwanziger Jahre gilt.“ Alexandra Kollontai versucht in ihrem Aufsatz das Phänomen der „Neuen Frau“ zu erfassen. Sie grenzte es von den „alten“ Frauenbildern ab:
„Es sind nicht die reinen, lieben Mädchen, deren Roman sein Ende in einer wohlgelungenen Verheiratung fand, es sind nicht die Ehefrauen, die unter der Untreue ihres Mannes leiden, oder die sich selbst des Ehebruchs schuldig gemacht haben, es sind auch nicht die alten Mädchen, die die unglückliche Liebe ihrer Jugend beweinen, es sind ebenso wenig die „Priesterinnen der Liebe“, die Opfer der traurigen Lebensbedingungen oder ihrer eigenen lasterhaften Natur.“
In dieser Arbeit sollen die Lebenswelten von Frauen in der Weimarer Republik betrachtet werden unter besonderer Berücksichtigung der Unterschiede zwischen dem Leben in der Metropole Berlin und dem Leben in der Provinz. Als literarische Texte wurden „Das Kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun, „Die Mehlreisende Frieda Geier“ und „Pioniere in Ingolstadt“ von Marieluise Fleißer und das Gedicht „Großstadtliebe“ von Mascha Kaléko herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Hintergründe
- 1.1. Liebe und Ehe
- 1.1.1. Die Frau in der Politik
- 1.1.2. Die „Neue Frau“ in den Medien
- 1.1.3. Bubikopf und Zigarettenspitze- Mode und Frisuren
- 1.1.4. Weibliche Angestellte in der Weimarer Republik
- 1.1.5. Schriftstellerinnen und Reporterinnen
- 1.1.6. Die Neue Sachlichkeit
- 1.1.7. Die Darstellung der Frau in der Literatur der 20er Jahre
- 1.2. Großstadt in der Literaturgeschichte
- 1.2.1. Berlin in der Literatur der Weimarer Republik
- 2. „Das kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun
- 2.1. Biografischer Abriss zu Irmgard Keun
- 2.2. Die Darstellung der Frau in der Großstadt anhand von „Das Kunstseidene Mädchen“
- 2.3. Die Großstadterfahrung von Protagonistin Doris
- 2.4. Schlussfolgerung
- 3. Marieluise Fleißer
- 3.1. Biografischer Abriss zu Marieluise Fleißer
- 3.2. Marieluise Fleißer und ihr Verhältnis zu Ingolstadt
- 3.3. „Mehlreisende Frieda Geier“ von Marieluise Fleißer
- 3.3.1. Frieda Geier als Berufstätige
- 3.3.2. Die Beziehung von Frieda Geier zu Gustl
- 3.3.3. Die Darstellung Frieda Geiers als Frau
- 3.3.4. Vergleich der beiden Fassungen hinsichtlich des Frauenbildes
- 3.3.5. Provinz und Metropole in „Die Mehlreisende Frieda Geier“
- 3.4. „Pioniere in Ingolstadt“ von Marieluise Fleißer
- 3.4.1. Die Figur Alma
- 3.4.2. Die Figur der Berta
- 3.4.3. Die männliche Perspektive in „Pioniere in Ingolstadt“
- 4. „Großstadtliebe“ von Mascha Kaléko
- 4.2. Biografischer Abriss zu Mascha Kaléko
- 4.3. Die Neue Sachlichkeit und Mascha Kaléko
- 4.4. Selbstwahrnehmung der Mascha Kaléko
- 4.5. Die Großstadt in der Lyrik Mascha Kalékos
- 4.6. Mascha Kaléko „Großstadtliebe“
- III. Schlussbetrachtung
- Das Frauenbild in der Weimarer Republik
- Die „Neue Frau“ als Symbol für gesellschaftliche Veränderungen
- Die Darstellung der Frau in der Literatur der Weimarer Republik
- Der Einfluss der Großstadt auf die Lebenswelten von Frauen
- Der Vergleich zwischen den Lebenswelten von Frauen in der Metropole Berlin und der Provinz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lebenswelten von Frauen in der Weimarer Republik und analysiert, wie sich die Rolle der Frau in der Gesellschaft und Literatur dieser Zeit durch die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche nach dem Ersten Weltkrieg veränderte.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Hintergrund der Weimarer Republik und die Entstehung des Begriffs der „Neuen Frau“ vor. Sie beleuchtet die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit, die zu neuen Möglichkeiten für Frauen führten.
Das erste Kapitel untersucht die Hintergründe des neuen Frauenbildes. Es beleuchtet verschiedene Aspekte der Lebenswelt von Frauen in der Weimarer Republik, wie z.B. die politische Partizipation, die Medienlandschaft, die Mode und die neue Rolle der Frau im Berufsleben.
Das zweite Kapitel analysiert das Werk „Das kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun. Es beleuchtet die Darstellung der Frau in der Großstadt und die Erfahrungen der Protagonistin Doris.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Autorin Marieluise Fleißer und ihren Werken „Die Mehlreisende Frieda Geier“ und „Pioniere in Ingolstadt“. Es untersucht die Lebenswelten von Frauen in der Provinz und die Darstellung von Frauengestalten in ihren Texten.
Das vierte Kapitel analysiert das Gedicht „Großstadtliebe“ von Mascha Kaléko und beleuchtet die Themen der Neuen Sachlichkeit und die Selbstwahrnehmung der Frau in der Großstadt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen des Frauenbildes in der Weimarer Republik, der „Neuen Frau“, der Darstellung der Frau in der Literatur, der Großstadt, der Provinz, der Neuen Sachlichkeit und der Selbstwahrnehmung der Frau.
- Citation du texte
- Julia Grubitzch (Auteur), 2010, Zwischen Provinz und Metropole – Weibliche Lebenswelten in der Weimarer Republik in den Texten von Irmgard Keun, Marieluise Fleißer und Mascha Kaléko, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153255