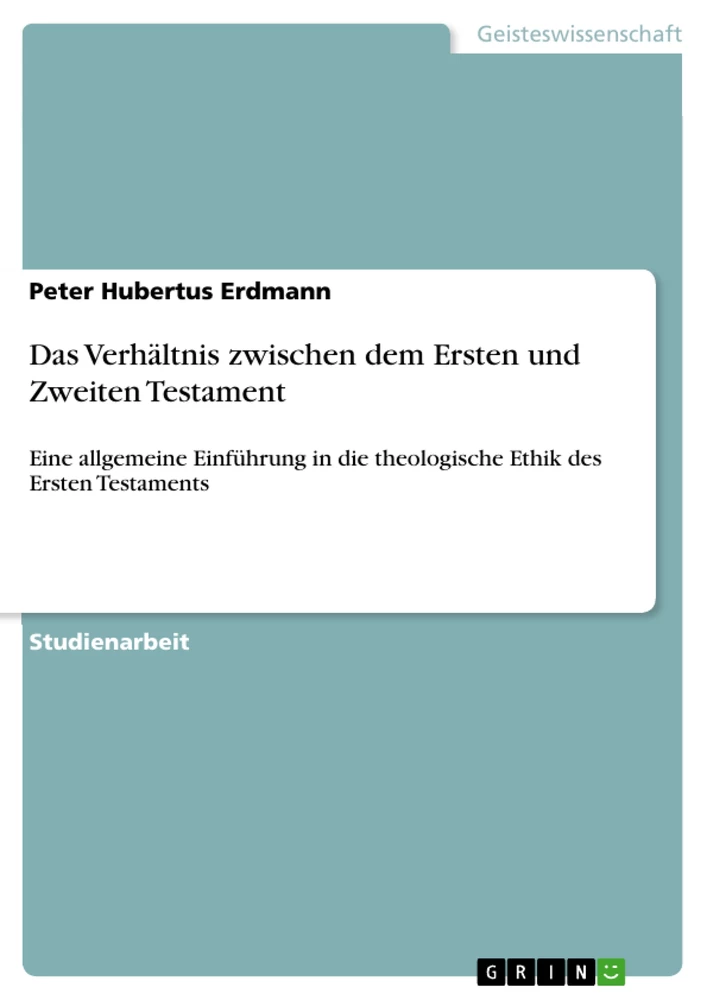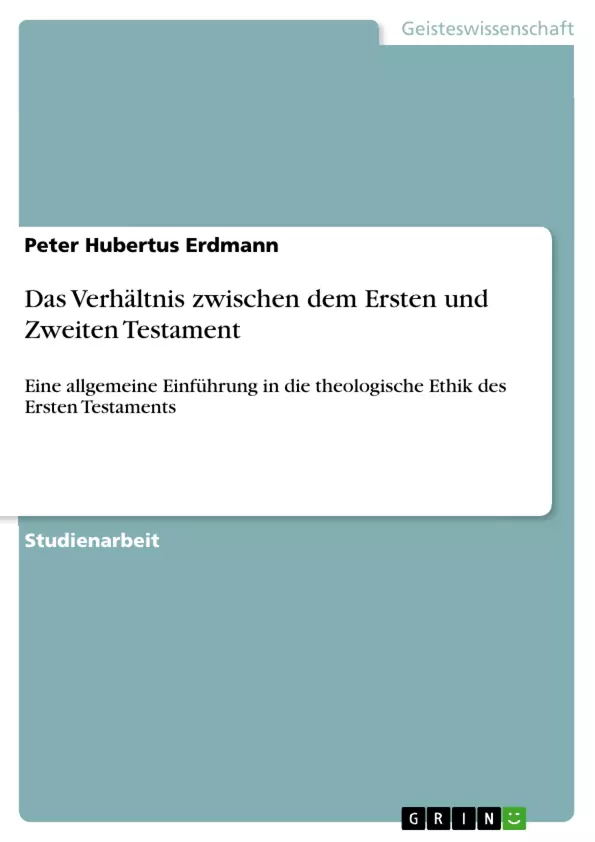Hinter der Formulierung „Theologische Ethik im Ersten Testament“ verbirgt sich die Frage nach einer möglichen Unterscheidung zwischen dem alttestamentlichen und dem neutestamentlichen Gott anhand einer Betrachtung von dessen ethischen Handeln in beiden Testamenten. Beim Überfliegen der beiden Testamente mag mancher Leser den Eindruck eines Gegensatzpaares entwickeln: auf der einen Seite glaubt er beim Ersten Testament (ET) einem gesetzesbewussten, strengen, komplizierten Gott zu begegnen, der den Sünder blutigst niederschlägt. Auf der anderen Seite des Zweiten Testaments (ZT) dagegen sieht der Leser einen Protagonisten für das Herzliche und einen Überwinder von rechtlichen Spitzfindigkeiten, der als liebender Vater dem Sünder mit offenen Armen entgegenläuft. Dadurch kann sich sicherlich die Frage aufdrängen, ob beim Wechsel vom Ersten Testament zum Zweiten Testament nicht verschiedenartige moralische und ethische Auffassungen Gottes aufgezeigt werden. Dies hieße damit nichts anderes, als dass Jesus eine neue Gottesethik gepredigt habe.
Völlig außer acht gelassen wird jedoch bei vielen Menschen, dass manche neutestamentliche Passage ebenfalls einen recht blutrünstigen Charakter innehat. Außerdem wird der Umstand übergangen, dass das ET ebenfalls einen gnädigen, barmherzigen Gott präsentiert.
Der Versuch der vorliegenden Hausarbeit soll deshalb darin bestehen, anhand der Exegese einiger ausgewählter alttestamentlicher Passagen (die Zehn Gebote, das Talionsgesetz, die Rachepsalmen) die positiven Charakterzüge Jahwes zu beleuchten. Wenn wir das so nicht wahrnehmen, dann liegt dies m. E. in unserem selektiven oder fehlenden Wissen um Bibel und jüdische Kultur.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Beispiele für missverstandene Perikopen
- Die Zehn Gebote
- Das Talionsgesetz
- Die Fluch- und Rachepsalmen
- Die Pluralität der Bibel
- Die Ethik Gottes im Neuen Testament
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung Gottes im Alten Testament (AT) und vergleicht sie mit der Darstellung im Neuen Testament (NT). Ziel ist es, die oft vertretene Sichtweise zu widerlegen, dass der Gott des AT ein strenger, rachsüchtiger Gott sei, im Gegensatz zu dem liebenden Vater des NT. Die Arbeit analysiert ausgewählte alttestamentliche Passagen, um die positiven Charakterzüge Jahwes hervorzuheben und die Ambivalenz der Gottesdarstellungen in beiden Testamenten aufzuzeigen.
- Die unterschiedlichen Interpretationen des Alten und Neuen Testaments bezüglich der Gottesethik
- Analyse ausgewählter alttestamentlicher Passagen (z.B. die Zehn Gebote)
- Die heilsgeschichtliche Perspektive des Dekalogs
- Die Ambivalenz der Gottesdarstellung im AT und NT
- Widerlegung einseitiger Interpretationen der Bibel
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Die Arbeit hinterfragt die gängige Vorstellung eines gegensätzlichen Gottesbildes im Alten und Neuen Testament. Sie kritisiert die einseitige Interpretation, die den Gott des AT als streng und rachsüchtig und den Gott des NT als liebend und gnädig darstellt. Die These der Arbeit ist, dass diese Sichtweise die Ambivalenz der Gottesdarstellungen in beiden Testamenten übersieht und auf selektivem Wissen um Bibel und jüdische Kultur basiert. Die Arbeit will durch Exegese ausgewählter alttestamentlicher Passagen die positiven Charakterzüge Jahwes beleuchten.
Beispiele für missverstandene Perikopen: Dieses Kapitel illustriert die unterschiedlichen Wahrnehmungen biblischer Texte anhand der Zehn Gebote. Die christliche Tradition interpretiert sie oft negativ als eine unflexible Liste von Verboten. Die Arbeit argumentiert dagegen, dass die Zehn Gebote im Kontext der Befreiungsgeschichte Israels aus der ägyptischen Sklaverei verstanden werden müssen. Jahwe präsentiert sich als Befreier, und die Gebote sind Ausdruck seiner Fürsorge und des Bundes mit seinem Volk. Die einseitige negative Interpretation übersieht den heilsgeschichtlichen Kontext und die positive Botschaft der Gebote.
Schlüsselwörter
Altes Testament, Neues Testament, Gottesethik, Jahwe, Zehn Gebote, Dekalog, Heilsgeschichte, Exegese, Bibelinterpretation, Ambivalenz, einseitige Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Darstellung Gottes im Alten und Neuen Testament"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung Gottes im Alten Testament (AT) und vergleicht sie mit der Darstellung im Neuen Testament (NT). Sie widerlegt die gängige Sichtweise, dass der Gott des AT streng und rachsüchtig, im Gegensatz zum liebenden Vater des NT sei. Stattdessen wird die Ambivalenz der Gottesdarstellungen in beiden Testamenten aufgezeigt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Analyse ausgewählter alttestamentlicher Passagen, um die positiven Charakterzüge Jahwes hervorzuheben und die oft einseitigen Interpretationen der Bibel zu widerlegen. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen des AT und NT bezüglich der Gottesethik und die heilsgeschichtliche Perspektive, besonders am Beispiel des Dekalogs.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Problemstellung, die gängige Vorstellung eines gegensätzlichen Gottesbildes im AT und NT hinterfragt. Es folgen Beispiele für missverstandene Perikopen (z.B. die Zehn Gebote, das Talionsgesetz, die Fluch- und Rachepsalmen), ein Kapitel zur Pluralität der Bibel, die Ethik Gottes im Neuen Testament und schließlich eine Zusammenfassung.
Wie werden die Zehn Gebote interpretiert?
Die Arbeit argumentiert, dass die Zehn Gebote im Kontext der Befreiungsgeschichte Israels verstanden werden müssen. Jahwe präsentiert sich als Befreier, und die Gebote sind Ausdruck seiner Fürsorge und des Bundes mit seinem Volk. Die einseitige negative Interpretation als unflexible Verbotsliste wird kritisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Altes Testament, Neues Testament, Gottesethik, Jahwe, Zehn Gebote, Dekalog, Heilsgeschichte, Exegese, Bibelinterpretation, Ambivalenz, einseitige Interpretation.
Welche These vertritt die Arbeit?
Die Arbeit vertritt die These, dass die gängige Sichtweise eines gegensätzlichen Gottesbildes im AT und NT die Ambivalenz der Gottesdarstellungen übersieht und auf selektivem Wissen um Bibel und jüdische Kultur basiert.
Welche Beispiele für missverstandene Bibelstellen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Zehn Gebote, das Talionsgesetz und die Fluch- und Rachepsalmen, um die unterschiedlichen Wahrnehmungen biblischer Texte zu illustrieren.
Wie wird die Ambivalenz der Gottesdarstellung behandelt?
Die Arbeit hebt die Ambivalenz der Gottesdarstellung in beiden Testamenten hervor und kritisiert einseitige Interpretationen, die diese Ambivalenz übersehen. Sie betont die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der biblischen Texte im Kontext ihrer Entstehungszeit.
- Citar trabajo
- Dipl. theol. Peter Hubertus Erdmann (Autor), 2005, Das Verhältnis zwischen dem Ersten und Zweiten Testament, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153534