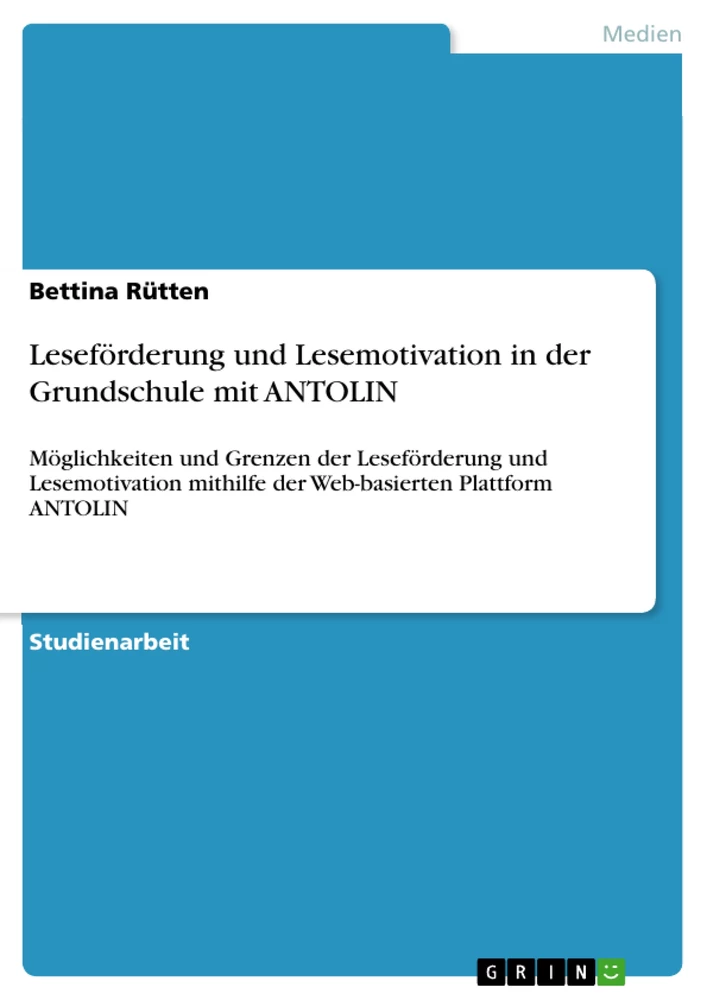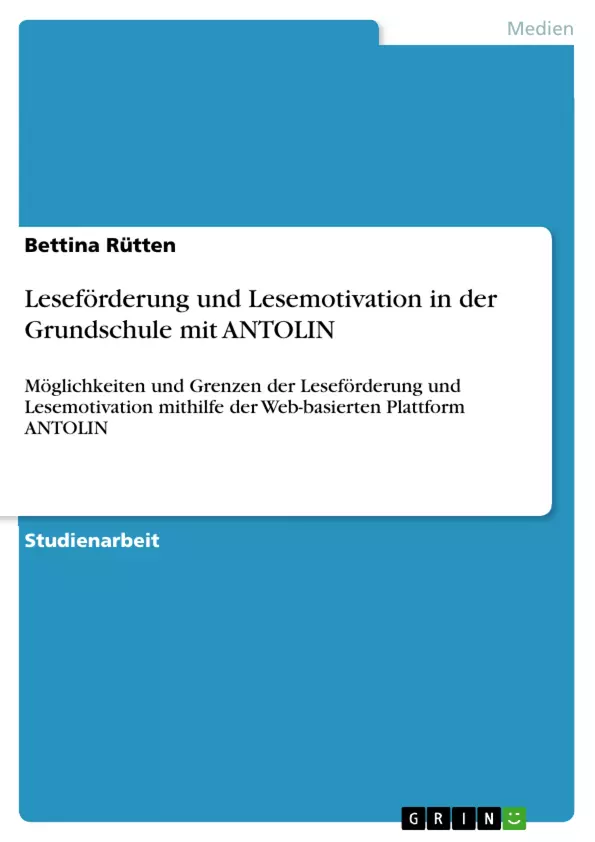Die vorliegende Arbeit ist mit dem Ziel erstellt worden, Möglichkeiten und Grenzen der Leseförderung und Lesemotivation in der Grundschule mithilfe der Web-basierten Plattform ANTOLIN darzustellen.
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 beschreibt, weshalb Lesekompetenz eine Erfolgsbedingung in der Mediengesellschaft ist und stellt die Definition von Lesekompetenz nach der Vergleichsuntersuchung IGLU vor. In Kapitel 3 wird Grundsätzliches zu Motivation und Lesemotivation dargestellt. Kapitel 4 beschäftigt sich mit Leseförderung / Lese¬didaktik auf dem ,althergebrachten Weg‘; beispielhaft werden hierfür das Lautlese-Verfahren, das Viellese-Verfahren und die Leseanimation vorgestellt. In Kapitel 5 wird das Web-basierte Programm ANTOLIN vorgestellt und auf Lesemotivation und -förderung mit¬hilfe diesem eingegangen. Das sich anschließende Kapitel 6 geht der Frage nach, ob es bei der ANTOLIN-¬Nutzung nur Gewinner oder auch Verlierer gibt. Kapitel 7 legt Kritik an ANTOLIN dar. Im letzten Kapitel ziehe ich auf Grundlage der dargestellten Untersuchung abschließende Schlussfolgerungen. Dabei beziehe ich mich in Kapiteln 6 bis 8 auf Daten, die ich mit Hilfe einer qualitativen Erhebung in einer Grundschule gewonnen habe.
Der besseren Lesbarkeit halber wird im vorliegenden Text immer nur die weibliche oder männliche Form eines Wortes auftauchen; auch wenn in dem verwendeten Kontext ebenso oder zusätzlich die männliche / weibliche Form hätte verwendet werden können. Eine wie auch immer geartete Diskriminierung ist damit nicht beabsichtigt. Die erhobenen Daten wurden anonymisiert und wurden nur für diese Hausarbeit verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lesekompetenz
- Lesekompetenz als Erfolgsbedingung in der Mediengesellschaft
- Lesekompetenz nach Definition der Vergleichsuntersuchung IGLU
- Lesemotivation
- Motivation
- Lesemotivation
- Leseförderung / Lesedidaktik
- Lautlese-Verfahren
- Viellese-Verfahren
- Leseanimation
- Antolin – Eine Web-basierte Plattform zur Leseförderung
- Was ist Antolin?
- Wie motiviert Antolin direkt?
- Wie motiviert Antolin indirekt?
- Gewinner und Verlierer von Antolin
- Förderung und Motivation von Kindern mit Migrationshintergrund durch Antolin
- Förderung und Motivation von guten Lesern durch Antolin
- Förderung und Motivation von schwachen Lesern durch Antolin
- Kritik an Antolin
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Möglichkeiten und Grenzen der Leseförderung und -motivation in der Grundschule mithilfe der webbasierten Plattform Antolin. Sie analysiert den Einfluss von Antolin auf verschiedene Schülergruppen und beleuchtet kritische Aspekte des Programms.
- Die Bedeutung von Lesekompetenz in der Mediengesellschaft
- Der Einfluss von Antolin auf die Lesemotivation
- Die Wirksamkeit von Antolin bei verschiedenen Leseleistungsstufen
- Die Rolle des Lehrers bei der erfolgreichen Implementierung von Antolin
- Kritische Betrachtung der Anwendung und des Potentials von Antolin
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht Möglichkeiten und Grenzen der Leseförderung und -motivation in der Grundschule mittels der Web-Plattform Antolin. Sie gliedert sich in Kapitel, die Lesekompetenz, Lesemotivation, traditionelle Lesefördermethoden, Antolin selbst, dessen Auswirkungen auf verschiedene Schülergruppen, Kritikpunkte und ein abschließendes Fazit behandeln. Die Studie basiert auf qualitativen Interviews mit Grundschullehrkräften.
Lesekompetenz: Dieses Kapitel betont die essentielle Bedeutung von Lesekompetenz für den Erfolg in der heutigen Mediengesellschaft. Es definiert Lesekompetenz anhand der Ergebnisse der IGLU-Studie, die das Textverständnis, die Leseintention, die Lesemotivation, das Leseselbstkonzept und das Leseverhalten umfasst, und unterscheidet vier Verstehensaspekte: explizites Wiedergeben von Informationen, Ziehen einfacher und komplexerer Schlussfolgerungen und die Bewertung von Inhalt und Sprache.
Lesemotivation: Das Kapitel beleuchtet den Begriff der Motivation im Allgemeinen und der Lesemotivation im Besonderen. Es unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation und hebt die Bedeutung der Lesebereitschaft und Lesefreude für die Entwicklung einer intrinsischen Lesemotivation hervor. Die Berücksichtigung individueller Leseinteressen und die Gestaltung von freien Lesezeiten in der Schule werden als wichtige Fördermaßnahmen genannt.
Leseförderung / Lesedidaktik: Dieses Kapitel beschreibt traditionelle Leseförderungsmethoden wie Lautlese-Verfahren (wiederholtes und begleitendes Lautlesen), Viellese-Verfahren (freie Lesezeiten) und Leseanimation (inszenierte Leseerlebnisse). Dabei wird das Mehrebenen-Modell des Lesens (Prozessebene, Subjektebene, soziale Ebene) herangezogen, um die jeweiligen Wirkungsweisen zu verdeutlichen.
Antolin – Eine Web-basierte Plattform zur Leseförderung: Das Kapitel beschreibt die webbasierte Plattform Antolin als ein Programm zur integrativen Leseförderung. Es erläutert die Funktionsweise von Antolin, die Kosten für Lizenzen und die Möglichkeiten der Lehrer, die Leseleistung der Schüler zu analysieren. Antolin wird als Kombination aus traditionellen Medien (Bücher) und neuen Medien (Computer und Internet) dargestellt, mit dem Ziel, das sinnentnehmende Lesen zu fördern und die Lesemotivation durch Punktevergabe und die Möglichkeit der eigenständigen Buchwahl zu steigern.
Gewinner und Verlierer von Antolin: Dieses Kapitel präsentiert Ergebnisse einer qualitativen Studie, die die Erfahrungen von Grundschullehrern mit Antolin untersucht. Es analysiert den Einfluss von Antolin auf Schüler mit Migrationshintergrund, gute Leser und schwache Leser. Während mittlere Leser von Antolin profitieren, wird für schwache Leser eine intensive Lehrerunterstützung als notwendig erachtet, um Frustrationen zu vermeiden. Gute Leser profitieren weniger, da ihre Lesemotivation bereits hoch ist.
Kritik an Antolin: Das Kapitel fasst die Kritik der befragten Lehrer an Antolin zusammen. Antolin wird nicht als Allheilmittel gesehen und es wird betont, dass individuelle Leseförderung weiterhin unerlässlich ist. Kritisiert wird die fehlende Variabilität des Fragenniveaus zu den Büchern und die Annahme, Antolin könne guten Leseunterricht ersetzen.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, Lesemotivation, Leseförderung, Antolin, Grundschule, Mediengesellschaft, IGLU-Studie, qualitative Forschung, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Lesedidaktik, Medienkompetenz, Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Leseförderungsplattform Antolin
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Leseförderung und -motivation in der Grundschule mithilfe der webbasierten Plattform Antolin. Sie analysiert den Einfluss von Antolin auf verschiedene Schülergruppen (gute, mittlere und schwache Leser, Schüler mit Migrationshintergrund) und beleuchtet kritische Aspekte des Programms. Die Studie basiert auf qualitativen Interviews mit Grundschullehrkräften.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung von Lesekompetenz in der Mediengesellschaft, den Einfluss von Antolin auf die Lesemotivation, die Wirksamkeit von Antolin bei verschiedenen Leseleistungsstufen, die Rolle des Lehrers bei der erfolgreichen Implementierung von Antolin und eine kritische Betrachtung der Anwendung und des Potentials von Antolin. Zusätzlich werden traditionelle Lesefördermethoden (Lautlese-, Viellese-Verfahren und Leseanimation) erläutert und der Begriff der Lesemotivation im Detail beleuchtet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Lesekompetenz (inkl. Definition nach IGLU), Lesemotivation (intrinsisch vs. extrinsisch), traditionellen Lesefördermethoden, einer detaillierten Beschreibung der Plattform Antolin (Funktionsweise, Motivationselemente), den Auswirkungen von Antolin auf verschiedene Schülergruppen, Kritikpunkten an Antolin und einem abschließenden Fazit.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse von Antolin?
Die Studie zeigt, dass Antolin für Schüler mit mittleren Leseleistungen förderlich sein kann. Für schwache Leser wird jedoch intensive Lehrerunterstützung empfohlen, um Frustrationen zu vermeiden. Gute Leser profitieren weniger von Antolin, da ihre Lesemotivation bereits hoch ist. Kritisiert wird die fehlende Variabilität des Fragenniveaus und die Annahme, Antolin könne guten Leseunterricht ersetzen. Antolin wird nicht als Allheilmittel gesehen, sondern als ergänzende Maßnahme zur individuellen Leseförderung.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf qualitativen Interviews mit Grundschullehrkräften, die Erfahrungen mit der Anwendung von Antolin in der Praxis gemacht haben. Die Ergebnisse dieser Interviews werden analysiert und interpretiert, um die Wirksamkeit und die Grenzen von Antolin zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lesekompetenz, Lesemotivation, Leseförderung, Antolin, Grundschule, Mediengesellschaft, IGLU-Studie, qualitative Forschung, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Lesedidaktik, Medienkompetenz, Migrationshintergrund.
Welche Definition von Lesekompetenz wird verwendet?
Die Arbeit verwendet die Definition von Lesekompetenz, wie sie in der IGLU-Studie verwendet wird. Diese umfasst Textverständnis, Leseintention, Lesemotivation, Leseselbstkonzept und Leseverhalten und unterscheidet vier Verstehensaspekte: explizites Wiedergeben von Informationen, Ziehen einfacher und komplexerer Schlussfolgerungen und die Bewertung von Inhalt und Sprache.
Wie wird Lesemotivation in der Arbeit definiert und betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Sie betont die Bedeutung von Lesebereitschaft und Lesefreude für die Entwicklung einer intrinsischen Lesemotivation und hebt die Berücksichtigung individueller Leseinteressen und die Gestaltung von freien Lesezeiten in der Schule als wichtige Fördermaßnahmen hervor.
- Citar trabajo
- Bettina Rütten (Autor), 2010, Leseförderung und Lesemotivation in der Grundschule mit ANTOLIN, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153542