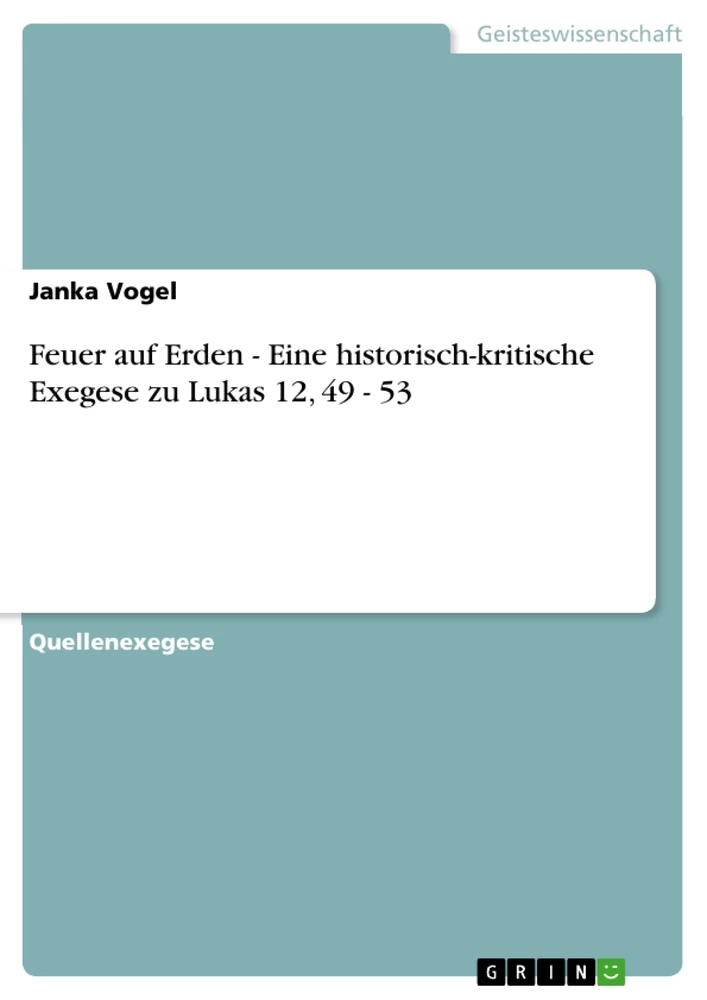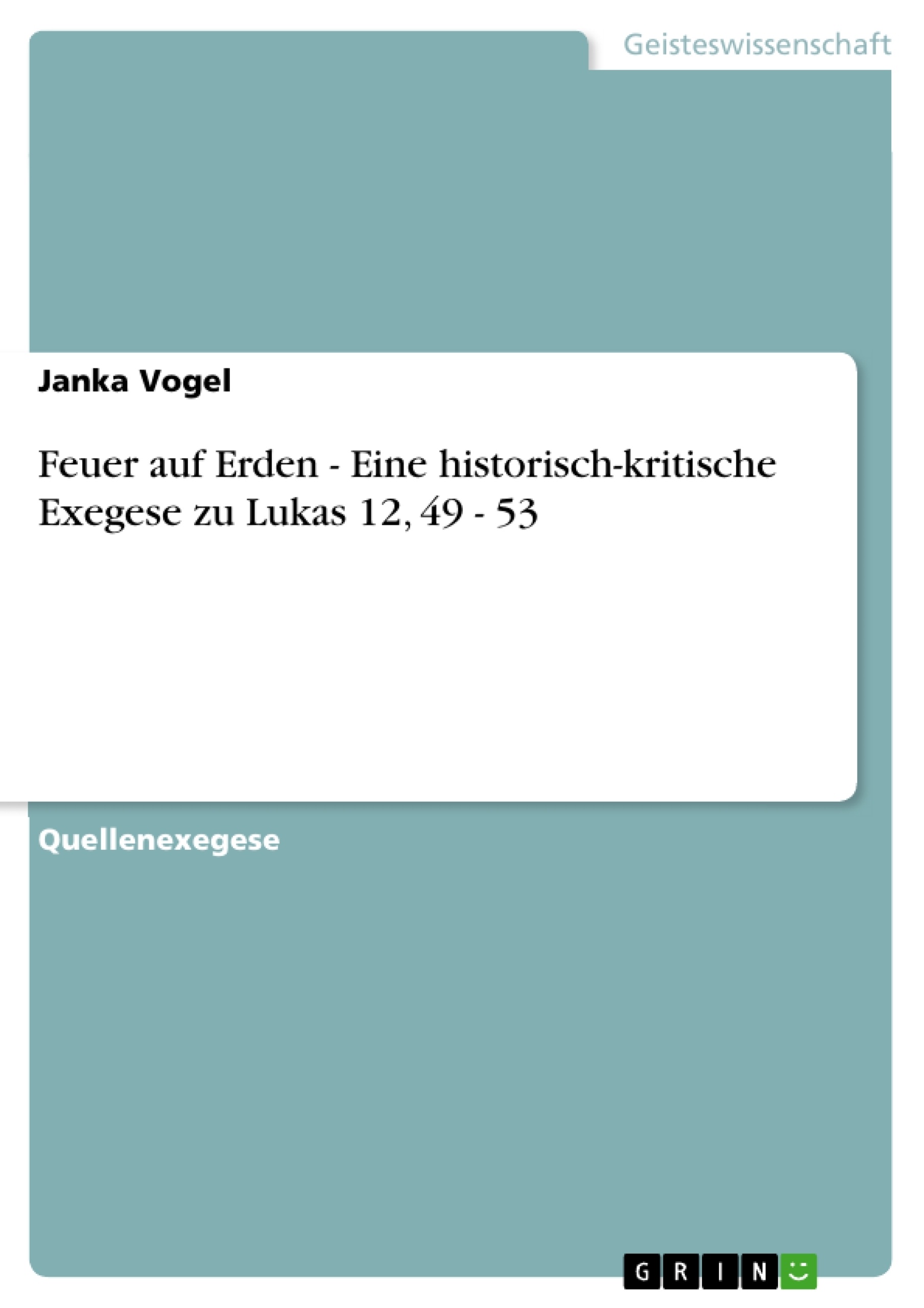Entgegen den prophetischen Weissagungen eines kommenden Friedefürsten deutet Jesus seinen Auftrag im vorliegenden Ausschnitt aus dem EvLuk als einen nahezu kriegerischen. Welche Verbindungslinien in atl. Traditionen lassen sich finden und mit welchen Motiven arbeitet der Autor dieses Abschnittes?
Seine bevorstehende Taufe empfindet Jesus nach dem Zeugnis des Lukas als Last; ihm sei bange lesen wir. Ein sich fürchtender Jesus - kann dieser Text vielleicht Anlass bieten, unser Jesus-Bild zu korrigieren, bzw. zu schärfen?
Die metaphorische Vorwegnahme der Passion deutet die Reichweite des Passionsgeschehens nicht nur im Nachhinein der Kreuzigung, sondern schon im Vorhinein an und ist auch Anlass für die Frage, wie der historische Jesus seinen Tod selbst sah.
Die Exegese wirft Schlaglichter auf den möglichen historischen Hintergrund des Textes, erörtert einzelne Verse und Metaphern und schließt mit einem homiletischen Impuls.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbesinnung...
- Sprachliche Analyse des Textes........
- Jesu Selbst in Abgrenzung zum „Ihr”
- Bildreden.....
- Zeitebenen........
- Übersetzungsvergleich...
- Gewählte Übersetzungen.....
- Parallelität von V 49 und V 50
- Übereinstimmungen.
- Differenzen bei einzelnen Begriffen...........
- Abgrenzung des Textes und Kontext...
- Gliederung des Textes
- Jesu Rede über sich selbst
- Feuer
- Taufe..
- Jesu Rede zu den Zuhörern……….....
- Rhetorische Frage nach der Meinung der Zuhörer…..\li>
- Jesu Antwort zu den Folgen seines Kommens/ Auftrages.
- Beschreibung der gegenwärtigen/ zukünftigen Zwietracht....
- Erläuertung des Beispiels der Entzweiungen
- Literarkritik und synoptischer Vergleich...
- Formkritik.
- Mündliche Überlieferungsgeschichte..
- Redaktionsgeschichte.
- Traditionsgeschichte...
- Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Einzelexegese...........
- Skopus.........
- Verkündigungsansatz für heute........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit „Feuer auf Erden“ befasst sich mit einer historisch-kritischen Exegese des Textes Lukas 12, 49 – 53. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Aussage des Textes im Kontext des Lukas-Evangeliums und der damaligen Zeit zu beleuchten. Dabei werden verschiedene Aspekte des Textes, wie Sprachliche Analyse, Übersetzungsvergleiche, sowie die literarische und traditionsgeschichtliche Einordnung, untersucht.
- Jesu Selbstverständnis und seine Botschaft im Kontext des Friedens- und Zwietrachtsdiskurses.
- Sprachliche Bilder und Metaphern in Lukas 12, 49 – 53.
- Zeitebenen und deren Bedeutung für die Interpretation des Textes.
- Die Rolle von Zahlen und Symbolen in der Bibel und ihre Bedeutung für das Verständnis des Textes.
- Religionsgeschichtliche Vergleiche und die Einordnung des Textes in den historischen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Vorbesinnung, in der die Autorin ihre persönlichen Eindrücke und Fragen zum Text darlegt. Es folgt eine sprachliche Analyse des Textes, in der verschiedene Aspekte wie die Verwendung von Pronomen, Bildreden und Zeitformen beleuchtet werden. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Übersetzungen des Textes und die Unterschiede in der Verwendung von Begriffen. Danach wird die Abgrenzung des Textes vom Kontext betrachtet und die Gliederung des Textes in verschiedene Abschnitte erläutert. Die Kapitel über Literarkritik und Formkritik bieten eine Einordnung des Textes in die literarische und sprachliche Tradition. Die Arbeit geht auf die mündliche Überlieferungsgeschichte, die Redaktionsgeschichte und die Traditionsgeschichte des Textes ein. Abschließend werden religionsgeschichtliche Vergleiche angestellt und eine Einzelexegese des Textes vorgenommen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Textes Lukas 12, 49 – 53. Dazu gehören Jesus Christus, seine Botschaft, Frieden und Zwietracht, sprachliche Bilder, Metaphern, Zeitebenen, Übersetzungsvergleiche, Literarkritik, Formkritik, Mündliche Überlieferungsgeschichte, Redaktionsgeschichte, Traditionsgeschichte und Religionsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Inhalt der Exegese zu Lukas 12, 49-53?
Die Arbeit untersucht Jesu Worte über das „Feuer“, das er auf die Erde werfen will, und die daraus resultierende Entzweiung statt Frieden.
Wie wird das Motiv des „Feuers“ in diesem Text gedeutet?
Das Feuer wird im Kontext von Jesu Auftrag und der damit verbundenen Dynamik seiner Botschaft analysiert, oft in Verbindung mit Gericht oder Reinigung.
Was bedeutet die „Taufe“, von der Jesus in Vers 50 spricht?
Die Taufe wird als metaphorische Vorwegnahme seiner Passion und seines bevorstehenden Todes gedeutet, die er als schwere Last empfindet.
Warum spricht Jesus in diesem Abschnitt von Entzweiung statt Frieden?
Der Text zeigt, dass die Entscheidung für Jesu Botschaft zu Konflikten führen kann, sogar innerhalb engster Familienstrukturen, was im Gegensatz zu prophetischen Friedenserwartungen steht.
Welche Methoden der Bibelauslegung werden angewendet?
Es kommen historisch-kritische Methoden wie Literarkritik, Formkritik, Redaktionsgeschichte und Traditionsgeschichte zum Einsatz.
- Quote paper
- Janka Vogel (Author), 2010, Feuer auf Erden - Eine historisch-kritische Exegese zu Lukas 12, 49 - 53, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153562