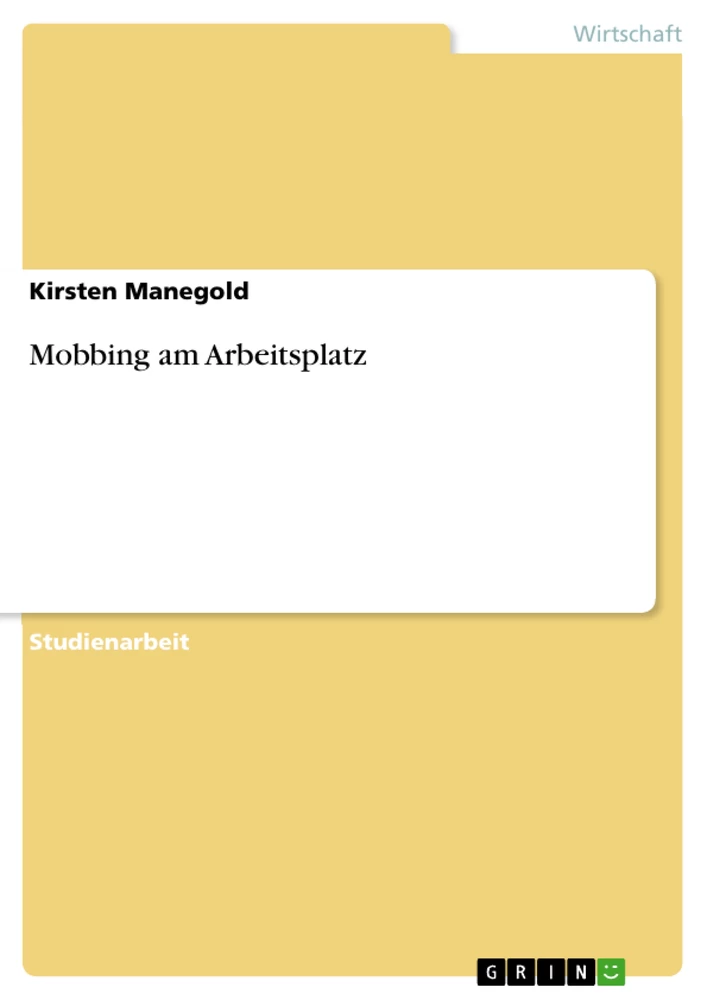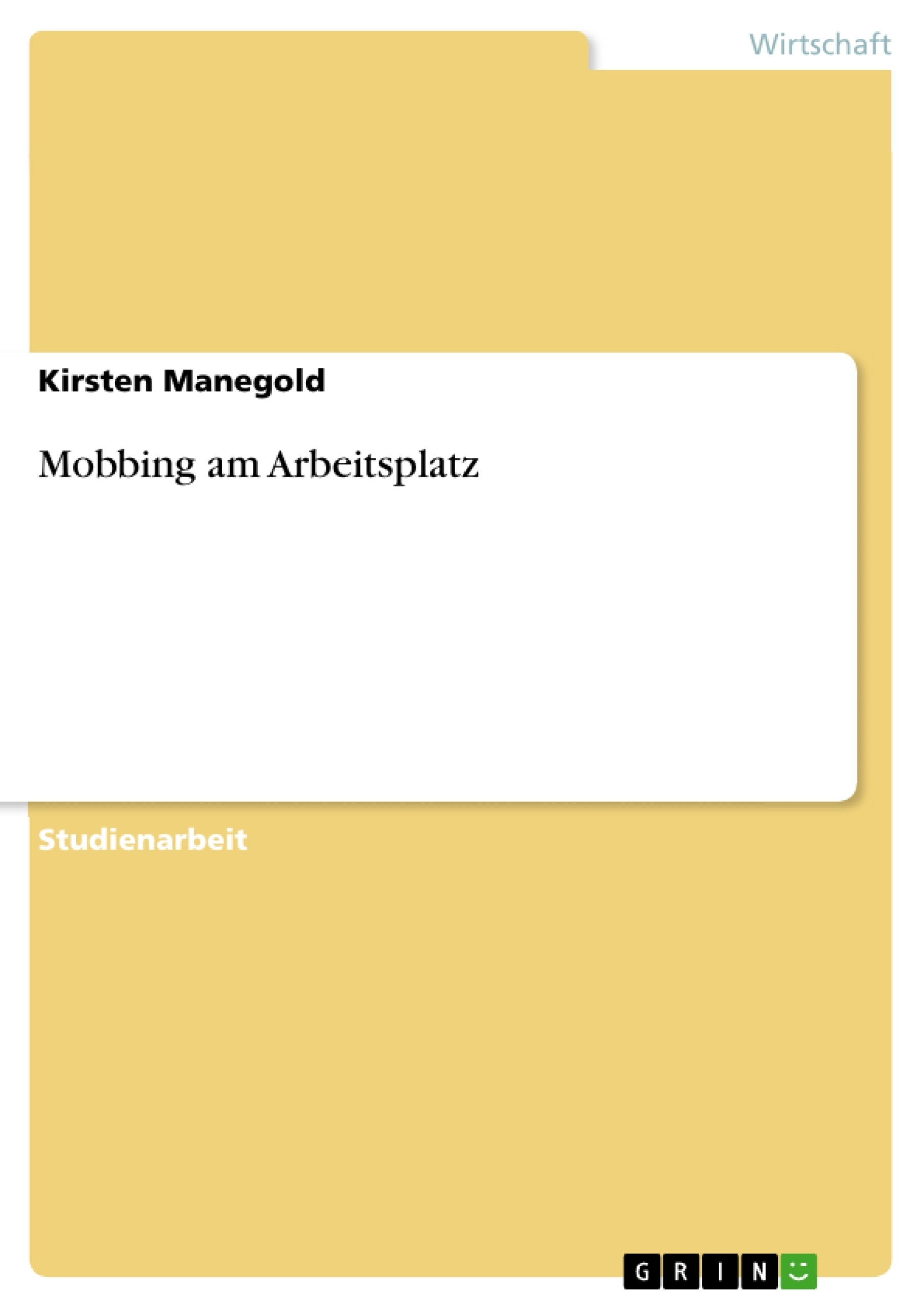Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich ausschließlich und tiefgehend mit dem Thema „Mobbing“, welches für die arbeitende Person im Betrieb eine sehr große Belastung darstellt und somit als ein „extremer sozialer Stressor am Arbeitsplatz“ gesehen werden kann. Zunächst werde ich der Frage nachgehen „Was ist Mobbing?“, um eine Begriffabgrenzung zu alltäglichen Konflikten vorzunehmen und eine eindeutige Definition von Mobbing zu erhalten. Weiterhin werde ich die typischen Handlungs- und Erscheinungsformen hervorheben. Diese Liste der „45 Handlungen – was die Mobber tun“, die auf Heinz Leymann, den Begründer der modernen Mobbingforschung, zurückgeht, kann auch als Test dienen, um zu prüfen, ob Mobbing vorliegt. Anschließend werde ich einen typischen Mobbingablauf beschreiben, da in vielfältigen Untersuchen festgestellt wurde, dass dieser in überwiegenden Fällen immer sehr ähnlich verläuft. Um die Ursachen zu beschreiben, ist es zunächst wichtig, die unterschiedlichen Konstellationen von Mobbin-gopfer und –täter zu erläutern, da somit auch die Ziele der Handlungen deutlich werden. Für den Betroffenen ergeben sich aus den täglichen, systematischen Konflikten am Arbeitsplatz vielfältige gesundheitliche und individuelle Folgen. Es entstehen jedoch auch betriebs- und volkswirtschaftliche Kosten. In diesem Zusammenhang werde ich ebenfalls auf die rechtlichen Folgen eingehen. In einem letzten Schritt werde ich Gegenmaßnahmen aufzeigen, die das Mobbingopfer treffen kann, um sich zu schützen sowie Hilfe in An-spruch zu nehmen und ebenso werde ich Präventionsmaßnahmen beschreiben, die seitens der Unternehmen eingeleitet werden können, um Mobbing gar nicht erst entstehen zu lassen.
Inhalt
1 . Einleitung
2. Was ist Mobbing?
3. Handlungstypen/Erscheinungsformen
4. Typischer Mobbingablauf
5. Ursachen
6. Folgen
6.1. Individuelle und gesundheitliche Folgen
6.2. Betriebs- und volkswirtschaftliche Folgen
6.3. Rechtliche Folgen
7. Gegenmaßnahmen
7.1. Präventionsmaßnahmen durch den Betrieb
Anhang
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Mobbing am Arbeitsplatz definiert?
Mobbing wird als ein extremer sozialer Stressor am Arbeitsplatz verstanden, der durch systematische, länger anhaltende Konflikte gekennzeichnet ist und sich deutlich von alltäglichen Streitigkeiten abgrenzt.
Wer war Heinz Leymann und welche Bedeutung hat er für die Forschung?
Heinz Leymann gilt als Begründer der modernen Mobbingforschung. Er identifizierte 45 spezifische Mobbing-Handlungen, die als Standard zur Identifizierung von Mobbingfällen dienen.
Gibt es einen typischen Ablauf für Mobbingprozesse?
Ja, Untersuchungen zeigen, dass Mobbing in den meisten Fällen einem sehr ähnlichen Phasenmodell folgt, das in der Hausarbeit detailliert beschrieben wird.
Welche Folgen hat Mobbing für die betroffenen Personen?
Mobbing führt zu vielfältigen individuellen und gesundheitlichen Problemen, die von psychischen Belastungen bis hin zu schweren physischen Erkrankungen reichen können.
Welche Kosten entstehen durch Mobbing für die Wirtschaft?
Neben dem persönlichen Leid entstehen erhebliche betriebs- und volkswirtschaftliche Kosten durch Fehlzeiten, sinkende Produktivität und rechtliche Auseinandersetzungen.
Welche Präventionsmaßnahmen können Unternehmen ergreifen?
Unternehmen können durch Aufklärung, klare Richtlinien, Schulungen für Führungskräfte und die Etablierung einer gesunden Unternehmenskultur Mobbing aktiv vorbeugen.
- Arbeit zitieren
- Kirsten Manegold (Autor:in), 2008, Mobbing am Arbeitsplatz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153598