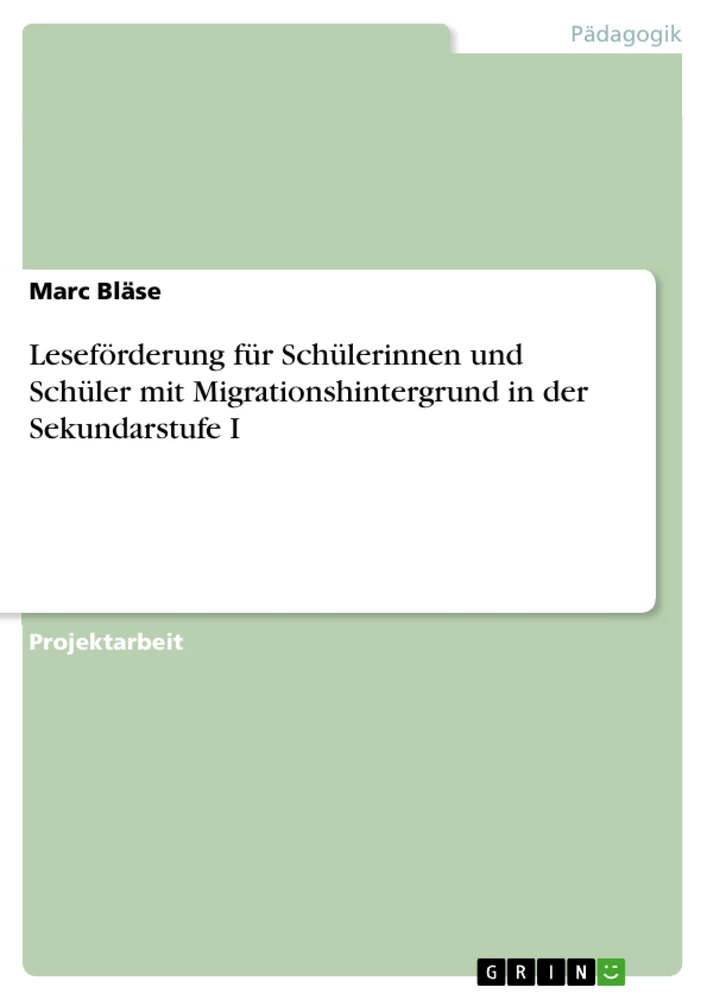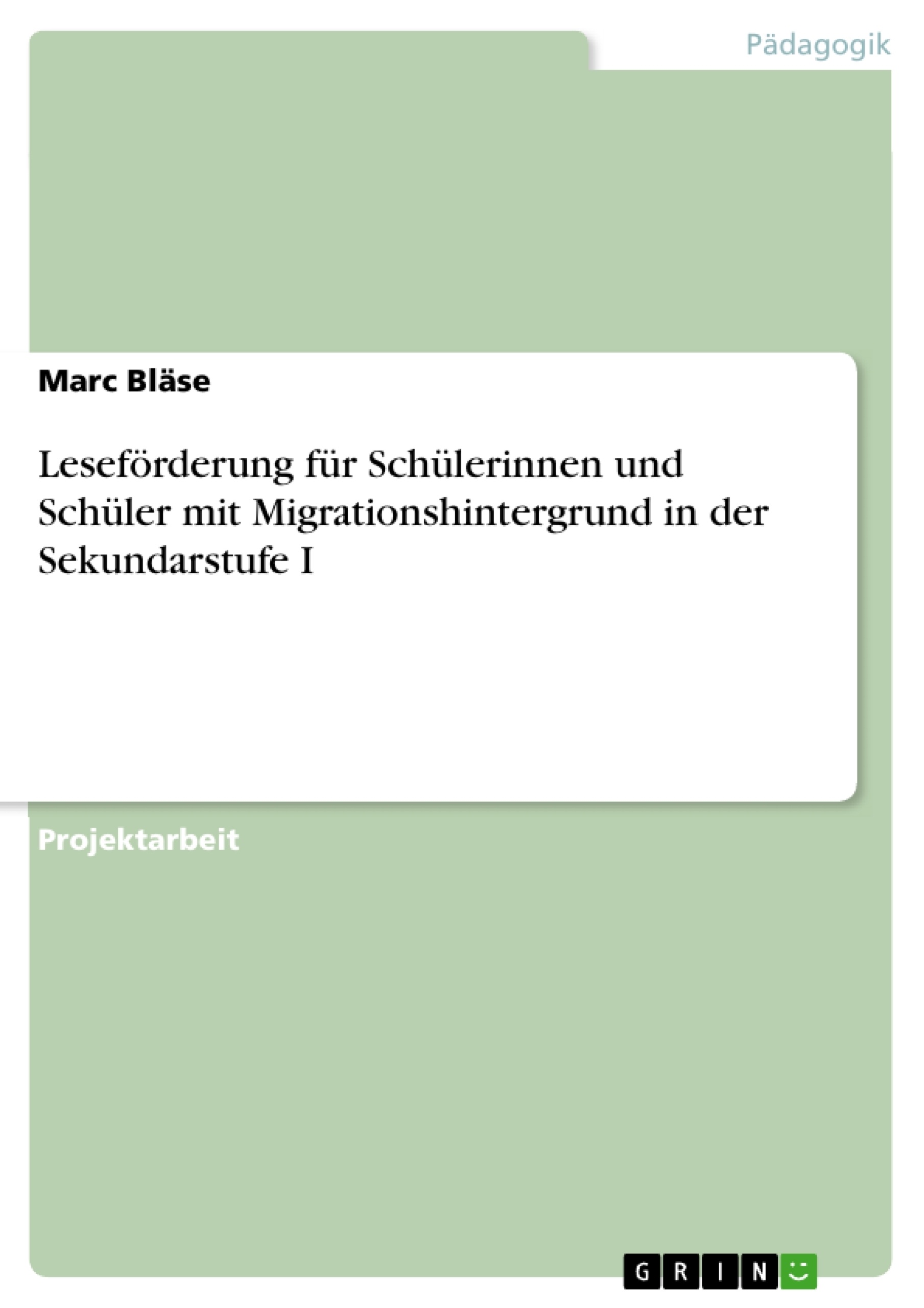Heutzutage sind Schulklassen mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern die nicht auf muttersprachliche Deutschkenntnisse zurückgreifen können keine Seltenheit mehr. „In Deutschland leben fast 1.050.000 Kinder und Jugendliche ohne deutsche Staatsangehörigkeit “, ließ das Statistische Bundesamt im Jahr 2005 verlauten. Eine hohe Anzahl Aussiedler bzw. Migrantenkinder mit deutscher Nationalität sind hierbei noch nicht erfasst. Der Faktor ethnische Herkunft ist von zentraler Bedeutung, im Jahr 2000 kamen 27% der 15-jährigen in der BRD aus Familien mit Migrationshintergrund. Diese Gruppe verfügte über eine signifikant schlechtere Lesekompetenz als ihre Altersgenossen .
Doch was bedeutet dies für die Lehrenden, welche in der Schule ja bemüht sein sollten jedem Kind in seiner Individualität gerecht zu werden? Wie erleben Kinder aus Ländern wie der Türkei, Griechenland, Vietnam, Portugal, Marokko, aus dem Libanon oder aus den ehemaligen GuS-Staaten den Schulunterricht in Deutschland?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung der Fördergruppe
- Förderunterricht in Projektform
- Einordnung der Unterrichtseinheit in den Förderunterricht
- Bezug zum Fächerverbund (Sprache)
- Hinführung zum Begriff Leseförderung
- Leseförderung der Zielgruppe
- Text- und Materialauswahl
- Bedeutung des Förderunterrichts für DaZ-Schüler und mögliche Schwierigkeiten
- Wirkungen der Mehrsprachigkeit
- Didaktische Begründung für das Projekt
- Bezug zum Bildungsplan
- Lernziele
- Bedeutung des Themas Leseförderung für die Zielgruppe
- Methodische Herangehensweise
- Begrüßung / Einstieg
- Erarbeitungsphase I
- Erarbeitungsphase II (Der Textknacker) /Sicherung II
- Abschluss
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Leseförderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in der Sekundarstufe I. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die mit der Förderung des Lesens in einer heterogenen Lerngruppe verbunden sind, und präsentiert ein Projekt zur Leseförderung, das auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Schülergruppe zugeschnitten ist. Die Arbeit integriert dabei verschiedene fachdidaktische Perspektiven aus den Bereichen Deutsch, Wirtschaftslehre und evangelische Theologie.
- Herausforderungen der Leseförderung von Schülern mit Migrationshintergrund
- Didaktische Konzepte für den Leseförderunterricht
- Methoden zur Förderung der Textaneignung
- Bedeutung des Sprachlernens für den Bildungserfolg
- Integration von fachdidaktischen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die „imaginäre“ Fördergruppe vor, die als Grundlage für die didaktische und methodische Konzeption des Projekts dient. Dabei werden die spezifischen Herausforderungen der Leseförderung von Schülern mit Migrationshintergrund in der Sekundarstufe I beleuchtet. Der zweite Abschnitt beleuchtet die Bedeutung der Leseförderung und den Bezug zum Fächerverbund Sprache. Es werden die Herausforderungen für den Förderunterricht, die Text- und Materialauswahl sowie die Wirkungen der Mehrsprachigkeit diskutiert. Im dritten Kapitel wird die didaktische Begründung des Projekts, der Bezug zum Bildungsplan, die Lernziele und die Bedeutung des Themas Leseförderung für die Zielgruppe erörtert. Das vierte Kapitel befasst sich mit der methodischen Herangehensweise und beschreibt die einzelnen Phasen des Projekts, beginnend mit der Begrüßung und dem Einstieg über die Erarbeitungsphasen bis zum Abschluss.
Schlüsselwörter
Leseförderung, Migrationshintergrund, Sekundarstufe I, DaZ, Mehrsprachigkeit, Textaneignung, Förderunterricht, Bildungsplan, didaktische Konzepte, methodische Herangehensweise, Lernziele, fachdidaktische Perspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Leseförderung für Migrantenkinder besonders wichtig?
Studien zeigen, dass Schüler mit Migrationshintergrund oft über eine signifikant schlechtere Lesekompetenz verfügen, was ihren gesamten Bildungserfolg in Deutschland gefährdet.
Was ist das Ziel des vorgestellten Förderprojekts?
Das Projekt soll Schülern in der Sekundarstufe I helfen, Texte besser zu erschließen und ihre Sprachkompetenz (Deutsch als Zweitsprache) durch gezielte Methoden zu verbessern.
Was versteht man unter dem "Textknacker"?
Der "Textknacker" ist eine methodische Herangehensweise zur Sicherung des Textverständnisses, die in der Erarbeitungsphase des Projekts eingesetzt wird.
Welche Rolle spielt die Mehrsprachigkeit im Unterricht?
Die Arbeit diskutiert sowohl die Potenziale als auch die Schwierigkeiten, die durch die Mehrsprachigkeit der Schüler für den regulären Fachunterricht entstehen.
Wie wird das Projekt didaktisch begründet?
Die Begründung stützt sich auf den Bildungsplan und betont die Notwendigkeit individueller Förderung, um der Heterogenität moderner Schulklassen gerecht zu werden.
- Quote paper
- Marc Bläse (Author), 2009, Leseförderung für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153812