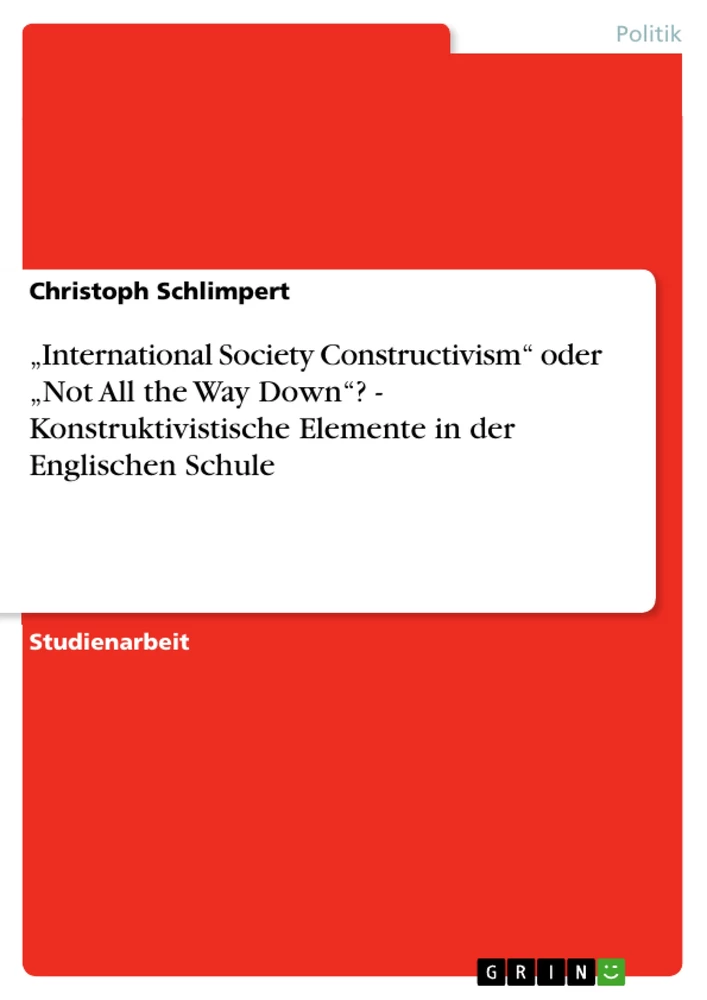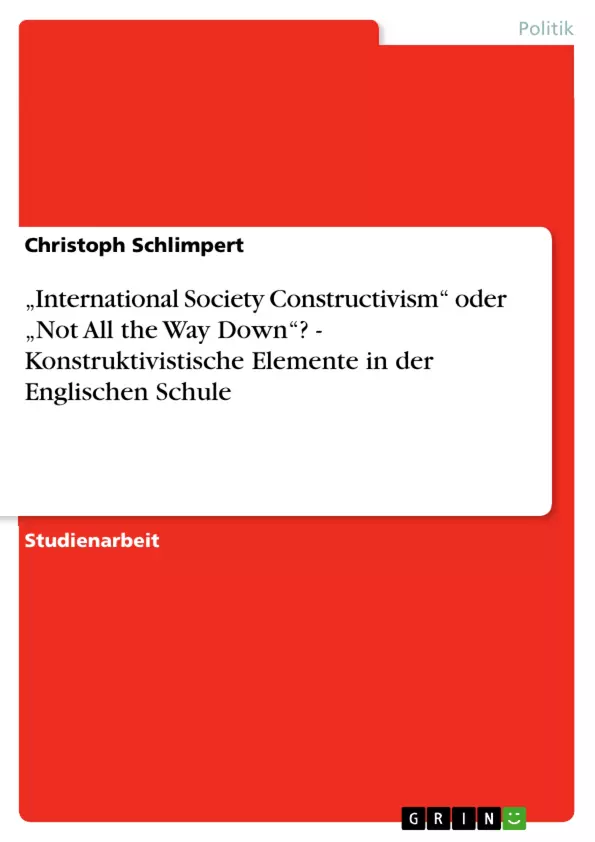Derzeit erlebt die Befassung mit Normen, Ideen und Identitäten in der Disziplin der
Internationalen Beziehungen eine nie dagewesene Aufmerksamkeit. Lange wurde die
Disziplin der Internationalen Beziehungen von rationalistischen Ansätzen dominiert.
Sowohl neorealistische als auch neoliberale und neoinstitutionalistische Theorien erklärten
die sozialen Dimension in der internationalen Politik für irrelevant oder sehen in
zwischenstaatlichen Kooperationen und Vereinbarungen nicht viel mehr als das strategische
Verfolgen eigener vorgegebener Interessen. Spätestens in den 1990er Jahren wurde dieses
rationalistische Paradigma unter großer Aufmerksamkeit von konstruktivistischen Ansätzen
herausgefordert. Aus dieser Perspektive werden die internationalen Beziehungen als etwas
zutiefst soziales betrachtet. Identitäten und Interessen der Akteure werden als etwas gesehen,
was erst diskursiv erzeugt und maßgeblich von intersubjektiven Regeln, Normen und
Institutionen bestimmt wird (Reus-Smit 2002: 488). Dabei wird jedoch oft übersehen, dass
es mit der Englischen Schule bereits früher eine Forschungsrichtung gab, welche sich
durchaus mit der Bedeutung von Normen in den internationalen Beziehungen beschäftigte.
Ihre Vertreter hatten sich nie dem „amerikanischen“ Rationalismus verschreiben und
stattdessen die soziale Dimension der internationalen Beziehungen betont (Reus-Smit 2002:
488). In diesem Sinne kann man auch die Wiederentdeckung der Englischen Schule
interpretieren. Nachdem sie bereits während der 1980er Jahre beinahe in Vergessenheit
geriet, finden sich erst in den 1990er Jahren wieder vermehrt Beiträge, welche sich mit ihr
beschäftigen (Daase 2006: 243).
Nach einem Überblick über die Englische Schule und den Konstruktivismus soll hierzu
versucht werden, den Vergleich anhand von zwei Kategorien zu systematisieren. Zunächst
sollen die epistemologischen und methodologischen Positionen der beiden Ansätze diskutiert
werden. In einem zweiten Schritt wird dann die den Ansätzen zugrunde liegende Ontologie
betrachtet. Dabei soll vor allem deutlich werden, dass die unterschiedliche Urteile über das
Verhältnis zwischen Konstruktivismus und Englischer Schule vor allem darauf zurück zu
führen sind, wie die unterschiedlichen Vorstellungen der Autoren darüber aussehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Überblick Englische Schule
- 2. Überblick Konstruktivismus
- 3. Der Versuch eines Vergleichs
- 3.1 Epistemologie und Methodologie
- 3.1.1 Epistemologie und Methodologie der Englische Schule
- 3.1.2 Epistemologie und Methodologie des Konstruktivismus
- 3.1.3 Vergleich der epistemologischen und methodologischen Aussagen
- 3.2 Ontologische Annahmen der beiden Ansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen der Englischen Schule und dem Konstruktivismus in der Disziplin der Internationalen Beziehungen. Sie befasst sich mit der Frage, ob die Englische Schule als eine frühe Form des Konstruktivismus betrachtet werden kann und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen bestehen.
- Die Bedeutung von Normen und Ideen in der internationalen Politik
- Die Rolle von Identitäten und Interessen der Akteure
- Der Einfluss von intersubjektiven Regeln und Institutionen
- Die epistemologischen und methodologischen Grundlagen beider Ansätze
- Die ontologischen Annahmen der Englischen Schule und des Konstruktivismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die aktuelle Debatte über die Rolle von Normen, Ideen und Identitäten in der Internationalen Beziehungen dar und zeigt die Herausforderungen auf, die sich aus der Dominanz rationalistischer Ansätze ergeben. Sie führt den Leser in die Frage ein, ob die Englische Schule als Vorläufer des Konstruktivismus betrachtet werden kann.
- 1. Überblick Englische Schule: Dieses Kapitel liefert einen kurzen Überblick über die wichtigsten Konzepte und Theorien der Englischen Schule, die sich mit der Bedeutung von Normen und Regeln in der internationalen Politik befassen. Es wird gezeigt, wie die Englische Schule sich von anderen Ansätzen der Internationalen Beziehungen unterscheidet.
- 2. Überblick Konstruktivismus: Dieses Kapitel präsentiert die wichtigsten Grundannahmen und Thesen des Konstruktivismus in der Internationalen Beziehungen. Es wird deutlich, wie der Konstruktivismus die Bedeutung von sozialen Faktoren und intersubjektiven Strukturen betont.
- 3. Der Versuch eines Vergleichs: Dieses Kapitel untersucht die epistemologischen, methodologischen und ontologischen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Englischen Schule und dem Konstruktivismus. Es wird diskutiert, ob die Englische Schule als eine frühe Form des Konstruktivismus betrachtet werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen und Themen: Internationale Beziehungen, Englische Schule, Konstruktivismus, Normen, Ideen, Identitäten, Intersubjektivität, Epistemologie, Methodologie, Ontologie, Internationales System, Gesellschaft der Staaten.
- Quote paper
- Christoph Schlimpert (Author), 2010, „International Society Constructivism“ oder „Not All the Way Down“? - Konstruktivistische Elemente in der Englischen Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154344