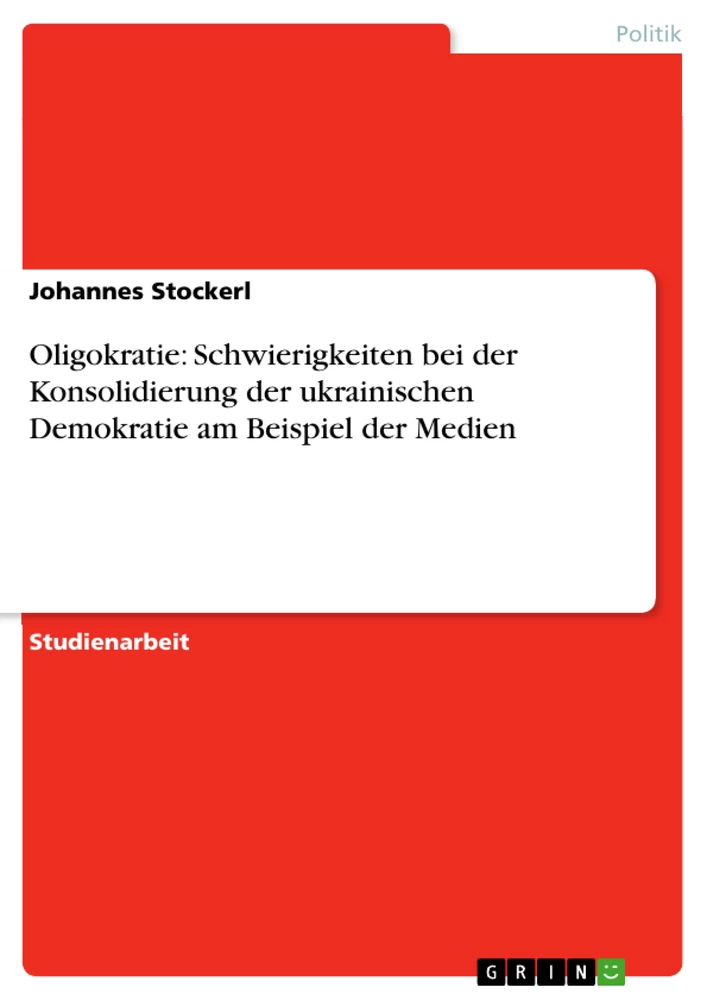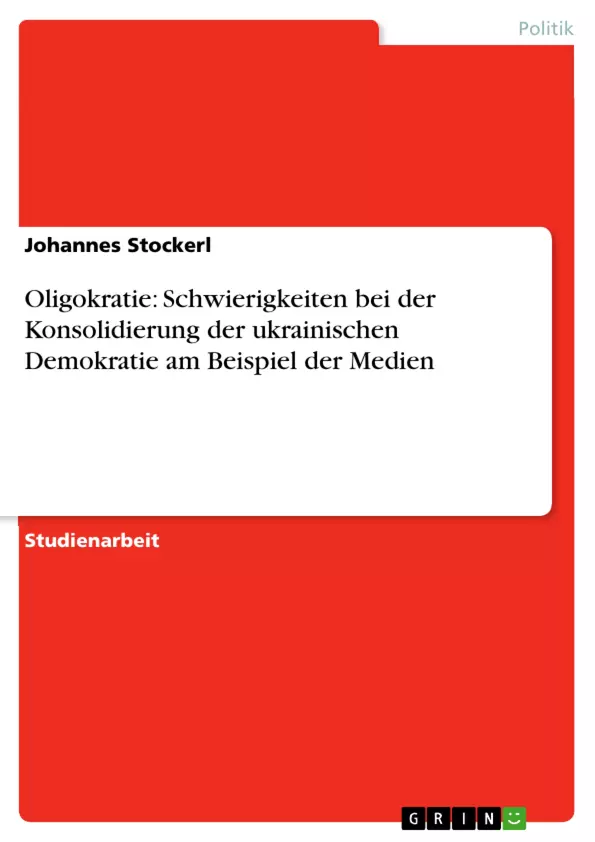Inhaltsverzeichnis:
I. Massenmedien als Indikator demokratischer Konsolidierung
II. Literaturbericht
III. Die Ukraine nach der Orange Revolution – Analyse des Status quo
III.1. Zur Problematik von Länderrankings
III.2. Die ukrainische Demokratie in Zahlen und Trends
III.3. Auswertung der Länderrankings
IV. Massenmedien in der Gesellschaft
IV.1. Verfassungsrechtliche Grundlagen
IV.2.1. Das Gesetz „Über Information“ und seine Folgen
IV.2.2. Die Lizenzierung als Mittel der Zugangsbeschränkung
IV.2.3.Gesetzliche Regelungen zu den Eigentumsverhältnissen bei Medien
IV.2.4. Bestimmungen zur Werbefinanzierung
IV.4. Die Rolle der Oligarchen im ukrainischen Mediensystem
IV.5. Öffentlich-Rechtliches vs. Staatliches Medienkonzept
V. Zum Zustand des ukrainischen Mediensystems
VI. Die Ukraine nach der Orange Revolution – Ausblick in eine ungewisse Zukunft
VII. Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- I. Massenmedien als Indikator demokratischer Konsolidierung
- II. Literaturbericht
- III. Die Ukraine nach der Orangen Revolution - Analyse des Status quo
- III.1. Zur Problematik von Länderrankings
- III.2. Die ukrainische Demokratie in Zahlen und Trends
- III.3. Auswertung der Länderrankings
- IV. Die Massenmedien in der Gesellschaft
- IV.1. Verfassungsrechtliche Grundlagen
- IV.2.1. Das Gesetz „Über Information“ und seine Folgen
- IV.2.2. Die Lizenzierung als Mittel der Zugangsbeschränkung
- IV.2.3. Gesetzliche Regelungen zu den Eigentumsverhältnissen bei Medien
- IV.2.4. Bestimmungen zur Werbefinanzierung
- IV.4. Die Rolle der Oligarchen im ukrainischen Mediensystem
- IV.5. Öffentlich-Rechtliches vs. Staatliches Medienkonzept
- V. Zum Zustand des ukrainischen Mediensystems
- VI. Die Ukraine nach der Orangen Revolution - Ausblick in eine ungewisse Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle der Massenmedien im Prozess der demokratischen Konsolidierung der Ukraine nach der Orangen Revolution. Sie analysiert die Herausforderungen, denen das ukrainische Mediensystem gegenübersteht, und beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Medien, Staat und Zivilgesellschaft.
- Die Bedeutung der Massenmedien als Indikator für demokratische Konsolidierung
- Der Einfluss von Oligarchen auf das ukrainische Mediensystem
- Die Auswirkungen des rechtlichen Rahmens auf die Medienfreiheit
- Die Herausforderungen der staatlichen Medienpolitik
- Die Perspektive der zukünftigen Entwicklung des ukrainischen Mediensystems
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die besondere Rolle der Massenmedien in einer demokratischen Gesellschaft und ihre Funktion als „vierte Gewalt“. Es wird die Bedeutung der Medienfreiheit für den Transformationsprozess in Osteuropa, insbesondere in der Ukraine, betont.
Kapitel III widmet sich der Analyse des Status quo der ukrainischen Demokratie nach der Orangen Revolution. Es werden Länderrankings und wichtige demokratische Indikatoren betrachtet, um die Herausforderungen und Erfolge der ukrainischen Demokratie aufzuzeigen.
Kapitel IV untersucht das ukrainische Mediensystem im Detail. Der Fokus liegt auf der Analyse des rechtlichen Rahmens, den Eigentumsverhältnissen und der Rolle von Oligarchen im Mediensystem.
Schlüsselwörter
Demokratische Konsolidierung, Medienfreiheit, Ukraine, Orangen Revolution, Oligarchen, Medienrecht, Staatliche Medienpolitik, Zivilgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Massenmedien bei der demokratischen Konsolidierung?
Massenmedien fungieren als „vierte Gewalt“ und sind ein wichtiger Indikator für den Fortschritt der Demokratisierung, da sie staatliches Handeln kontrollieren und die Zivilgesellschaft informieren.
Wie beeinflussen Oligarchen das ukrainische Mediensystem?
Oligarchen besitzen oft große Teile der Medienlandschaft und nutzen diese als Instrumente zur Durchsetzung ihrer politischen und wirtschaftlichen Interessen, was die Unabhängigkeit der Berichterstattung gefährdet.
Was war die „Orange Revolution“ und welche Auswirkungen hatte sie auf die Medien?
Die Orange Revolution (2004) war ein Wendepunkt für die ukrainische Demokratie. Die Arbeit untersucht, ob sich die Medienfreiheit in der Folgezeit nachhaltig festigen konnte oder ob alte Strukturen bestehen blieben.
Welche rechtlichen Hürden gibt es für die Medienfreiheit in der Ukraine?
Problematisch sind unter anderem das Gesetz „Über Information“, Lizenzierungsverfahren als Mittel der Zugangsbeschränkung sowie intransparente Regelungen zu den Eigentumsverhältnissen.
Was ist der Unterschied zwischen einem öffentlich-rechtlichen und einem staatlichen Medienkonzept?
Die Arbeit analysiert die Debatte in der Ukraine über die Umwandlung staatlich kontrollierter Sender in unabhängige öffentlich-rechtliche Strukturen nach europäischem Vorbild.
Wie wird die Qualität der ukrainischen Demokratie in der Arbeit bewertet?
Die Bewertung erfolgt durch die Auswertung internationaler Länderrankings und die Analyse spezifischer Trends in der ukrainischen Gesellschaft und Politik.
- Citar trabajo
- Johannes Stockerl (Autor), 2010, Oligokratie: Schwierigkeiten bei der Konsolidierung der ukrainischen Demokratie am Beispiel der Medien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154820