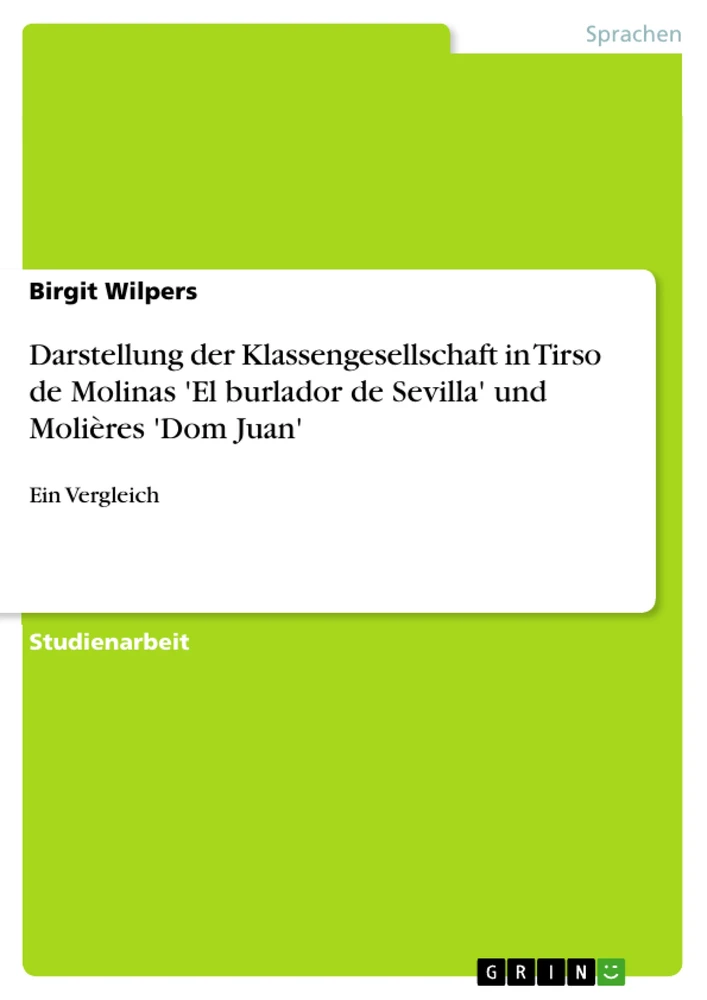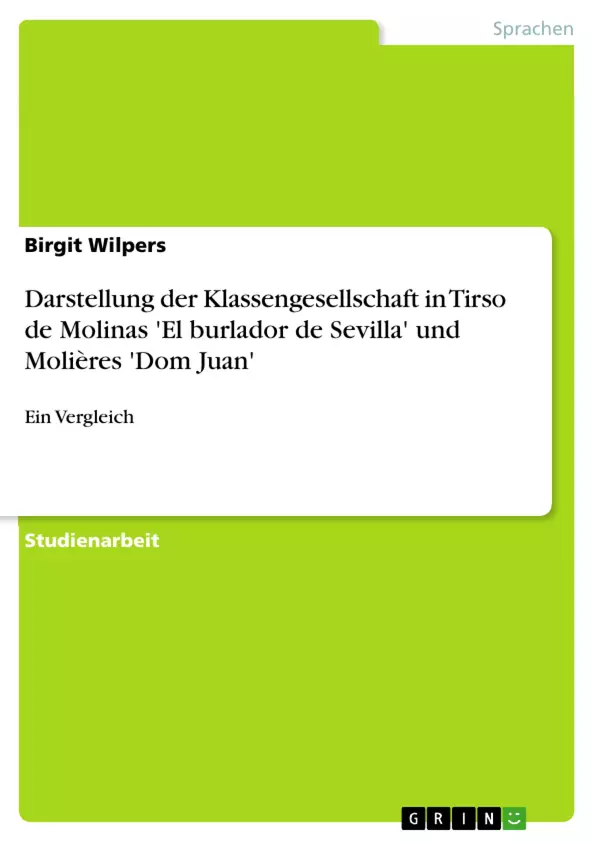Untersuchung der Texte im Hinblick auf die Darstellung der damaligen Klassengesellschaft: Sind in Tirso de Molinas bzw. Molières Stück gesellschaftsrelevante Aussagen vorhanden und wie werden diese in ihrem jeweiligen historischen und politischen Kontext transportiert? Und mit wenigen Ausnahmen kann man die Männer in drei Gruppen einteilen: in solche, die glauben, sie seien Don Juane; in solche, die glauben, sie seien welche gewesen; schließlich in solche, die glauben, sie hätten welche sein können, aber hätten es nie gewollt.
Wie obiges Zitat verdeutlicht, gilt die Don-Juan-Figur als das Symbol für das Männerbild des unverbesserlichen Herzensbrechers und die Verfolgung des Lustprinzips gegen jede gesellschaftliche Norm. Dieser Mythos hat sowohl für Männer als auch Frauen über die Jahrhunderte hinweg nichts von seiner Faszination eingebüßt. In den zahlreichen Interpretationen wird zumeist das Thema der Verführung, der skrupellosen Täuschung und der Bestrafung für ein sündhaftes Leben in den Vordergrund gestellt.
Ich möchte der Frage nachgehen, ob man diesen Mythos nicht auch aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten kann, nämlich im Hinblick auf die Darstellung der damaligen Klassengesellschaft. Sind in Tirso de Molinas bzw. Molières Stück gesellschaftsrelevante Aussagen vorhanden und wie werden diese in ihrem jeweiligen historischen und politischen Kontext transportiert?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tirso de Molina: El burlador de Sevilla
- Inhalt
- Historischer und politischer Kontext in Spanien
- Darstellung des Feudalsystems
- Catalinón - der rechtschaffene Diener
- Batricio - der wehrlose Bauer
- De la Mota – die Aristokratie
- Molière: Dom Juan ou Le Festin de pierre
- Inhalt
- Historischer und politischer Kontext in Frankreich
- Darstellung der Klassengesellschaft
- Sganarell - der gebildete Hausknecht
- Pierrot der widerspenstige Bauer
- Dimanche - das aufstrebende Bürgertum
- Die Aristokratie
- Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit der Darstellung der Klassengesellschaft in Tirso de Molinas "El burlador de Sevilla" und Molières "Dom Juan", wobei ein Vergleich beider Werke im Zentrum steht. Das Ziel ist es, die gesellschaftskritischen Aussagen der beiden Stücke im Kontext ihres jeweiligen historischen und politischen Umfeldes zu analysieren.
- Die Darstellung des Feudalsystems und der sozialen Unterschiede in beiden Werken
- Die Rolle von Dienerfiguren und ihre Beziehung zum Protagonisten
- Die Repräsentation verschiedener Klassen und deren gesellschaftliche Stellung
- Die Verwendung von Sprache und Figurencharakteristik zur Darstellung der Klassengesellschaft
- Die Relevanz der Thematik im historischen Kontext der jeweiligen Epoche
Zusammenfassung der Kapitel
2. Tirso de Molina: El burlador de Sevilla
Dieses Kapitel behandelt den Inhalt von Tirsos Stück "El burlador de Sevilla" und stellt den historischen und politischen Kontext in Spanien im 17. Jahrhundert dar. Es wird die Darstellung des Feudalsystems im Stück anhand der verschiedenen Figuren und deren Beziehungen zueinander beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle des Dieners Catalinón als Repräsentanten des einfachen Volkes.
3. Molière: Dom Juan ou Le Festin de pierre
Dieses Kapitel untersucht den Inhalt von Molières "Dom Juan" und den historischen und politischen Kontext in Frankreich. Die Darstellung der Klassengesellschaft wird anhand der Charaktere und ihrer Beziehungen zueinander analysiert. Die Rolle von Figuren wie Sganarell, Pierrot und Dimanche wird im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Stellung betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Klassengesellschaft, Feudalismus, Theater, Spanien, Frankreich, Siglo de Oro, Barock, Don Juan, Mythos, gesellschaftliche Normen, Verführung, Täuschung, Dienerfiguren, soziale Unterschiede, historische Kontext, politische Situation.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Klassengesellschaft in "Dom Juan" und "El burlador de Sevilla" dargestellt?
Die Stücke zeigen die sozialen Hierarchien des Feudalismus durch die Interaktion zwischen dem aristokratischen Protagonisten, seinen Dienern und der bäuerlichen Bevölkerung.
Welche Rolle spielen die Dienerfiguren Catalinón und Sganarell?
Sie fungieren oft als moralisches Gewissen oder kritische Beobachter ihres Herrn und repräsentieren die Perspektive der niederen Klassen innerhalb des Systems.
Was symbolisiert die Figur des Don Juan?
Don Juan symbolisiert den unverbesserlichen Herzensbrecher, der das Lustprinzip über alle gesellschaftlichen und religiösen Normen stellt.
Wie unterscheidet sich der historische Kontext in Spanien und Frankreich?
Die Arbeit beleuchtet das spanische "Siglo de Oro" bei Tirso de Molina und die absolutistische Gesellschaft Frankreichs zur Zeit Molières.
Enthalten die Stücke gesellschaftskritische Aussagen?
Ja, über die Verführungsthematik hinaus kritisieren beide Autoren die Arroganz des Adels und die Ohnmacht der unteren Schichten gegenüber aristokratischer Willkür.
- Quote paper
- Birgit Wilpers (Author), 2008, Darstellung der Klassengesellschaft in Tirso de Molinas 'El burlador de Sevilla' und Molières 'Dom Juan', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154833