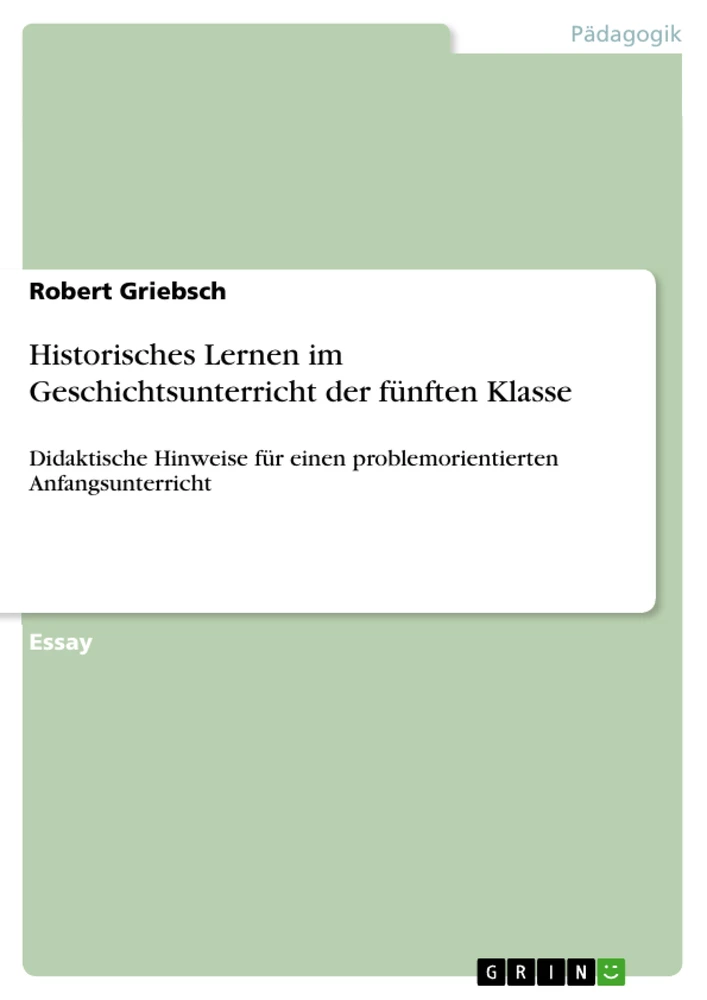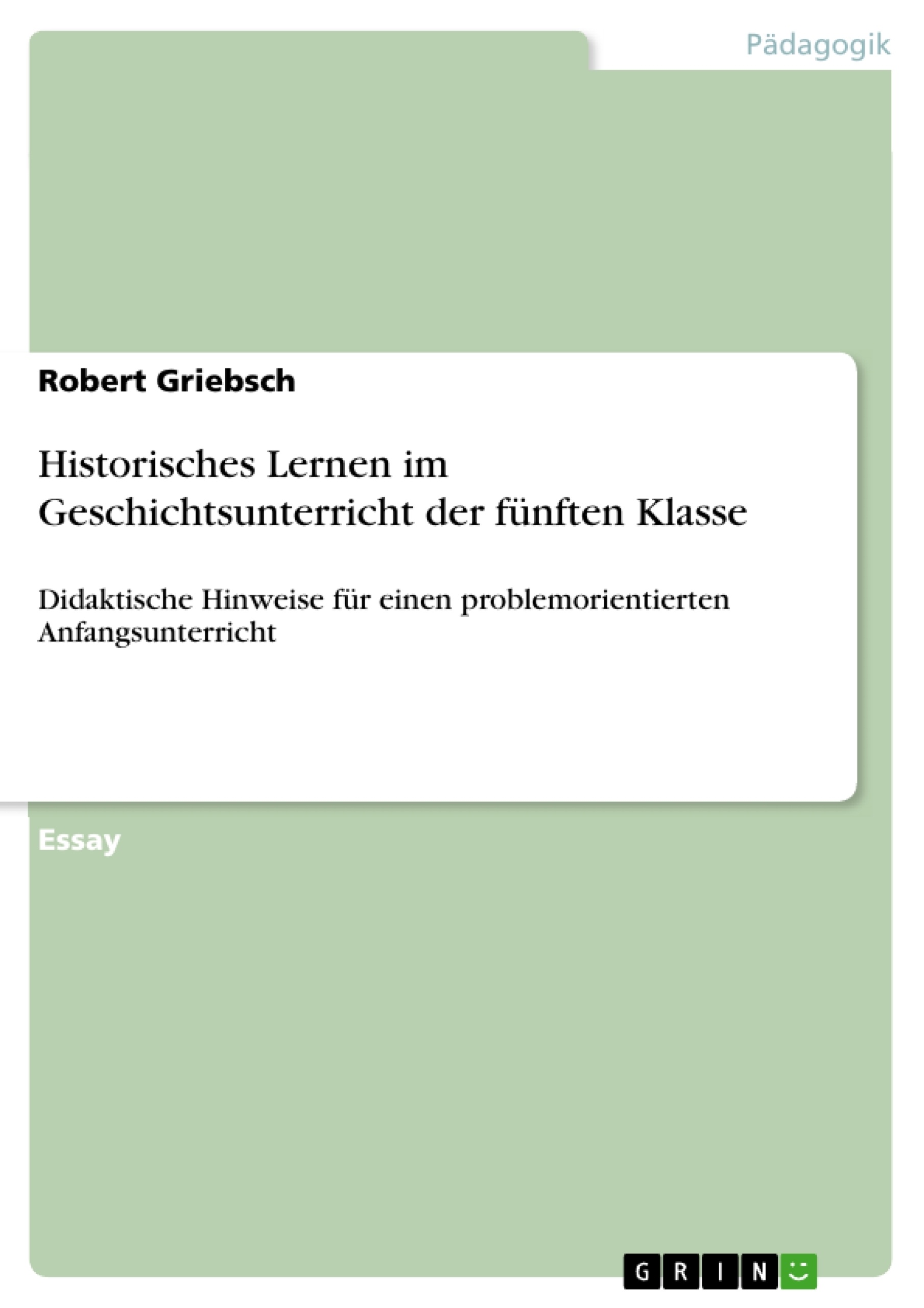Historisches Lernen ist nicht als simples Erlernen von einer chronologischen Abfolge zu charakterisieren, sondern als Lernprozess zu verstehen, in dem die SchülerInnen integriert sind. Überall erfolgt unbewusst eine Begegnung mit Geschichte. Ohne diverse Kompetenzen ist es jedoch unmöglich, gezielt historisches Wissen aufzubauen. Die Erzählungen der Großeltern vermitteln die „eine“ historische Wahrheit, Initiatoren von Ausstellungen zeigen selektiv ausgewählte Erinnerungsstücke samt damit verbundener Geschichte und blenden „Randereignisse“ bewusst oder unbewusst aus. Filme sind zwar anschaulich, aber eben eine subjektive Inszenierung durch die Urheber.
Schon in Klasse 5 muss deutlich werden, dass Geschichte eben nicht als „eindeutig“ charakterisiert werden kann und darf.
Fragt man LehrerInnen nach den anzustrebenden Zielen im Geschichtsunterricht , wird man stets unterschiedliche Antworten erhalten. Es fehlt der Konsens, was die Jugendlichen eigentlich lernen und welche Kompetenzen sie (weiter-)entwickeln sollen. Die Folge ist, dass die Lernenden kein historisch geprägtes Strukturwissen aufbauen können (vgl. Borries 2004: 275). Bildungsstandards und die damit verbundene Konzeption von Kompetenzmodellen als „potentes Instrument der Schulreform“ (Herzog 2008: 395) sollen die Erarbeitung von Basiskonzepten möglich machen, die letztlich in einem problem- und zielorientierten Unterricht münden können.
Mit diesem Text werde ich einen Zugang zum Anfangsunterricht in Klasse 5 erarbeiten und didaktische Hinweise formulieren, um den LehrerInnen eine Hilfestellung anzubieten.
Dafür werde ich zunächst die Ausgangslage der Fünftklässler nach der Grundschule charakterisieren (1.), um dann in diesem Zusammenhang das Prinzip der Problemorientierung erklären zu können (2.). In einem dritten Schritt werde ich verdeutlichen, welche Kompetenzen ein „Historiker“ entwickeln muss und wie man diese messen kann (3.). Die Systematisierung soll dann an einem Unterrichtsbeispiel sämtliche Thesen zusammenfassen und verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog: Historisches Lernen und existenzielle Bezüge
- 1. Ausgangslage: Historisches Lernen in Sekundarstufe I
- 2. Der Problemorientierte Geschichtsunterricht
- 3. Kompetenzen und Kompetenzförderung
- Fazit: „Kindheit im Wandel“ - existenzielle Bezüge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text zielt darauf ab, einen Zugang zum Geschichtsunterricht in der fünften Klasse zu erarbeiten und didaktische Hinweise für einen problemorientierten Anfangsunterricht zu formulieren. Er analysiert die Ausgangslage der Fünftklässler nach der Grundschule, erklärt das Prinzip der Problemorientierung und verdeutlicht, welche Kompetenzen ein „Historiker“ entwickeln muss und wie man diese messen kann.
- Historisches Lernen als Lernprozess und seine Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft
- Fehlkonzepte im Geschichtsverständnis von Schülern der fünften Klasse
- Problemorientierte Didaktik im Geschichtsunterricht
- Kompetenzentwicklung im Geschichtsunterricht
- Bedeutung von Bildungsstandards für den Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Der Prolog thematisiert die Bedeutung historischen Lernens als Lernprozess, in dem Schüler die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft integrieren und ein historisch geprägtes Strukturwissen aufbauen. Er beleuchtet die Herausforderung, den Jugendlichen ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein zu vermitteln, da sie bereits vor Beginn der Sekundarstufe I mit Geschichte konfrontiert werden, jedoch oftmals ein partikulares und alltagsorientiertes Geschichtsverständnis entwickeln.
Das erste Kapitel analysiert die Ausgangslage der Fünftklässler nach der Grundschule und beleuchtet die Herausforderungen des historischen Anfangsunterrichts. Es identifiziert vier Fehlkonzepte, die bei Schülern in der fünften Klasse häufig vorkommen, wie die Personifizierung und Personalisierung historischer Ereignisse, die starre Begriffscharakterisierung von Epochen und die Analogie von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Das zweite Kapitel erklärt das Prinzip der Problemorientierung im Geschichtsunterricht. Es argumentiert, dass ein problem- und zielorientierter Unterricht den Schülern helfen kann, ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu entwickeln und die Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft zu erschließen.
Schlüsselwörter
Historisches Lernen, Geschichtsunterricht, Fünfte Klasse, Problemorientierung, Kompetenzen, Fehlkonzepte, Bildungsstandards, Geschichtsbewusstsein, Sekundarstufe I, Konzeptwandel, "misconceptions", "conceptual change", didaktische Hinweise.
Häufig gestellte Fragen
Wie lernen Kinder in der 5. Klasse Geschichte?
Historisches Lernen ist ein Prozess, bei dem Schüler lernen, dass Geschichte nicht „eindeutig“ ist, sondern aus verschiedenen Perspektiven und Quellen rekonstruiert werden muss.
Was ist problemorientierter Geschichtsunterricht?
Dieser Ansatz geht von einer zentralen Fragestellung aus, die die Relevanz der Vergangenheit für die Gegenwart der Schüler aufzeigt.
Welche Fehlkonzepte haben Fünftklässler oft?
Häufige Fehlkonzepte sind die Personifizierung (Ereignisse hängen nur an einer Person) oder die Annahme, dass die Vergangenheit exakt wie die Gegenwart funktionierte.
Welche Kompetenzen sollen im Geschichtsunterricht gefördert werden?
Schüler sollen lernen, Quellen kritisch zu prüfen, historische Zusammenhänge zu strukturieren und ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein zu entwickeln.
Warum sind Bildungsstandards im Fach Geschichte wichtig?
Sie schaffen einen Konsens darüber, welches Strukturwissen und welche Basiskonzepte Schüler am Ende einer Jahrgangsstufe beherrschen sollten.
- Quote paper
- Robert Griebsch (Author), 2010, Historisches Lernen im Geschichtsunterricht der fünften Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156145