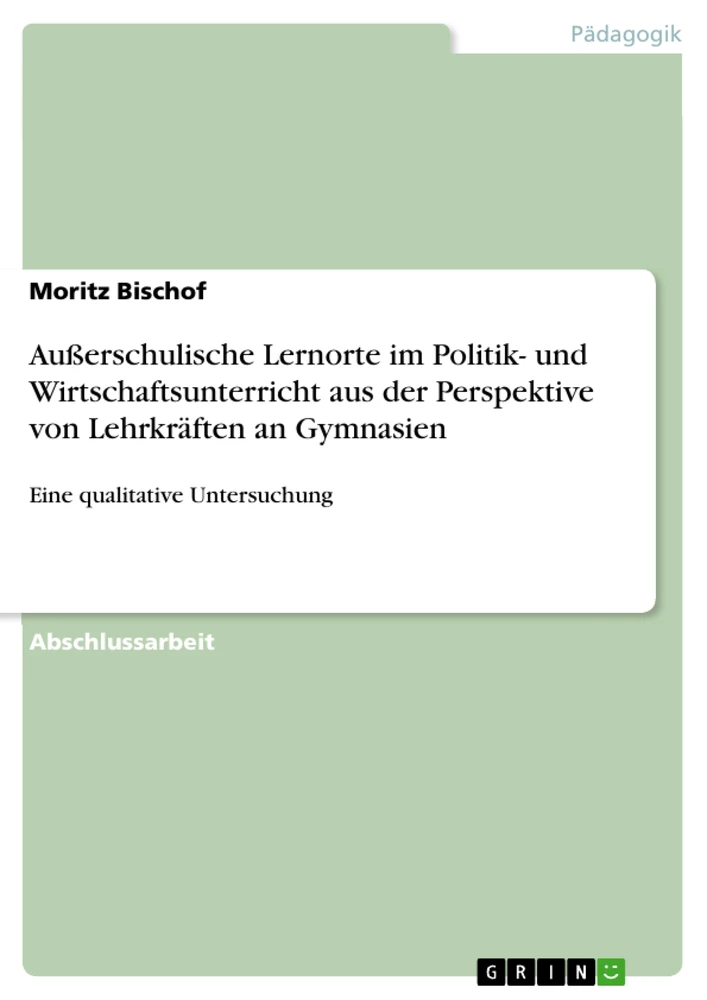Schule soll auf das Leben vorbereiten – doch wie kann das gelingen, wenn Lernen fast ausschließlich im Klassenraum stattfindet? Außerschulische Lernorte bieten eine Möglichkeit, Unterricht lebendiger und praxisnäher zu gestalten. Doch welche Rolle spielen sie tatsächlich im Politik- und Wirtschaftsunterricht? Und wie bewerten Lehrkräfte ihren Nutzen?
Diese Arbeit untersucht die Perspektiven von Lehrkräften auf außerschulische Lernorte im hessischen Gymnasialunterricht. Durch qualitative Interviews mit Lehrkräften werden Einflussfaktoren, Herausforderungen und Erfolgsbedingungen für Exkursionen und außerschulische Lernangebote erfasst. Dabei wird deutlich: Außerschulische Lernorte haben das Potenzial, den Unterricht spannender und wirkungsvoller zu gestalten, doch organisatorische Hürden und fehlende institutionelle Unterstützung erschweren ihre Umsetzung.
Neben einer theoretischen Einordnung des Konzepts beleuchtet diese Arbeit, wie außerschulisches Lernen sinnvoll in den Unterricht integriert werden kann und welche strukturellen Änderungen notwendig wären, um diese Form des Lernens stärker zu fördern.
Ein wertvoller Beitrag zur Debatte über moderne Didaktik, der zeigt, dass erfolgreiches Lernen nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb ihrer Mauern stattfindet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Außerschulischer Lernort
- 2.2 Kontextualisierung
- 2.3 Lernformen und Lernorte
- 2.4 Schematisierung außerschulischer Lernorte
- 2.5 Bildungstheoretische Grundlagen
- 2.5.1 Empirische Forschung
- 2.5.2 Normative Forschung
- 2.6 Zusammenfassung
- 2.7 Implikationen von außerschulischen Lernorten auf Lernen
- 3. Akteure von außerschulischen Lernens
- 4. Methodik
- 4.1 Untersuchungsdesign und Vorgehen
- 4.2 Beschreibung des Ausgangsmaterials
- 4.3 Stichprobenbeschreibung
- 4.4 Interviewleitfaden
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Kategorien
- 5.2 Kategoriensystem
- 6. Diskussion
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Perspektive von Lehrkräften an Gymnasien in Hessen auf außerschulische Lernorte im Politik- und Wirtschaftsunterricht. Ziel ist es, Erfolgsfaktoren, Rahmenbedingungen und Hindernisse bei der Implementierung solcher Lernorte zu identifizieren. Die Studie nutzt qualitative Forschungsmethoden zur Beantwortung der Forschungsfragen.
- Erfolgsfaktoren außerschulischer Lernorte im Politik- und Wirtschaftsunterricht
- Notwendige Rahmenbedingungen für erfolgreiche außerschulische Lernorte
- Hindernisse bei der Implementierung außerschulischer Lernorte
- Perspektive von Lehrkräften auf außerschulische Lernorte
- Beitrag außerschulischer Lernorte zum Lernen im Fach Politik und Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Paradoxon von Schule dar: Die Vorbereitung auf das Leben in einem abgeschotteten Raum, dem Klassenraum. Sie führt das Konzept des außerschulischen Lernens ein, beruft sich auf Rousseau und betont den potenziellen Mehrwert für Schüler. Die Arbeit konzentriert sich auf die Perspektive von Lehrkräften im hessischen Politik- und Wirtschaftsunterricht (PoWi) aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten und des Forschungsbedarfs in diesem Fach. Die Zielsetzung ist die Herausarbeitung der Lehrkräfteperspektive bezüglich Erfolgsfaktoren, Rahmenbedingungen und Hindernisse außerschulischen Lernens.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen für die Untersuchung. Es definiert den Begriff des außerschulischen Lernorts, kontextualisiert ihn und beleuchtet verschiedene Lernformen und -orte. Es wird ein Schema zur Klassifizierung außerschulischer Lernorte vorgestellt und bildungstheoretische Grundlagen, einschliesslich empirischer und normativer Forschung, diskutiert. Der Fokus liegt auf den Implikationen außerschulischer Lernorte für das Lernen im Allgemeinen und speziell im Politik- und Wirtschaftsunterricht.
3. Akteure von außerschulischen Lernens: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext - hier müsste eine Zusammenfassung basierend auf dem Originaltext eingefügt werden.)
4. Methodik: Dieses Kapitel beschreibt das Untersuchungsdesign und das Vorgehen der qualitativen Studie. Es detailliert das Ausgangsmaterial, die Stichprobenbeschreibung und den verwendeten Interviewleitfaden. Der Fokus liegt auf der Darstellung der methodischen Vorgehensweise zur Datenerhebung und -auswertung.
5. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Studie, strukturiert in Kategorien und einem daraus entwickelten Kategoriensystem. Es beschreibt die gewonnenen Erkenntnisse aus den Interviews mit den Lehrkräften. (genaue Beschreibung fehlt im Ausgangstext - hier müsste eine Zusammenfassung basierend auf dem Originaltext eingefügt werden)
Schlüsselwörter
Außerschulische Lernorte, Politik- und Wirtschaftsunterricht, Gymnasien, Lehrkräfteperspektive, Qualitative Forschung, Erfolgsfaktoren, Rahmenbedingungen, Hindernisse, Lernen, Bildungstheorie, Hessen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Themenschwerpunkte, die Zusammenfassung der Kapitel und die Schlüsselwörter einer Arbeit über außerschulische Lernorte im Politik- und Wirtschaftsunterricht an Gymnasien in Hessen enthält.
Welche Kapitel sind im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst die folgenden Kapitel: 1. Einleitung, 2. Theoretischer Hintergrund, 3. Akteure von außerschulischen Lernens, 4. Methodik, 5. Ergebnisse, 6. Diskussion, 7. Fazit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Perspektive von Lehrkräften an Gymnasien in Hessen auf außerschulische Lernorte im Politik- und Wirtschaftsunterricht zu untersuchen, Erfolgsfaktoren, Rahmenbedingungen und Hindernisse bei der Implementierung solcher Lernorte zu identifizieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte sind: Erfolgsfaktoren außerschulischer Lernorte im Politik- und Wirtschaftsunterricht, notwendige Rahmenbedingungen für erfolgreiche außerschulische Lernorte, Hindernisse bei der Implementierung außerschulischer Lernorte, Perspektive von Lehrkräften auf außerschulische Lernorte, Beitrag außerschulischer Lernorte zum Lernen im Fach Politik und Wirtschaft.
Was sind die wichtigsten Inhalte der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert das Paradoxon der Schule, führt das Konzept des außerschulischen Lernens ein und betont den potenziellen Mehrwert für Schüler. Sie konzentriert sich auf die Perspektive von Lehrkräften im hessischen Politik- und Wirtschaftsunterricht (PoWi) und zielt darauf ab, deren Sicht auf Erfolgsfaktoren, Rahmenbedingungen und Hindernisse außerschulischen Lernens herauszuarbeiten.
Welche Aspekte werden im theoretischen Hintergrund behandelt?
Im theoretischen Hintergrund werden der Begriff des außerschulischen Lernorts definiert und kontextualisiert, verschiedene Lernformen und -orte beleuchtet, ein Schema zur Klassifizierung außerschulischer Lernorte vorgestellt und bildungstheoretische Grundlagen diskutiert. Der Fokus liegt auf den Implikationen außerschulischer Lernorte für das Lernen im Allgemeinen und speziell im Politik- und Wirtschaftsunterricht.
Was beinhaltet das Kapitel zur Methodik?
Das Kapitel zur Methodik beschreibt das Untersuchungsdesign und das Vorgehen der qualitativen Studie, detailliert das Ausgangsmaterial, die Stichprobenbeschreibung und den verwendeten Interviewleitfaden. Es konzentriert sich auf die Darstellung der methodischen Vorgehensweise zur Datenerhebung und -auswertung.
Was sind einige der genannten Schlüsselwörter?
Einige der Schlüsselwörter sind: Außerschulische Lernorte, Politik- und Wirtschaftsunterricht, Gymnasien, Lehrkräfteperspektive, Qualitative Forschung, Erfolgsfaktoren, Rahmenbedingungen, Hindernisse, Lernen, Bildungstheorie, Hessen.
- Citation du texte
- Moritz Bischof (Auteur), 2024, Außerschulische Lernorte im Politik- und Wirtschaftsunterricht aus der Perspektive von Lehrkräften an Gymnasien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1561990