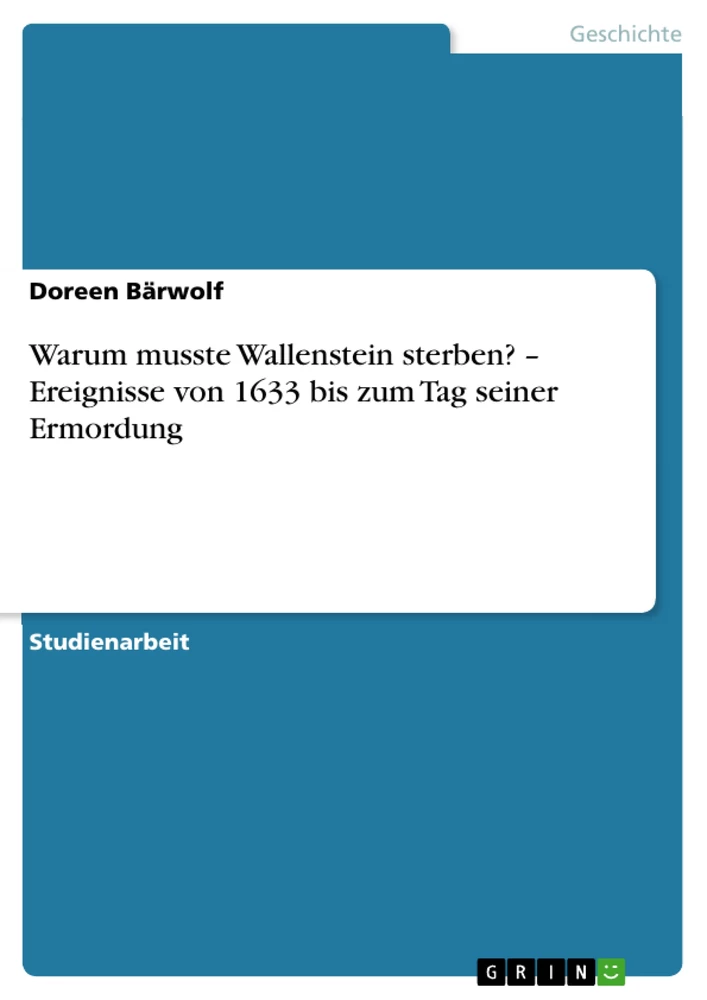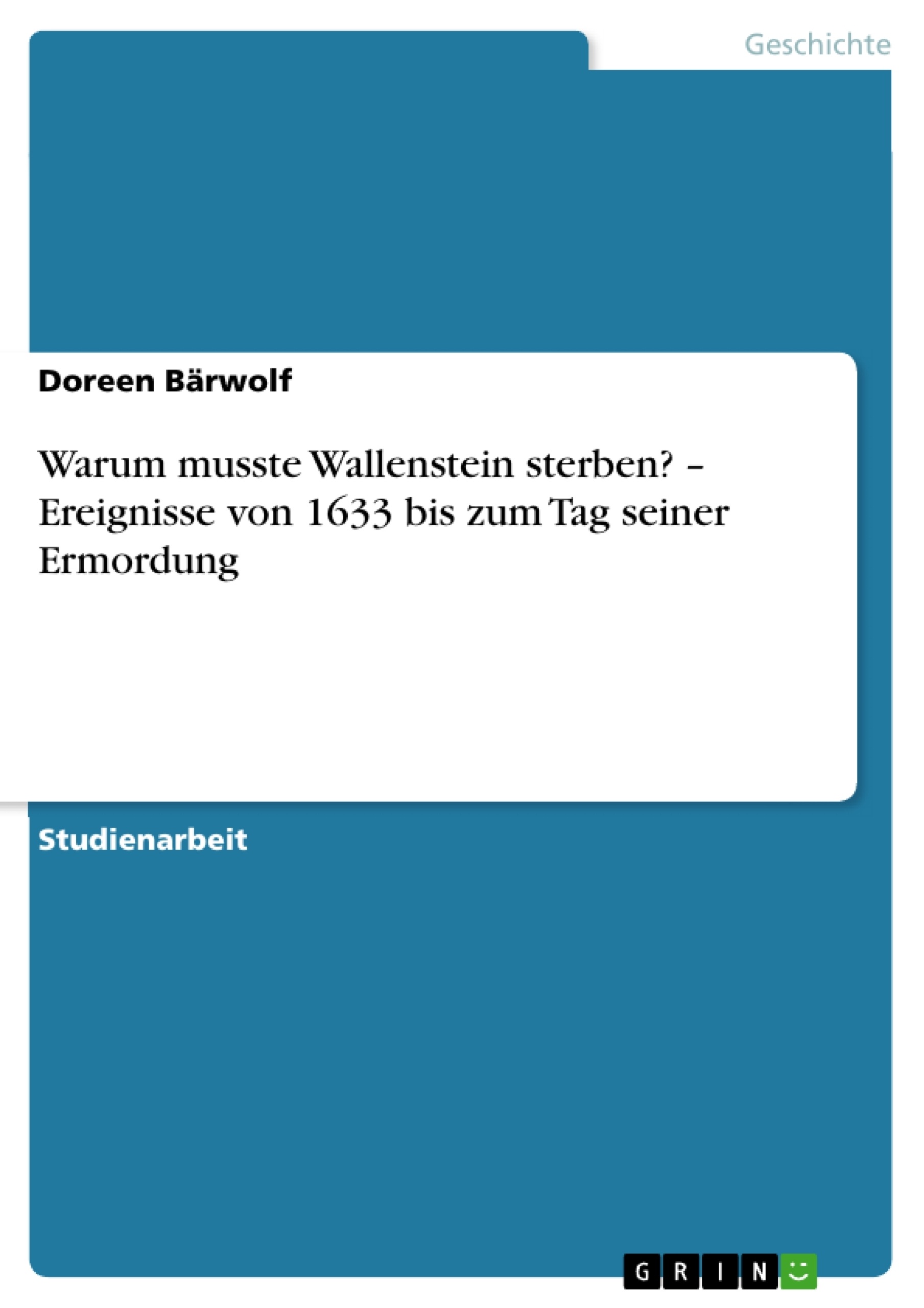Albrecht von Wallenstein ist eine faszinierende Persönlichkeit in der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. Die Quellenlage zu seiner Person und seinem Wirken ist sehr spärlich und teilweiße widersprüchlich. Deshalb erscheint es schwer eine eindeutige Aussage über die Gründe seiner Ermordung zu finden. Man kann nur Schlussfolgerungen aus seinen Taten und den Reaktionen seiner Offiziere und des Kaisers ziehen. Im Folgenden wird versucht, anhand der Verwendung verschiedener Quellen die möglichen Ursachen für seinen Tod darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Wallensteins zweites Generalat
- Die Verhandlungen mit dem Kaiser
- Kritik an Wallenstein 1633
- Das erste und das zweite Pilsener Revers
- Der Tod Wallensteins
- Die Flucht nach Eger
- Das Attentat
- Die Wertung des Mordes
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Ermordung des Feldherrn Albrecht von Wallenstein im Dreißigjährigen Krieg. Aufgrund der spärlichen und teilweise widersprüchlichen Quellenlage ist es schwer, die genauen Gründe für seinen Tod zu ermitteln. Die Arbeit analysiert die Ereignisse, die zu Wallensteins Ermordung führten, und versucht anhand von verschiedenen Quellen die möglichen Ursachen zu erforschen.
- Wallensteins zweites Generalat und seine Verhandlungen mit dem Kaiser
- Die Kritik an Wallenstein nach dem Prager Blutgericht
- Wallensteins Beziehungen zu seinen Offizieren und den verschiedenen Kriegsparteien
- Die Umstände seiner Ermordung und die Bewertung des Attentats
- Die Auswirkungen von Wallensteins Tod auf den Verlauf des Dreißigjährigen Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einleitung stellt Albrecht von Wallenstein als eine faszinierende Persönlichkeit in der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges vor. Sie betont die Schwierigkeit, definitive Aussagen über die Gründe für seine Ermordung zu treffen, da die verfügbaren Quellen spärlich und widersprüchlich sind.
Wallensteins zweites Generalat
Die Verhandlungen mit dem Kaiser
Dieses Kapitel beschreibt die schwierige Situation des Kaiserreichs nach Wallensteins erster Entlassung im Jahre 1630. Der Kaiser, Ferdinand II., benötigte Wallensteins militärische Fähigkeiten dringend, um die schwedische Invasion unter Gustav Adolf abzuwehren. Die Verhandlungen zwischen Kaiser und Wallenstein waren jedoch von Misstrauen geprägt, da Wallenstein nach seiner Entlassung stark gekränkt war und hohe Forderungen stellte. Schließlich willigte der Kaiser ein und Wallenstein übernahm wieder das Kommando über die kaiserliche Armee.
Kritik an Wallenstein 1633
Nach dem Prager Blutgericht im Februar 1633 wurde Wallensteins Ansehen geschädigt. Er wurde als gnadenlos und brutal wahrgenommen. Die Berater des Kaisers nutzten diese Gelegenheit, um ihre alten Vorwürfe gegen ihn wieder aufleben zu lassen. Wallensteins Verhandlungsversuche mit den Schweden führten zu Misstrauen und verstärkten die Anschuldigungen gegen ihn.
Der Tod Wallensteins
Dieses Kapitel behandelt die Ereignisse, die zu Wallensteins Ermordung führten. Es beschreibt seine Flucht nach Eger und das Attentat auf ihn.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Albrecht von Wallenstein, dem Dreißigjährigen Krieg, dem Kaiserreich, den Verhandlungen mit dem Kaiser, der Kritik an Wallensteins militärischem Vorgehen, den Beziehungen zu seinen Offizieren, dem Prager Blutgericht, der Ermordung Wallensteins in Eger und der Bewertung des Attentats.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Albrecht von Wallenstein?
Albrecht von Wallenstein war ein bedeutender böhmischer Feldherr und Politiker, der im Dreißigjährigen Krieg als Generalissimus für den Kaiser kämpfte.
Warum wurde Wallenstein ermordet?
Die Gründe lagen in tiefem Misstrauen des Kaisers Ferdinand II., Wallensteins eigenmächtigen Verhandlungen mit Feinden und dem Vorwurf des Hochverrats.
Was ist das Pilsener Revers?
Ein Dokument, in dem Wallensteins Offiziere ihm persönlich die Treue schworen, was vom Kaiser als Akt der Rebellion und Abkehr vom kaiserlichen Eid gewertet wurde.
Wie lief das Attentat in Eger ab?
Wallenstein wurde 1634 in Eger (Cheb) in seinem Schlafzimmer von kaiserlichen Offizieren mit einer Partisane ermordet, nachdem zuvor seine engsten Vertrauten bei einem Bankett getötet worden waren.
Welche Folgen hatte sein Tod für den Krieg?
Sein Tod schwächte vorübergehend die kaiserliche Armee, festigte aber die absolute Macht des Kaisers über seine Truppen und beendete Wallensteins Pläne für einen eigenständigen Frieden.
- Citar trabajo
- Doreen Bärwolf (Autor), 2004, Warum musste Wallenstein sterben? – Ereignisse von 1633 bis zum Tag seiner Ermordung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156408