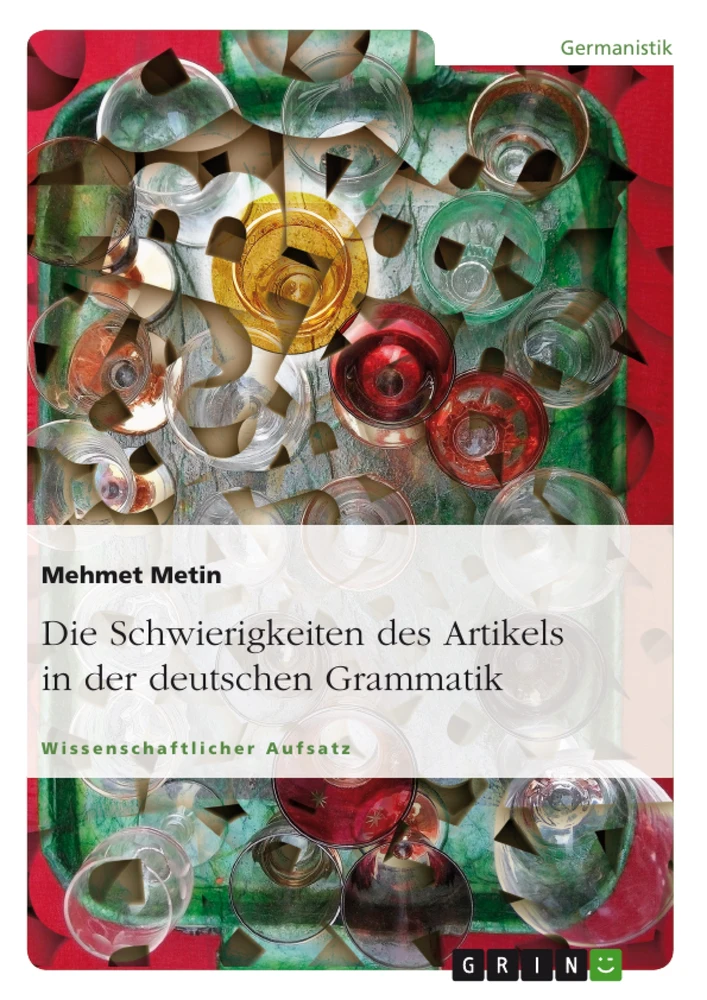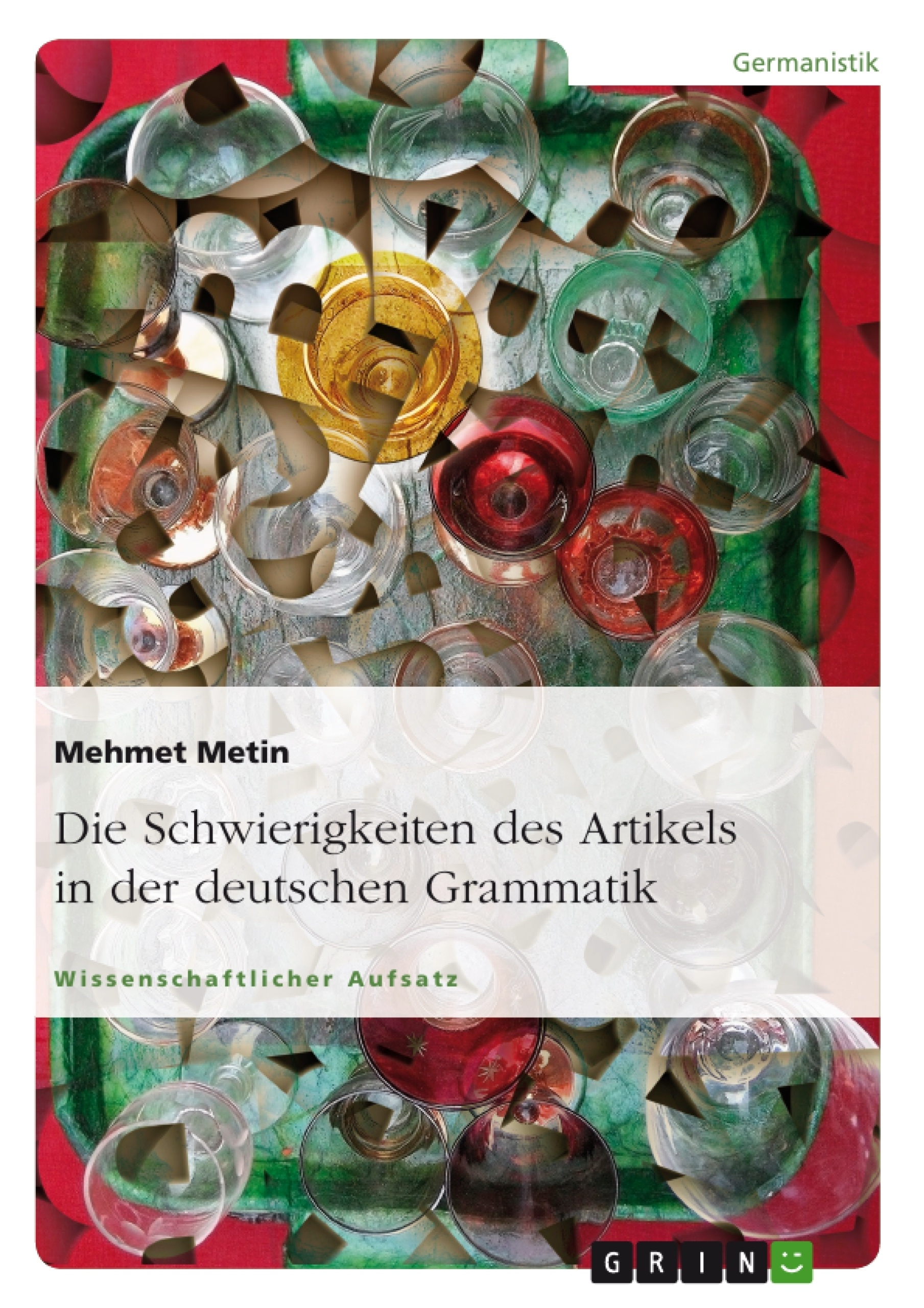Was tun wir, wenn wir den Kindern und Deutschlernende die kleine Wörter der, die, das oder ein oder eine vorstellen? Wir können natürlich von der bestimmten und unbestimmten Artikel erzählen aber wie weit können die Kindern und die Deutschlernende sich darunter vorstellen?
Wir können einmal vor der Klasse ein Glas auf dem Tisch stellen und weisen mit einer Geste darauf hin: Dort steht ein Glas. Ist das Glas unbestimmt, das wir konkret vor uns sehen? Und ist e deutlicher bestimmt, wenn wir sagen: Dort steht das Glas? Wenn man etwas logisch denkt, würde man sagen: ich sehe doch das Glas und wie kann das Glas ein unbestimmtes Artikel sein?
Harald Weinrich spricht von einem anaphorischen ('rückwirkenden) bzw. einem kataphorischen ('vorausverweisenden') Artikel. Der anaphorische (bestimmte) Artikel ist eine Anweisung des Sprechers an den Hörer, für das mit dem Artikel....verbundene Nomen
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Artikel
- Der Artikel in den anderen Sprachen
- Bestimmter Artikel
- Unbestimmter Artikel
- Nullartikel
- Gebrauch des Artikels
- Kanzlei- und Gerichtssprache sowie Journalisten – und Kritikerjargon
- Verwandtschaftsnamen
- Personnamen
- Ländernamen
- Wortpaare
- Präpositionen
- Nichtgebraucht des Artikels
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen einführenden Überblick über den Artikel in der deutschen Sprache. Sie konzentriert sich auf die verschiedenen Formen des Artikels, seinen Gebrauch in verschiedenen Kontexten und Fälle, in denen der Artikel nicht verwendet wird.
- Die drei Formen des Artikels: bestimmter Artikel, unbestimmter Artikel und Nullartikel
- Der Gebrauch des Artikels in verschiedenen Kontexten, wie z.B. in der Kanzlei- und Gerichtssprache, bei Verwandtschaftsnamen und Ländernamen
- Fälle, in denen der Artikel nicht verwendet wird
- Vergleich des Artikels in verschiedenen Sprachen
- Die Bedeutung des Artikels für die Unterscheidung von grammatischen Geschlechts, Kasus und Numerus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die drei Formen des Artikels (bestimmter, unbestimmter, Nullartikel) vor und erklärt ihre Bedeutung für die deutsche Sprache. Es wird auf den Unterschied zwischen anaphorischem und kataphorischem Artikel sowie auf die Unterscheidung zwischen definiten und nicht-definiten Kennzeichen eingegangen. Kapitel 1.1 widmet sich der Existenz des Artikels in anderen Sprachen und stellt fest, dass er in manchen Sprachen nicht existiert, während er in anderen Sprachen, wie z.B. im Bulgarischen, als Suffix realisiert wird. Der zweite Abschnitt des Textes behandelt den Gebrauch des Artikels in verschiedenen Kontexten, wie z.B. in der Kanzlei- und Gerichtssprache, bei Verwandtschaftsnamen und Ländernamen.
Schlüsselwörter
Artikel, deutsche Grammatik, bestimmte Artikel, unbestimmter Artikel, Nullartikel, Gebrauch des Artikels, Nichtgebrauch des Artikels, grammatisches Geschlecht, Kasus, Numerus, Sprachenvergleich, Sprachvergleich.
- Quote paper
- Dr. phil. M.A Mehmet Metin (Author), 2010, Die Schwierigkeiten des Artikels in der deutschen Grammatik , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156669