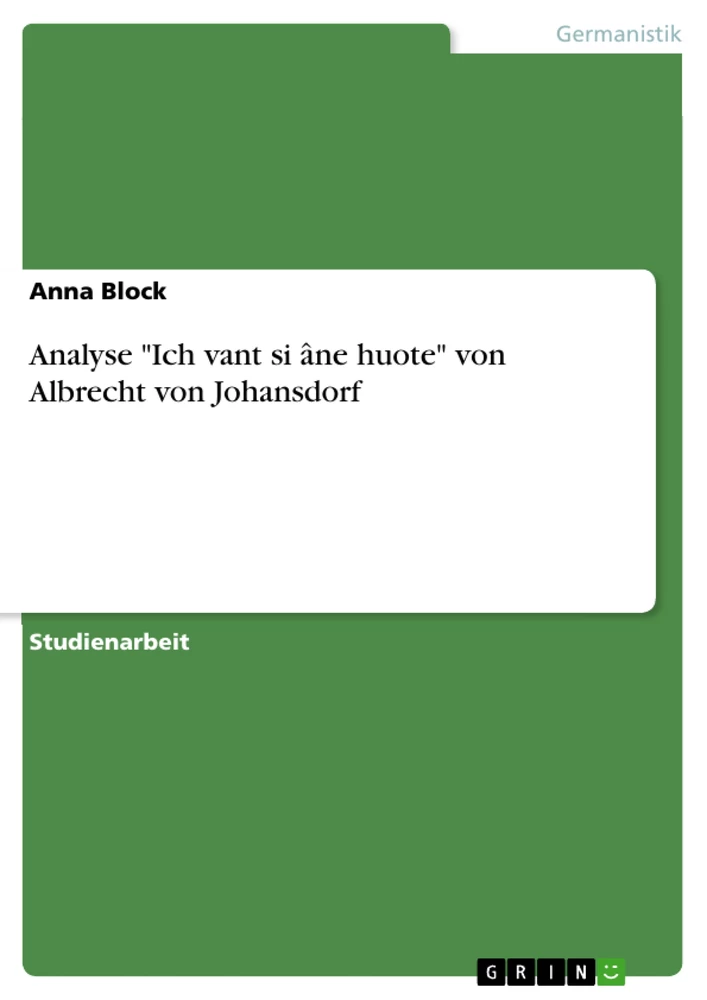Die vorliegende Arbeit nähert sich einer Auseinandersetzung mit dem Lied von Albrecht von Johansdorf "Ich vant sie âne huote" in Übersetzung, Verskommentar, formaler Analyse und Interpretationsansätzen. Als persönliche Auseinandersetzung mit dem Text wird abschließend ein Regiebuch zu dem Lied vorgestellt, dass als Fazit angesehen werden kann
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- TEXT- UND ÜBERLIEFERUNGSKRITISCHER TEIL
- ZUR ÜBERLIEFERUNG DES LIEDES.
- ÜBERSETZUNG ICH VANT SIE ANE HUOTE (MF 93,12 XII; TEXT NACH B).
- VERSKOMMENTAR ZUR ÜBERSETZUNG
- FORMALE ANALYSE...
- INTERPRETATIONSANSÄTZE – ZUM INHALTLICHEN VERSTÄNDNIS VON MF 93,12..
- EIN REGIEBUCH ZU ICH VANT SI ÂNE HUOTE.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das mittelhochdeutsche Dialoglied „Ich vant si âne huote“ von Albrecht von Johansdorf. Ziel ist es, das Lied in Übersetzung, Verskommentar, formaler Analyse und Interpretationsansätzen zu betrachten. Abschließend wird ein Regiebuch zum Lied vorgestellt, das als persönliches Fazit der Analyse angesehen werden kann.
- Überlieferung und Entstehung des Liedes
- Formaler Aufbau und sprachliche Besonderheiten
- Inhaltliche Interpretation und Analyse der Dialoge
- Die Rolle von Liebe und Minne in der Minnelyrik
- Die Bedeutung von Johansdorfs Werk im Kontext des Minnesangs
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Autor Albrecht von Johansdorf und sein Lied „Ich vant si âne huote“ in den Kontext des Minnesangs des 12. und 13. Jahrhunderts vor.
- Text- und überlieferungskritischer Teil: Dieses Kapitel befasst sich mit der Überlieferung des Liedes, untersucht die verschiedenen Handschriften und geht auf die Frage der Autorschaft ein.
- Übersetzung und Verskommentar: Es wird eine Übersetzung des Liedes präsentiert und ein Verskommentar erläutert sprachliche Besonderheiten und eventuelle Interpretationsprobleme.
- Interpretationsansätze: Das Kapitel diskutiert verschiedene Interpretationsansätze zum Inhalt des Liedes und analysiert die Dialoge zwischen den beiden Protagonisten.
Schlüsselwörter
Minnesang, Albrecht von Johansdorf, Dialoglied, „Ich vant si âne huote“, Mittelhochdeutsch, Überlieferung, Formale Analyse, Interpretation, Liebe, Minne, Regiebuch.
- Quote paper
- Anna Block (Author), 2009, Analyse "Ich vant si âne huote" von Albrecht von Johansdorf , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158028