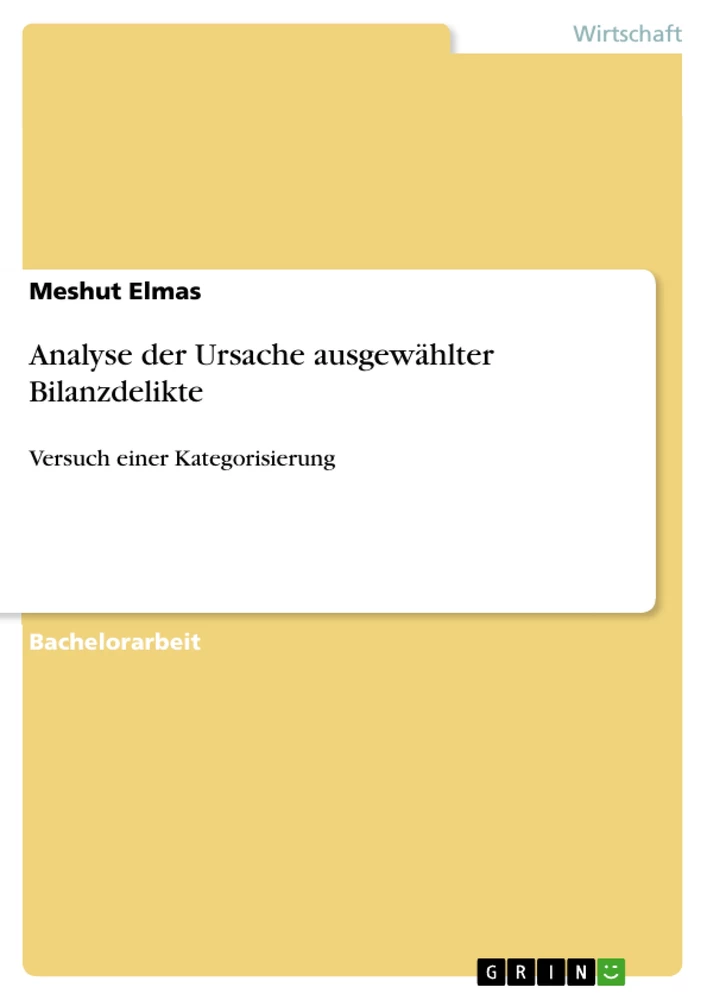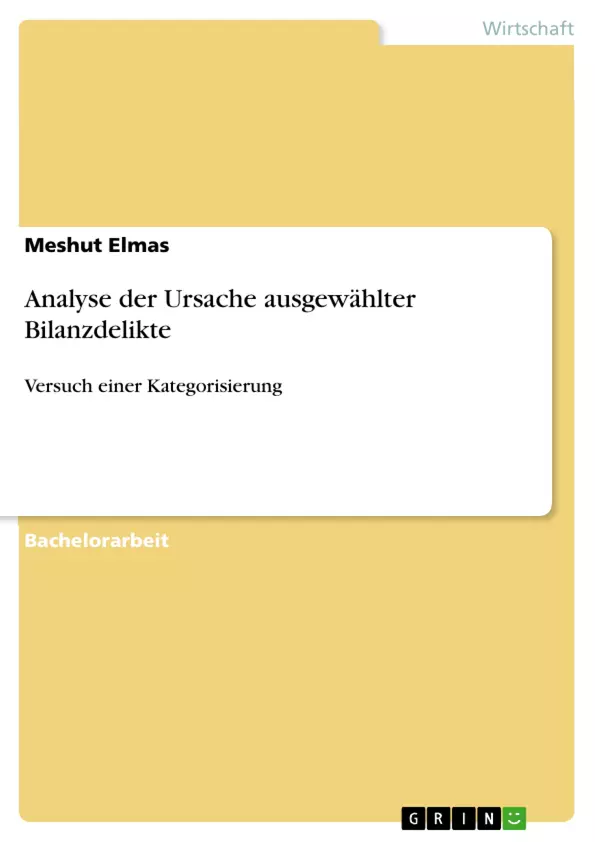Die von Manfred Schmider und Klaus Kleiser 1983 gegründete Tiefbaufirma „Flowtex“, mit Sitz in Ettlingen, konzentrierte sich mit dem Vertrieb von sogenannten „Horizontal-Bohrgeräten“, für das sie 1986 ein Patent erhielt. Mit diesen Bohrgeräten können unterirdische Bohrungen vorgenommen werden, um z.B. Kabel zu verlegen, ohne dabei die Oberfläche oder Straßen aufreißen zu müssen. Schmider gelang es, innerhalb weniger Jahre ein Imperium aufzubauen, zu dem neben einer Beteiligungsgesellschaft mit mehreren Tochterfirmen auch unabhängige Strohfirmen gehörten. Das Unternehmensgeflecht von Flowtex bestand aus 90 Unternehmen, die durch die Unterstützung von Banken und Leasingunternehmen finanziert wurden. Schmider und Kleiser kamen dann 1990 auf die Idee, den Unternehmenserfolg mit kriminellen Mitteln nachzubessern. Schmider kaufte nicht existierende Bohrgeräte, bei dem sich der Stückpreis zwischen 0,5 und 1 Millionen € belief, von Strohfirmen und gleichzeitig auch Tochterunternehmen KSK, um diese wiederum an Endkunden zu vermieten. Um diese Bohrgeräte finanzieren zu können, schloss Schmider Leasingverträge mit Banken und Leasingunternehmen ab. Die Einnahmen der Strohfirma KSK gingen als zusätzliche liquide Mittel bei der Firma Flowtex ein. Die Leasingraten wurden dadurch finanziert, dass immer wieder neue Verträge abgeschlossen wurden (siehe Abbildung 6). Schmider und Kleiser entwickelten ein klassisches Schneeballsystem: Flowtex kaufte Bohrgeräte von der KSK, die in Wirklichkeit nie existierten. Diese Geräte wurden von Banken und Leasingverträgen finanziert, um sie weitervermieten zu können. Dabei hat Schmider bei der Besichtigung der Bohrgeräte die Vertreter von Banken und Leasingunternehmen ausgetrickst. Schmider führte den Vertretern immer wieder dieselben Bohrgeräte vor, indem er diese von der einen zur nächsten Baustelle transportieren ließ. Um keinen Verdacht zu schöpfen, ließ Schmider und Kleiser bei jeder Besichtigung jedes Mal neue Typenschilder stanzen und Rechnungen fälschen. Von den 3142 Bohrgeräten, die von ahnungslosen Banken und Leasingunternehmen finanziert wurden, existierten tatsächlich nur 270
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bilanzdelikte
- 2.1. Definition
- 2.2. Gesetzliche Regelungen
- 2.3. Ursache/ Motive für Bilanzdelikte
- 3. Kategorisierung/ Systematisierung von Bilanzdelikten
- 3.1. Erfolgsneutrale Bilanzdelikte
- 3.1.1. Unberechtigte Gruppenbildung
- 3.1.1.2. Praxisbeispiel: Kehrgeräte AG
- 3.1.1.3. Auswirkung auf den Jahresabschluss
- 3.1.1.4. Erkennbarkeit
- 3.1.1.5. Bilanzanalytische Maßnahmen
- 3.1.2 Falschbenennung
- 3.1.2.1. Sachverhalt
- 3.1.2.2. Praxisbeispiel: Zweite Buchführung
- 3.1.2.3. Auswirkungen auf den Jahresabschluss
- 3.1.2.4. Erkennbarkeit
- 3.1.2.5. Bilanzanalytische Maßnahmen
- 3.1.3. Unberechtigte Saldierung/Unterlassung notwendiger Saldierung
- 3.1.3.1. Sachverhalt
- 3.1.3.2. Praxisbeispiel: Kehrgeräte AG
- 3.1.3.3. Auswirkungen auf den Jahresabschluss
- 3.1.3.4. Erkennbarkeit
- 3.1.3.5. Bilanzanalytische Maßnahmen
- 3.2. Erfolgswirksame Bilanzdelikte
- 3.2.1. Ausgewählte Bewertungsdelikte
- 3.2.1.1. Sachverhalt
- 3.2.1.2. Praxisbeispiel: Hugo Boss
- 3.2.1.3. Auswirkungen auf den Jahresabschluss
- 3.2.1.4. Erkennbarkeit
- 3.2.1.5. Bilanzanalytische Maßnahmen
- 3.2.2. Ausgewählte Ansatzdelikte
- 3.2.2.1. Umsatzrealisation
- 3.2.2.1.1. Sachverhalt
- 3.2.2.1.2. Praxisbeispiel: Bankgesellschaft Berlin
- 3.2.2.1.3. Auswirkungen auf den Jahresabschluss
- 3.2.2.1.4. Erkennbarkeit
- 3.2.2.1.5. Bilanzanalytische Maßnahmen
- 3.2.2.2. Einstellen nicht vorhandener Posten in den Jahresabschluss
- 3.2.2.2.1 Sachverhalt
- 3.2.2.2.2. Praxisbeispiel: Flowtex
- 3.2.2.2.3. Auswirkung auf den Jahresabschluss
- 3.2.2.2.4. Erkennbarkeit
- 3.2.2.2.5. Bilanzanalytische Maßnahmen
- 3.2.3. Geschäfte mit nicht konsolidierten Unternehmen („Konzerngeschäfte“)
- 3.2.3.1.Sachverhalt
- 3.2.3.2. Praxisbeispiel: Enron
- 3.2.3.3. Auswirkungen auf den Jahresabschluss
- 3.2.3.4. Erkennbarkeit
- 3.2.3.5. Bilanzanalytische Maßnahmen
- 3.2.4. Ausweis fingierter Umsätze (Scheingeschäfte)
- 3.2.4.1. Sachverhalt
- 3.2.4.2. Praxisbeispiel: Comroad
- 3.2.4.3. Auswirkungen auf den Jahresabschluss
- 3.2.4.4. Erkennbarkeit
- 3.2.4.5. Bilanzanalytische Maßnahmen
- Definition und gesetzliche Regelungen von Bilanzdelikten
- Motive und Ursachen für Bilanzdelikte
- Kategorisierung von Bilanzdelikten in erfolgsneutrale und erfolgswirksame Delikte
- Analyse ausgewählter Bilanzdelikte mit Praxisbeispielen
- Bilanzanalytische Maßnahmen zur Erkennung von Bilanzdelikten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Ursachen ausgewählter Bilanzdelikte und versucht, diese in Kategorien zu systematisieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Bilanzdelikte beleuchtet und den Aufbau der Arbeit erläutert. Kapitel 2 definiert Bilanzdelikte, beleuchtet die gesetzlichen Regelungen und untersucht die Motive und Ursachen für deren Begehung. Kapitel 3 stellt eine Kategorisierung von Bilanzdelikten vor, wobei diese in erfolgsneutrale und erfolgswirksame Delikte unterteilt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse einzelner Bilanzdelikte mit Praxisbeispielen und der Erörterung bilanzanalytischer Maßnahmen zur Erkennung dieser Delikte.
Schlüsselwörter
Bilanzdelikte, Bilanzanalyse, Bilanzmanipulation, Jahresabschluss, Kategorisierung, Systematisierung, Praxisbeispiele, Erkennbarkeit, Bilanzanalytische Maßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Flowtex-Skandal?
Flowtex war einer der größten deutschen Bilanzbetrugsfälle, bei dem über 3.000 Bohrgeräte an Banken verkauft wurden, von denen tatsächlich nur 270 existierten.
Was ist der Unterschied zwischen erfolgsneutralen und erfolgswirksamen Bilanzdelikten?
Erfolgswirksame Delikte beeinflussen direkt den Gewinn (z.B. durch Scheingeschäfte), während erfolgsneutrale Delikte die Darstellung in der Bilanz verfälschen, ohne das Ergebnis sofort zu ändern (z.B. Falschbenennung).
Welche Motive führen zu Bilanzmanipulationen?
Häufige Motive sind die Täuschung von Kapitalgebern, die Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit oder das Erreichen persönlicher Bonusziele des Managements.
Was sind Scheingeschäfte im Kontext von Bilanzdelikten?
Dabei werden Umsätze mit Firmen vorgetäuscht, die entweder gar nicht existieren oder keine realen Leistungen erbringen, um das Unternehmen erfolgreicher darzustellen (Beispiel: Comroad).
Wie können Bilanzdelikte erkannt werden?
Die Arbeit beschreibt bilanzanalytische Maßnahmen, mit denen Unstimmigkeiten in den Posten des Jahresabschlusses aufgedeckt werden können.
- Citar trabajo
- Meshut Elmas (Autor), 2010, Analyse der Ursache ausgewählter Bilanzdelikte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158199