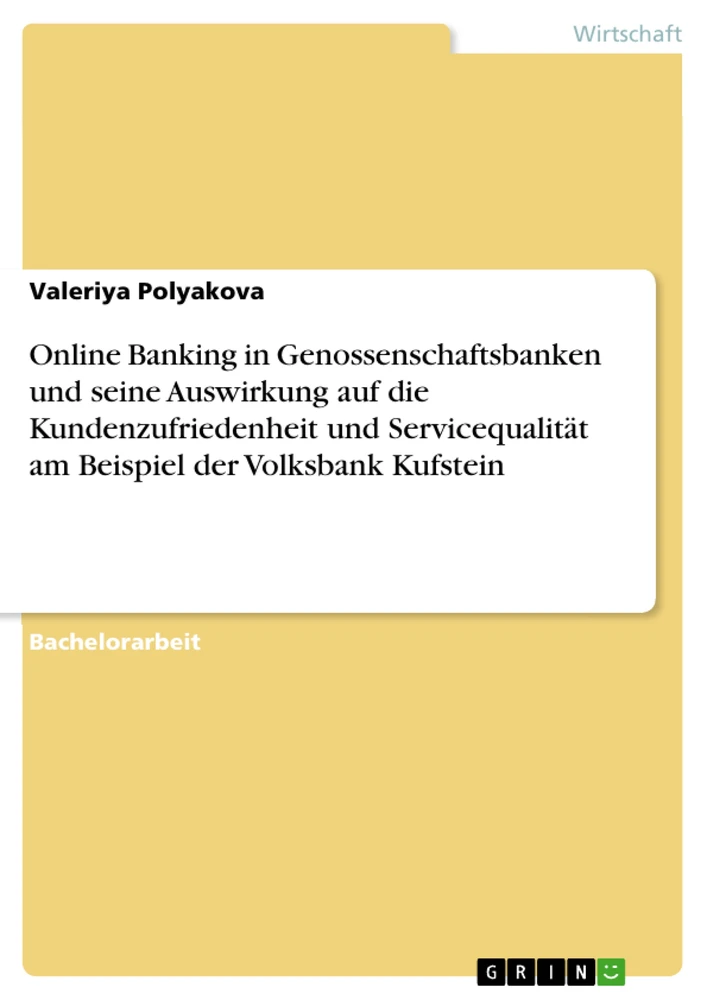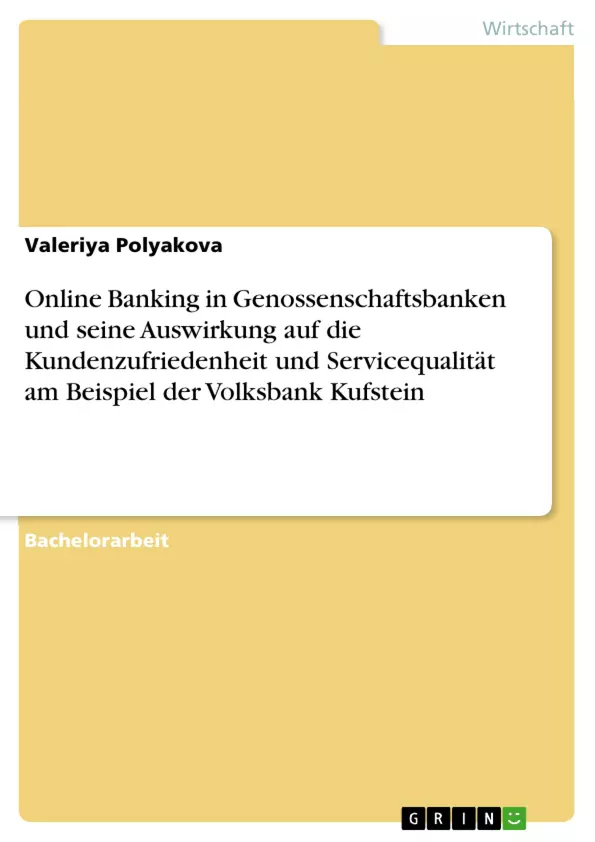Ziele dieser Arbeit ist es, einen Teilbereich des E-Commerce im österreichischen Banksektor, nämlich Online Banking, zu untersuchen sowie die ausschlaggebenden Merkmale für die Kundenzufriedenheit, Servicequalität und deren Messansätze zu definieren und deren Zusammenhang mit dem Unternehmenserfolg festzustellen. Des Weiteren sollen die Verbesserungspotentiale im Rahmen der kundenorientierten Unternehmensführung und Qualitätsmanagements untersucht werden.
Im zweiten Kapitel werden die Definitionen von Electronic Business und Electronic Commerce erfolgen. Wobei Internet, Electronic und Online Banking begrifflich abgegrenzt werden. Kapitel 3 soll einen gesamten Überblick über das österreichische Bankwesen verschaffen. Als Beispiel wird die Volksbank Kufstein und ihr Online Banking Service „Livebank.at“ vorgestellt. Kundenzufriedenheit, Servicequalität und deren Zusammenhang mit der Einführung von Online Banking in der Volksbank Kufstein werden in den nachfolgenden Kapiteln genau unter die Lupe genommen. Das vierte Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen der Kundenzufriedenheit und Instrumente zu deren Messung. Des Weiteren werden das Konzept der kundenorientierten Unternehmensführung allgemein und das der Volksbank Kufstein beschrieben und Verbesserungsvorschläge gemacht.
Im fünften Kapitel werden vorerst die Begriffe Qualität (allgemein) und Qualität der Bankdienstleistungen (speziell) erläutert, sowie die Ansatzpunkte zur Erfassung der Servicequalität in der Bankbranche. Es werden die Phasen des Qualitätsmanagement der Banken erläutert. Weiter werden die Qualitätsmaßnahmen der Volksbank Kufstein beschrieben und Optimierungsüberlegungen geäußert. Im Schlussteil wird unter anderem der Zusammenhang zwischen Servicequalität, Kundenzufriedenheit und Unternehmenserfolg untersucht. Einfluss der Einführung des Online Banking auf die Kundenzufriedenheit wird hinterfragt. Wichtige Kausalitäten des E-Commerce werden angesprochen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Methodenbeschreibung
- Theoretische Grundlagen des E-Business
- Begriffsabgrenzung: E-Business und E-Commerce
- Eingrenzung von Internet, Electronic und Online Banking
- Die grundlegenden Betrachtungen des österreichischen Bankwesens
- Österreichisches Bankwesen
- Struktur der Kreditinstitute
- Bankwesengesetz
- Bankaufsichtorgan
- Anzahl der Kreditinstitute
- Wirtschaftliche und wettbewerbsmäßige Lage
- Beschreibung des Beispielunternehmens
- Volksbankgruppe
- Marktanteil der Volksbanken
- Volksbank Kufstein
- Kundenorientierung
- Theoretische Grundlagen der Kundenzufriedenheit
- Auswirkungen von Kundenzufriedenheit
- Instrumente zur Messung der Kundenzufriedenheit
- Messung der Kundenzufriedenheit bei der Volksbank Kufstein
- Kundenorientierte Unternehmensführung
- Kundenorientierte Aufbau- und Ablauforganisation
- Kundenorientierte Personalführung
- Kundenorientiertes Informationssystem
- Kundenorientierte Planung und Kontrolle
- Kundenorientierte Unternehmenskultur
- Kundenorientierte Unternehmensführung der Volksbank Kufstein
- Verbesserungsvorschläge
- Servicequalität
- Theoretische Grundlagen der Servicequalität
- Ansatzpunkte zur Erfassung
- Die Phasen des Qualitätsmanagements der Banken
- Qualitätsmanagement der Volksbank Kufstein
- Verbesserungsvorschläge
- Schluss
- Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit, Servicequalität und Unternehmenserfolg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Untersuchung des Online-Bankings in Genossenschaftsbanken und dessen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und Servicequalität. Im Fokus steht die Volksbank Kufstein als Fallbeispiel. Die Arbeit zielt darauf ab, die relevanten theoretischen Grundlagen zu beleuchten, die Auswirkungen von Online-Banking auf die Kundenzufriedenheit und Servicequalität zu analysieren und konkrete Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.
- Einführung in das Online-Banking in Genossenschaftsbanken
- Analyse der Kundenzufriedenheit im Kontext von Online-Banking
- Bewertung der Servicequalität in Online-Banking-Angeboten
- Entwicklung von Verbesserungsmaßnahmen für die Kundenzufriedenheit und Servicequalität
- Bedeutung von Online-Banking für den Erfolg von Genossenschaftsbanken
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung - Dieses Kapitel behandelt die Problemstellung, die Zielsetzung, den Aufbau der Arbeit und die Methodenbeschreibung. Es werden die Forschungsfrage und die Relevanz der Thematik erläutert.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen des E-Business - Dieses Kapitel definiert die Begriffe E-Business und E-Commerce und grenzt sie voneinander ab. Es beleuchtet die Bedeutung des Internets, Electronic Banking und Online Banking im Kontext von E-Business.
- Kapitel 3: Die grundlegenden Betrachtungen des österreichischen Bankwesens - Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das österreichische Bankwesen, insbesondere die Struktur der Kreditinstitute, das Bankwesengesetz, die Bankaufsicht und die Anzahl der Kreditinstitute. Es beschreibt außerdem die Volksbankgruppe, deren Marktanteil und die Volksbank Kufstein als Fallbeispiel.
- Kapitel 4: Kundenorientierung - Dieses Kapitel untersucht die theoretischen Grundlagen der Kundenzufriedenheit, deren Auswirkungen und die Instrumente zur Messung. Es analysiert die Kundenzufriedenheit bei der Volksbank Kufstein und beleuchtet die Bedeutung von kundenorientierter Unternehmensführung. Die Kapitel beinhaltet auch Verbesserungsvorschläge zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.
- Kapitel 5: Servicequalität - Dieses Kapitel fokussiert sich auf die theoretischen Grundlagen der Servicequalität und die verschiedenen Ansatzpunkte zur Erfassung. Es betrachtet die Phasen des Qualitätsmanagements im Bankwesen und analysiert das Qualitätsmanagement der Volksbank Kufstein. Das Kapitel enthält ebenfalls Verbesserungsvorschläge zur Optimierung der Servicequalität.
Schlüsselwörter
Online-Banking, Genossenschaftsbanken, Kundenzufriedenheit, Servicequalität, Volksbank Kufstein, E-Business, E-Commerce, österreichisches Bankwesen, Kundenorientierung, Qualitätsmanagement, Verbesserungsvorschläge, Unternehmenserfolg.
- Arbeit zitieren
- BA Valeriya Polyakova (Autor:in), 2008, Online Banking in Genossenschaftsbanken und seine Auswirkung auf die Kundenzufriedenheit und Servicequalität am Beispiel der Volksbank Kufstein, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158697