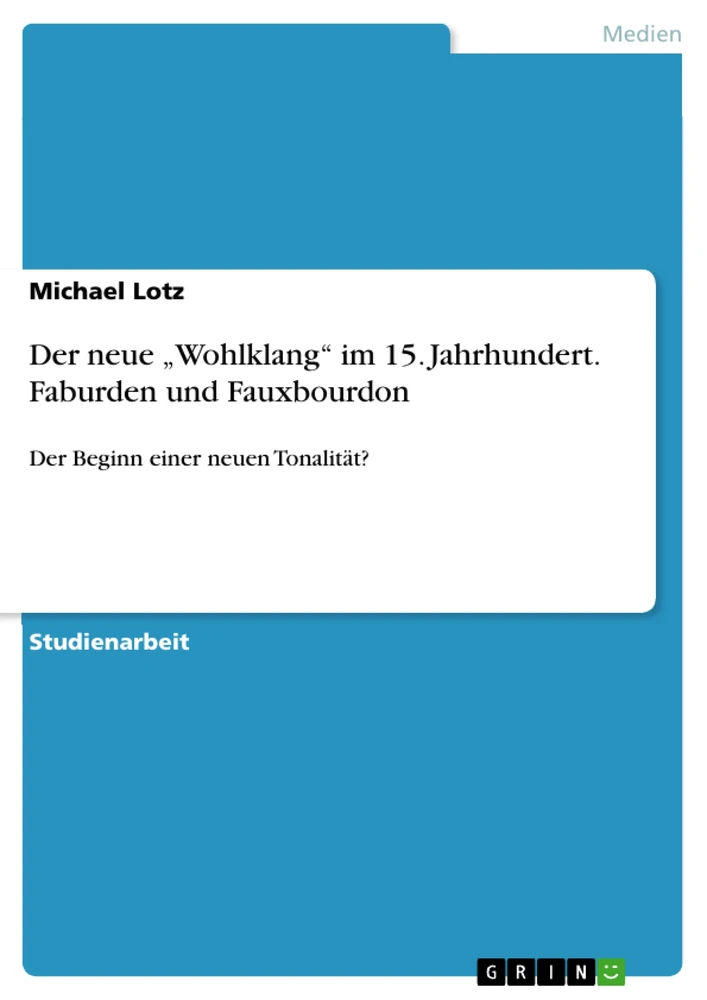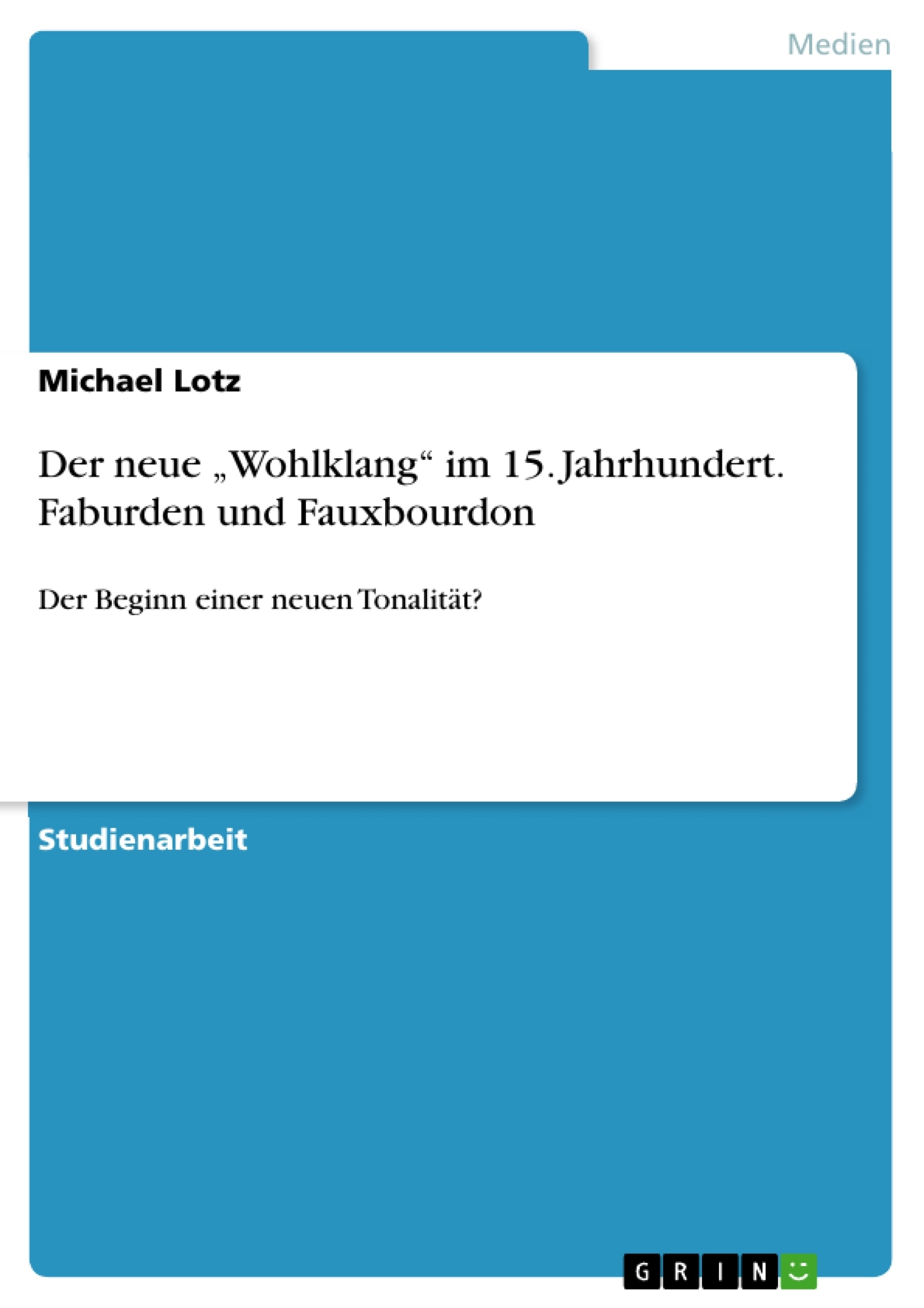Johannes Tinctoris und Musiktheoretiker aus dem 20. Jahrhindert belegen einen Zusammenhang zwischen den englischen Kompositionspraxen und der um die Jahrhundertwende 1430 aufkommenden niederländischen Satztechnik, genannt Fauxbourdon. Auf der anderen Seite verstehen Musiktheoretiker, wie Wolfgang Marggraf oder Hans-Otto Korth, die neuen flämisch-niederländischen Kompositionsweisen, geprägt durch neue tonale und satztechnische Ideen und den Fauxbourdon, als allgemein logische musikgeschichtliche Tendenz und lehnen den Einfluss eines sogenannten englischen „Wohlklangs“ ab. Unumstritten gilt jedoch eine kulturgeschichtliche Wende um 1430, die sich neben musikalischen Veränderungen auch in politische, gesellschaftliche und geistige Umwälzungen bemerkbar machte. So wurde der Übergang vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit begleitet von bahnbrechenden Entdeckungen vor allem Amerikas durch Kolumbus, der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg, sowie des Notendrucks. Desweiteren trugen eine zunehmende Auseinandersetzung mit antiken Vorbildern und Ideen und eine religiös geprägte Reformation zu einem völlig neu entstehenden Welt- und Menschenbild bei. Welche Einflüsse auf Komponisten der „franko-flämischen Schule“, von wo her die bedeutendsten Werke für die europäische Musikgeschichte stammen, wirkten und wie sie zeitgenössische Kompositionsregeln veränderten oder zu umgehen versuchten gilt es zu untersuchen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf geistlicher mehrstimmiger Musik, wie Messen, Motetten oder Hymnen und dementsprechend sind einschneidende Kompositionen Guillaume Dufays Dreh- und Angelpunkt dieser Diskussion.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklungen in England
- Der Faburden-Satz
- John Dunstable
- Das Fauxbourdonstück
- Dufay und der Fauxbourdon
- von der Quartfall-Klausel hin zur Dominant/Tonika-Wendung
- die dominantisch-tonale Entwicklund bei Machaut
- die Terminologie des Typus Fauxbourdon
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit widmet sich der Erforschung des „neuen Wohlklangs" im 15. Jahrhundert, der als entscheidender Schritt in der Entwicklung der Tonalität betrachtet wird. Die Arbeit analysiert die Einflüsse der englischen Musik auf die Entwicklung des Fauxbourdons und untersucht die Rolle von Komponisten wie John Dunstable, Guillaume Dufay und Gilles Binchois in dieser musikalischen Revolution.
- Der Einfluss des englischen Diskants und des Faburden-Satzes auf die Entwicklung des Fauxbourdons
- Die Entstehung des „neuen Wohlklangs" im 15. Jahrhundert und seine Bedeutung für die europäische Musikgeschichte
- Die Rolle von Komponisten wie John Dunstable, Guillaume Dufay und Gilles Binchois bei der Gestaltung des neuen musikalischen Stils
- Die Beziehung zwischen musikalischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Umbrüchen im Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit
- Die Analyse geistlicher mehrstimmiger Musik, insbesondere Messen, Motetten und Hymnen, im Kontext der neuen Klanglichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die These auf, dass die „alte“ Musik vor 1430 als „ungeschickt komponiert“ und „beleidigend für die Ohren“ galt. Der Musiktheoretiker Johannes Tinctoris beschreibt in seinem Werk „Proportionale musices“ eine musikalische Stilwende, die mit neuen frischen Zusammenklängen der jungen Komponisten in England einherging. Diese Wende wurde durch den Englischen Diskant und den Faburden, eine Improvisationstechnik, geprägt. Die Einleitung führt in die Thematik der „ars nova“ ein und zeigt die Bedeutung des „neuen Wohlklangs“ für die europäische Musikgeschichte auf.
Entwicklungen in England
Dieses Kapitel behandelt die musikalischen Entwicklungen in England im 14. und 15. Jahrhundert. Es wird der „Sommer-Kanon“ als Vorläufer des „neuen Wohlklangs“ vorgestellt und die Rolle des „Englischen Diskants“ und des Faburden-Satzes bei der Gestaltung der neuen Klanglichkeit erläutert.
Der Faburden-Satz
Das Kapitel beleuchtet den Faburden-Satz als Grundlage für die dreistimmige Form des Faburden. Es beschreibt die Technik und ihre Bedeutung für die Entwicklung der englischen Musik im 15. Jahrhundert.
Das Fauxbourdonstück
Das Kapitel befasst sich mit dem Fauxbourdonstück und seinen Verbindungen zum Englischen Diskant und dem Faburden. Es analysiert die Rolle von Komponisten wie Dufay in der Entwicklung des Fauxbourdons und untersucht die Entstehung der dominantisch-tonalen Wendung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Textes sind „neuer Wohlklang“, „Faburden“, „Englischer Diskant“, „Fauxbourdon“, „Guillaume Dufay“, „John Dunstable“, „Gilles Binchois“, „tonale Entwicklung“, „ars nova“, „musikalische Stilwende“ und „gesellschaftliche Umbrüche“. Diese Begriffe spiegeln die wichtigsten Themen und Konzepte der Arbeit wider und bilden den Rahmen für die Analyse der musikalischen Veränderungen im 15. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Wohlklang“ im 15. Jahrhundert?
Es bezeichnet eine neue musikalische Klangästhetik, die durch Terzen und Sexten geprägt war und die „härteren“ Klänge des Mittelalters ablöste.
Was ist der Unterschied zwischen Faburden und Fauxbourdon?
Faburden ist eine englische Improvisationstechnik, während Fauxbourdon die daraus entwickelte kontinentale Satztechnik (u.a. bei Dufay) bezeichnet.
Welche Komponisten prägten diesen neuen Stil?
Zentrale Figuren waren der Engländer John Dunstable sowie die franko-flämischen Komponisten Guillaume Dufay und Gilles Binchois.
Warum gilt das Jahr 1430 als kulturgeschichtliche Wende?
Um 1430 trafen musikalische Neuerungen auf gesellschaftliche Umbrüche wie den Buchdruck, die Renaissance-Ideen und später die großen Entdeckungsreisen.
Wie veränderte Fauxbourdon die Harmonik?
Die Technik führte weg von mittelalterlichen Quart-Klauseln hin zu dominantisch-tonalen Wendungen, was den Grundstein für die spätere klassische Tonalität legte.
- Quote paper
- Michael Lotz (Author), 2009, Der neue „Wohlklang“ im 15. Jahrhundert. Faburden und Fauxbourdon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158945