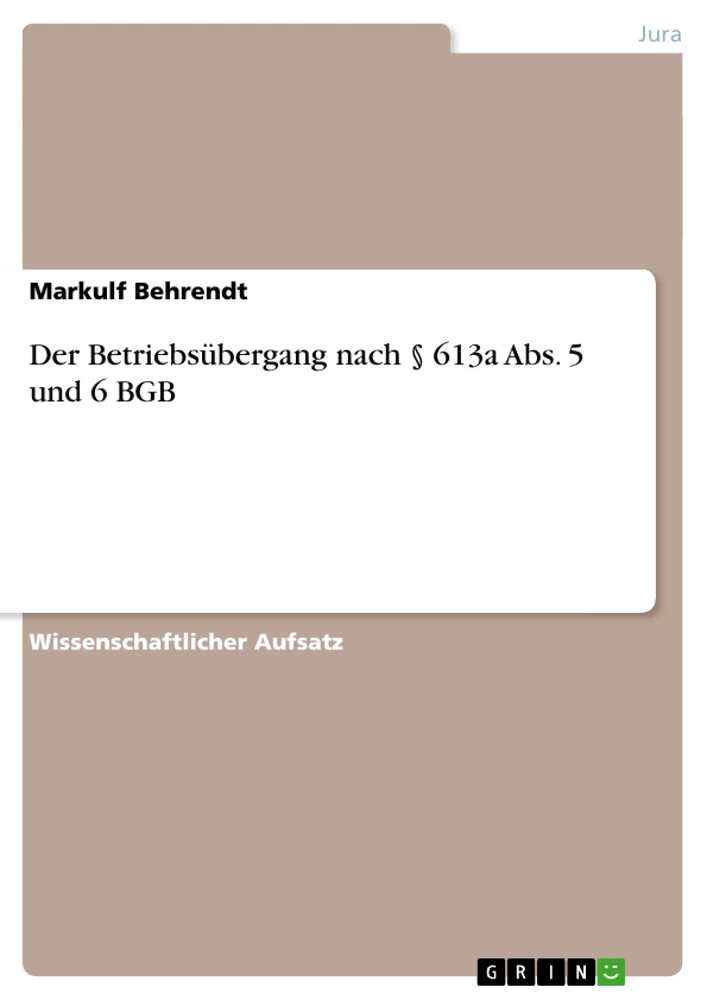Am 01. April 2002 trat das Gesetz zur Änderung des Seemannsgesetzes und anderer Gesetze in Kraft.1 Artikel 4 dieses Gesetzes sieht eine Änderung des § 613a BGB in der Form vor, dass diesem zwei neue Absätze 5 und 6 hinzugefügt werden.
Absatz 5 des neuen § 613a BGB normiert eine umfangreiche Unterrichtungspflicht des Erwerbers oder des Veräußerers bezüglich des (voraussichtlichen) Zeitpunkts und des Grundes für den Übergang, den für die Arbeitnehmer hieraus folgenden rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie über die diesbezüglich in Aussicht genommenen Maßnahmen. Absatz 6 beinhaltet die Kodifizierung eines Widerspruchsrechts der Arbeitnehmer gegen den Übergang des Arbeitsverhältnisses im Falle eines Betriebsübergangs.
Der Gesetzesbegründung zufolge stellt Absatz 5 die Umsetzung der Richtlinie 2001/23/EG vom 12. März 20012 dar, Absatz 6 normiert das bereits seit dem 02. Oktober 19743 die ständige Rechtsprechung des BAG und darauf auch die herrschende Meinung in der Literatur darstellende Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer im Falle eines Betriebsüberganges.4
Während auch der erste Blick auf den Normtext5 keine für die Praxis wesentlichen Veränderungen verrät6, lässt vor allem der zweite Blick auf die Regelung des Absatzes 6 wesentliche Gefahren für die Praxis erahnen. Hier nämlich findet sich die Verknüpfung der beiden Neuregelungen miteinander. Diese Verknüpfung des Widerspruchsrechts der Arbeitnehmer mit der Unterrichtungspflicht des (bisherigen oder neuen) Arbeitgebers führte dann noch während des Gesetzgebungsverfahrens zu Protesten sowohl in der Presse7 als auch von Landespolitikern und Wirtschaftsexperten.8 Von diesen wurde gar angedroht, das mitbestimmungspflichtige Gesetz im Bundesrat scheitern zu lassen.9 Nichtsdestotrotz sind die Neuregelungen am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Monats (Art. 10 des Gesetzes), dem 01. April 2002, in Kraft getreten. Die bislang erschienenen Stellungnahmen zu den Auslegungen sowie möglichen Auswirkungen gehen in ihren Einschätzungen und Interpretationen zum Teil weit auseinander.10
Im folgenden soll daher die Reichweite der Unterrichtungspflichten des Erwerbers und des Veräußerers eingehend untersucht werden. Dabei wird ein Schwerpunkt bei der Untersuchung der Frage gesetzt, in welcher Ausprägung und Intensität die Verknüpfung des Widerspruchsrechts mit der Unterrichtungspflicht „nach Absatz 5“ zu verstehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Die Neuerungen
- Die Informationspflicht des Veräußerers oder des Erwerbers
- Europarechtliche Grundlage
- Nationale Umsetzung
- Inhalt der Unterrichtungspflichten
- Der (geplante) Zeitpunkt des Übergangs
- Der Grund des Übergangs
- Rechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen
- Reichweite
- Wortgetreue Übernahme
- Erweiterte Auslegung
- Einschränkung
- Widerspruchsrecht
- Die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen
- Unmittelbar wirkende Maßnahmen
- Mittelbar wirkende Maßnahmen
- Zeitpunkt und Zugang der Information
- Information durch Veräußerer oder Erwerber
- Form der Unterrichtung
- Das Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer
- Das Widerspruchsrecht des BAG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses Textes ist es, die neuen Absätze 5 und 6 des § 613a BGB zu analysieren, die durch das Gesetz zur Änderung des Seemannsgesetzes und anderer Gesetze vom 01. April 2002 eingeführt wurden. Die Absätze regeln eine umfangreiche Unterrichtungspflicht des Erwerbers oder Veräußerers im Falle eines Betriebsübergangs und ein Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer gegen diesen Übergang.
- Reichweite und Inhalt der Unterrichtungspflicht
- Verknüpfung der Unterrichtungspflicht mit dem Widerspruchsrecht
- Auslegung und Anwendung des Widerspruchsrechts
- Verhältnismäßigkeit der neuen Regelungen
- Europarechtliche Grundlagen und nationale Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der neuen Informationspflicht des Veräußerers oder Erwerbers. Es werden die europarechtlichen Grundlagen der Regelung sowie die nationale Umsetzung der Informationspflicht im deutschen Recht dargestellt. Der Text beleuchtet den Inhalt der Informationspflicht, insbesondere hinsichtlich der zu erteilenden Informationen über den Zeitpunkt und den Grund des Übergangs, die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie die in Aussicht genommenen Maßnahmen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Umfang der Informationspflicht gewidmet, wobei verschiedene Auslegungen des Gesetzeswortlauts und die Frage nach der Verhältnismäßigkeit diskutiert werden.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer gegen den Betriebsübergang. Die historische Entwicklung des Widerspruchsrechts, die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und die europarechtliche Zulässigkeit des deutschen Widerspruchsrechts werden behandelt. Der Text beleuchtet die Beziehung zwischen dem Widerspruchsrecht und der Informationspflicht und analysiert die rechtlichen Folgen, die sich aus einer fehlerhaften oder mangelhaften Information ergeben.
Schlüsselwörter
§ 613a BGB, Betriebsübergang, Unterrichtungspflicht, Widerspruchsrecht, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Erwerber, Veräußerer, Europarecht, Rechtsprechung, Gesetzgebung, Vertragsfreiheit, Informationspflicht, Folgen, Zeitpunkt, Grund, Maßnahmen, Rechtsschutz, Sozialplan, Betriebsänderung, Umstrukturierung.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der § 613a BGB beim Betriebsübergang?
Er regelt den Übergang von Arbeitsverhältnissen auf einen neuen Inhaber sowie die Informationspflichten des Arbeitgebers und das Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer.
Worüber müssen Arbeitnehmer informiert werden?
Über den Zeitpunkt und Grund des Übergangs, die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie über geplante Maßnahmen für die Belegschaft.
Was ist das Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6 BGB?
Arbeitnehmer haben das Recht, dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach Erhalt der Unterrichtung schriftlich zu widersprechen.
Was passiert bei einer fehlerhaften Unterrichtung?
Eine unvollständige oder falsche Information kann dazu führen, dass die einmonatige Widerspruchsfrist nicht zu laufen beginnt, was für Unternehmen erhebliche Rechtsunsicherheit bedeutet.
Wer muss die Unterrichtung durchführen?
Die Pflicht zur Unterrichtung liegt entweder beim bisherigen Arbeitgeber (Veräußerer) oder beim neuen Inhaber (Erwerber).
Welche Rolle spielt das Europarecht?
Die Neuregelungen des § 613a BGB basieren maßgeblich auf der EU-Richtlinie 2001/23/EG zum Schutz von Arbeitnehmerrechten bei Betriebsübergängen.
- Citation du texte
- Markulf Behrendt (Auteur), 2003, Der Betriebsübergang nach § 613a Abs. 5 und 6 BGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15937