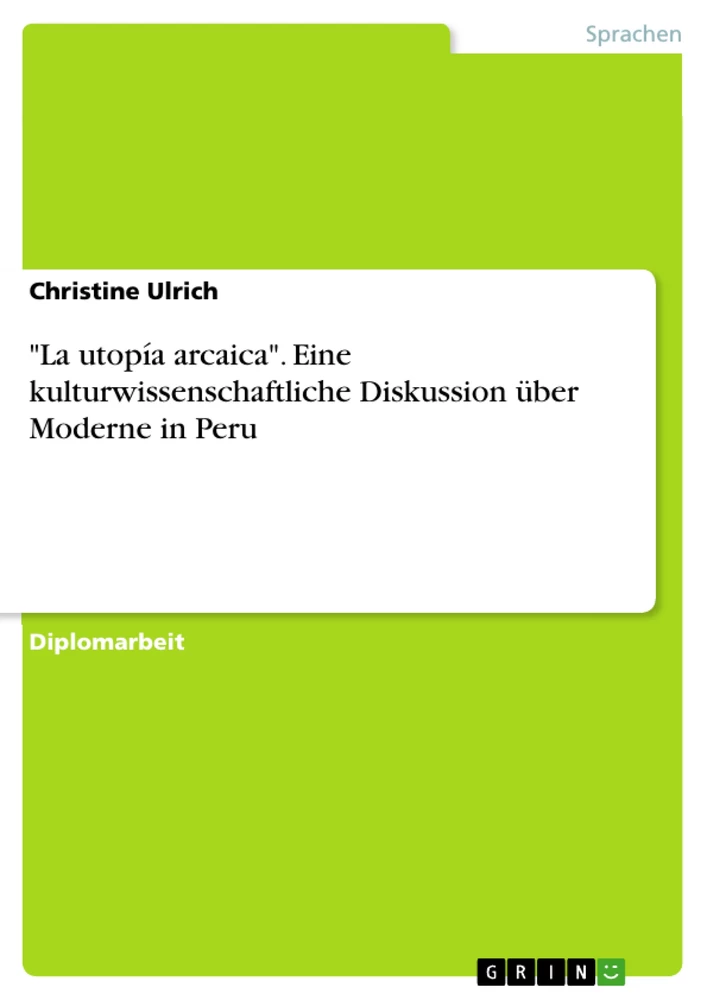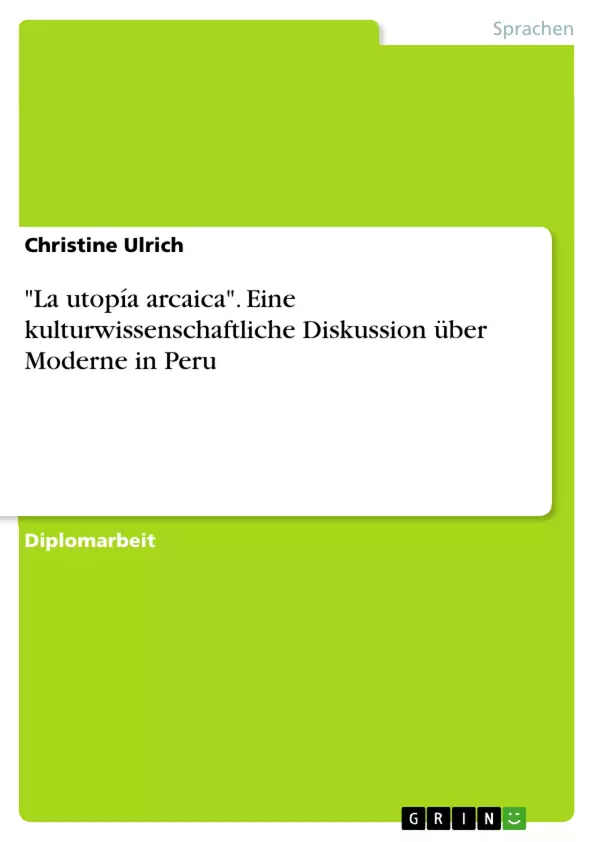Wie kann eine Moderne für Peru aussehen? Um diese Frage dreht sich die kulturwissenschaftliche Diskussion, mit der sich diese Arbeit beschäftigt. Dabei bedingt es die Historie, daß in Peru die Frage nach der Moderne viel stärker als in Europa einhergeht mit der Frage nach einer nationalen Identität, also auch der Frage nach den Traditionen und dem Indio.
Die aktuelle Diskussion hat sich insbesondere an der Position von Mario Vargas Llosa entzündet. Dessen Haltung auf literarischer wie politischer Ebene schlägt sich speziell in "La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo" (1996) nieder, einer Sammlung von Essays. Darin analysiert er das Werk des Schriftstellers Arguedas und gelangt zu dem Schluß, dessen Erzählkunst sei "eine schöne Lüge" – "die als archaische Utopie gelten kann, weil sie sich aus der Asche jener archaischen, ländlichen, traditionellen, magischen (im besten Wortsinn folkloristischen) Gesellschaft erhebt". Er meint, der Indio der arguedianischen Welt sei frei erfunden: weil Arguedas danach strebe, ihn von den Lastern der Moderne rein zu halten.
Zugleich macht Vargas Llosa seinen eigenen Standpunkt klar, was die Frage nach Indio und Moderne betrifft. Damit fordert er die Kritiker heraus, die nicht meinen, daß Arguedas' archaische Utopie eine Schimäre sei, und die andere Vorstellungen von einer möglichen Moderne für Peru haben.
Diese Arbeit stellt die Entwicklung der Diskussion vom Indigenismo über Arguedas bis hin zu Vargas Llosa und der Kritik an ihm dar. Dabei enthält der Begriff der "utopía arcaica" die gesamte Debatte, insofern er Bezug nimmt auf Moderne und Tradition. Man kann ihn als Oxymoron lesen: Das "Utopische" wird mit Künftigem und Wünschenswertem assoziiert, das "Archaische" mit Vergangenem und Überholtem.
Entsprechend ist diese Arbeit an diesem oxymoralen Begriff entlang aufgebaut. Zunächst werden die Begriffe "Utopie" und "archaisch" untersucht. Dann wird beschrieben, welche Formen die "archaische Utopie" in der peruanischen Literatur angenommen hat: Als Beispiel indigenistischer Romankunst wird "El mundo es ancho y ajeno" von Ciro Alegría analysiert, exemplarisch für den Neo-Indigenismo Arguedas' "Los ríos profundos". Danach wird Vargas Llosas umstrittene Position erörtert. Schließlich kommen zwei Kulturwissenschaftler zu Wort, die alternative Vorstellungen von einer Moderne vertreten: Antonio Cornejo Polar (Konzept der Heterogenität) und Néstor García Canclini (Begriff der Hybridität).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Zur Semantik
- 2.1 Utopie
- 2.1.1 Allgemeines zur Begriffsgeschichte
- 2.1.2 „Utopie“ als aktueller Diskurs
- 2.1.3 Utopien und Utopisches in Peru
- 2.1.3.1 Mythische Utopie
- 2.1.3.2 Historische Utopien
- 2.1.3.3 Politisch-ökonomische Utopien
- 2.1.3.4 Kulturell-literarische Utopien
- 2.2 Archaisch
- 2.2.1 Allgemeines zur Begriffsgeschichte
- 2.2.2 „Archaisch“ als „traditionell“
- 2.2.3 Archaisch-Traditionelles in Peru
- 2.2.3.1 Mythisches
- 2.2.3.2 Historisches
- 2.2.3.3 Politisch-Ökonomisches
- 2.2.3.4 Kulturelles
- 2.3 Oxymoron: Archaische Utopie
- 2.3.1 Mythos/Logos
- 2.3.2 Zyklisches / Lineares Zeitverständnis
- 2.3.3 Gemeinschaft / Gesellschaft
- 2.3.4 Vormoderne / Moderne
- 2.4 Bestimmung des Begriffs als Oxymoron
- 2.4.1 Kulturkonflikt und „archaische Utopie“
- 2.4.2 Auflösung des Oxymorons: Funktionalisierung der Begriffe
- 3. Literarische Formen der archaischen Utopie: Indigenismo und Neo-Indigenismo
- 3.1 Vorgeschichte und Vorläufer des Indigenismo
- 3.1.1 Zwei Schlüsselepochen: Conquista und 19. Jahrhundert
- 3.1.2 Der Proto-Indigenismo: Manuel González Prada
- 3.1.3 Hispanismo, Modernismo, Indianismo
- 3.2 Der Indigenismo
- 3.2.1 Der politische Indigenismo
- 3.2.2 Die Existenzbedingungen des Indigenismo
- 3.2.3 Der literarische Indigenismo
- 3.2.3.1 Definition und Entwicklung des literarischen Indigenismo
- 3.2.3.2 Luis E. Valcárcel: „Tempestad en los Andes“
- 3.3 Indigenistische Romankunst: „El mundo es ancho y ajeno“
- 3.3.1 Inhaltsangabe
- 3.3.2 Die Erzählsituation: Auktorialer Erzähler
- 3.3.3 Wichtige Figuren und innerer Aufbau des Romans
- 3.3.4 Zeit: Mythos und Geschichte
- 3.3.5 Raum: Comunidad und Nation
- 3.4 Der Neo-Indigenismo
- 3.4.1 Neo-Indigenismo als Begriff
- 3.4.2 Die Unterschiede zum orthodoxen Indigenismo
- 3.4.3 José María Arguedas: Die Biographie
- 3.4.4 José María Arguedas: Das Werk
- 3.5 Neo-indigenistische Romankunst: „Los ríos profundos“
- 3.5.1 Inhaltsangabe
- 3.5.2 Die Erzählsituation: Ich-Erzähler
- 3.5.3 Wichtige Figuren um den Protagonisten
- 3.5.4 Zeit: Erinnerung und Gegenwart
- 3.5.5 Raum: Geschlossenheit und Befreiung
- 3.5.6 Die Synthese: Ernestos magische Weltsicht
- 3.6 Vergleich der Romane nach Escajadillos Kriterien
- 4. Mario Vargas Llosa: „La utopía arcaica“
- 4.1 Mario Vargas Llosa: Geistiger Werdegang
- 4.1.1 Vorbilder und Weltbilder
- 4.1.2 Politische Romane und Literaturtheorie
- 4.2 „La utopía arcaica“
- 4.2.1 Rationalismus und Wissenschaftsgläubigkeit
- 4.2.1.1 Mythisches Denken als archaisch und irrational
- 4.2.1.2 Mythisches Denken als literarisches Mittel
- 4.2.1.3 Der „postmoderne“ Mythos
- 4.2.2 Fortschritt statt Rückblick
- 4.2.2.1 Zyklisches Denken als archaisch
- 4.2.2.2 Historische Wahrheit versus subjektive Geschichte
- 4.2.2.3 Linearität und Teleologie der Historie
- 4.2.3 Kapitalismus statt Kollektivismus
- 4.2.3.1 Kollektivistisches Denken als archaisch
- 4.2.3.2 Der Sozialismus - ein überholtes System
- 4.2.3.3 Der Neoliberalismus und die „informelle Wirtschaft“
- 4.2.4 Eine Moderne nach europäischem Vorbild
- 4.2.4.1 Die Ablehnung des Archaischen und des Utopischen
- 4.2.4.2 Modernisierung als unvereinbar mit der archaischen Utopie
- 4.2.4.3 Die homogenisierende Moderne
- 5. Kritik an Vargas Llosas Position
- 5.1 Cornejo Polar: Das Konzept der Heterogenität
- 5.1.1 „Escribir en el aire“
- 5.1.2 Der Beginn der Heterogenität
- 5.1.2.1 Versuche zur Homogenisierung
- 5.1.2.2 Die heterogene Modernisierung
- 5.1.2.3 Der indigenistische Roman
- 5.2 Néstor García Canclini: Das Konzept der Hybridität
- 5.2.1 Vormoderne, Moderne, Postmoderne
- 5.2.2 Der Begriff der Hybridität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der „archaischen Utopie“ im Kontext der peruanischen Moderne. Ziel ist es, die Spannungsfelder zwischen traditionellem und modernem Denken in der peruanischen Kultur zu beleuchten und anhand literarischer Beispiele zu analysieren.
- Die Semantik von „Utopie“ und „Archaisch“ in der peruanischen Gesellschaft
- Die literarische Darstellung der „archaischen Utopie“ im Indigenismo und Neo-Indigenismo
- Die Position von Mario Vargas Llosa zur „archaischen Utopie“
- Kritik an Vargas Llosas Position durch Cornejo Polar und García Canclini
- Das Verhältnis von Mythos, Tradition und Moderne in Peru
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein und legt die Forschungsfrage fest: Wie wird der Begriff der „archaischen Utopie“ in der peruanischen Literatur und Kulturwissenschaft diskutiert? Es skizziert den methodischen Ansatz und stellt die wichtigsten Autoren und Werke vor, die im Laufe der Arbeit analysiert werden.
2. Zur Semantik: Dieses Kapitel befasst sich mit der begrifflichen Klärung von „Utopie“ und „Archaisch“. Es untersucht die historische Entwicklung beider Begriffe und analysiert ihre Bedeutung im peruanischen Kontext. Dabei werden verschiedene Ausprägungen der Utopie (mythisch, historisch, politisch-ökonomisch, kulturell-literarisch) und des Archaischen (mythisch, historisch, politisch-ökonomisch, kulturell) untersucht und deren Interdependenz im Rahmen des Oxymorons „archaische Utopie“ erörtert. Das Kapitel beleuchtet den Kulturkonflikt, der durch dieses scheinbare Paradox entsteht.
3. Literarische Formen der archaischen Utopie: Indigenismo und Neo-Indigenismo: Dieses Kapitel analysiert den Indigenismo und Neo-Indigenismo als literarische Ausdrucksformen der „archaischen Utopie“ in Peru. Es untersucht die historischen Vorläufer dieser literarischen Strömungen und beleuchtet die zentralen Merkmale des Indigenismo und Neo-Indigenismo, sowohl im politischen als auch im literarischen Bereich. Detaillierte Analysen der Romane „El mundo es ancho y ajeno“ und „Los ríos profundos“ zeigen, wie traditionelle und moderne Elemente in diesen Werken miteinander verwoben sind und wie sie die „archaische Utopie“ literarisch gestalten.
4. Mario Vargas Llosa: „La utopía arcaica“: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Mario Vargas Llosas Sicht auf die „archaische Utopie“. Es präsentiert Vargas Llosas geistigen Werdegang und seine literaturtheoretischen Positionen, um seine Kritik am indigenistischen Diskurs und seiner Vorstellung von Moderne zu verstehen. Die Analyse von „La utopía arcaica“ offenbart Vargas Llosas Ablehnung des zyklischen Denkens, des Kollektivismus und des Utopischen als hinderlich für den Fortschritt und die Modernisierung nach europäischem Vorbild.
5. Kritik an Vargas Llosas Position: Dieses Kapitel präsentiert die Kritik an Vargas Llosas Position durch zwei bedeutende Kulturwissenschaftler: Cornejo Polar und García Canclini. Cornejo Polar argumentiert für ein Konzept der Heterogenität, das die Koexistenz und den produktiven Austausch von traditionellen und modernen Elementen betont, während García Canclini das Konzept der Hybridität einführt, um die Verschmelzung von Vormodernem, Modernem und Postmodernem zu beschreiben. Beide bieten alternative Perspektiven auf die Verhältnisse von Tradition und Moderne in Peru.
Schlüsselwörter
Archaische Utopie, Peru, Moderne, Indigenismo, Neo-Indigenismo, Mario Vargas Llosa, Cornejo Polar, García Canclini, Mythos, Tradition, Kollektivismus, Kapitalismus, Heterogenität, Hybridität, Kulturkonflikt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Archaische Utopie in der peruanischen Literatur"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Begriff der „archaischen Utopie“ im Kontext der peruanischen Moderne. Sie beleuchtet die Spannungsfelder zwischen traditionellem und modernem Denken in der peruanischen Kultur und analysiert diese anhand literarischer Beispiele.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Semantik von „Utopie“ und „Archaisch“ in der peruanischen Gesellschaft, die literarische Darstellung der „archaischen Utopie“ im Indigenismo und Neo-Indigenismo, die Position von Mario Vargas Llosa zu diesem Thema, Kritik an Vargas Llosas Position durch Cornejo Polar und García Canclini sowie das Verhältnis von Mythos, Tradition und Moderne in Peru.
Welche Autoren und Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zentrale Werke des Indigenismo und Neo-Indigenismo, insbesondere „El mundo es ancho y ajeno“ und „Los ríos profundos“, sowie Mario Vargas Llosas „La utopía arcaica“. Die theoretischen Positionen von Cornejo Polar und García Canclini werden kritisch diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Eine Einführung, ein Kapitel zur semantischen Klärung der zentralen Begriffe, ein Kapitel zur Analyse des Indigenismo und Neo-Indigenismo, ein Kapitel zu Vargas Llosas Position und ein abschließendes Kapitel zur Kritik an dieser Position. Jedes Kapitel umfasst eine detaillierte Zusammenfassung im Text.
Was sind die zentralen Begriffe und ihre Bedeutung?
Zentrale Begriffe sind „Archaische Utopie“, „Indigenismo“, „Neo-Indigenismo“, „Mythos“, „Tradition“, „Moderne“, „Kollektivismus“, „Kapitalismus“, „Heterogenität“ und „Hybridität“. Die Arbeit klärt die jeweilige Bedeutung dieser Begriffe im Kontext der peruanischen Kultur und Literatur.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wird der Begriff der „archaischen Utopie“ in der peruanischen Literatur und Kulturwissenschaft diskutiert?
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Methode, die sowohl textanalytische als auch begriffsanalytische Ansätze kombiniert. Sie analysiert literarische Texte und theoretische Positionen, um die Forschungsfrage zu beantworten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die komplexen Wechselwirkungen zwischen traditionellen und modernen Elementen in der peruanischen Kultur und Literatur. Sie diskutiert die unterschiedlichen Perspektiven auf das Verhältnis von Mythos, Tradition und Moderne und bewertet kritisch die Position von Mario Vargas Llosa.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Archaische Utopie, Peru, Moderne, Indigenismo, Neo-Indigenismo, Mario Vargas Llosa, Cornejo Polar, García Canclini, Mythos, Tradition, Kollektivismus, Kapitalismus, Heterogenität, Hybridität, Kulturkonflikt.
- Citation du texte
- Christine Ulrich (Auteur), 2004, "La utopía arcaica". Eine kulturwissenschaftliche Diskussion über Moderne in Peru, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159417