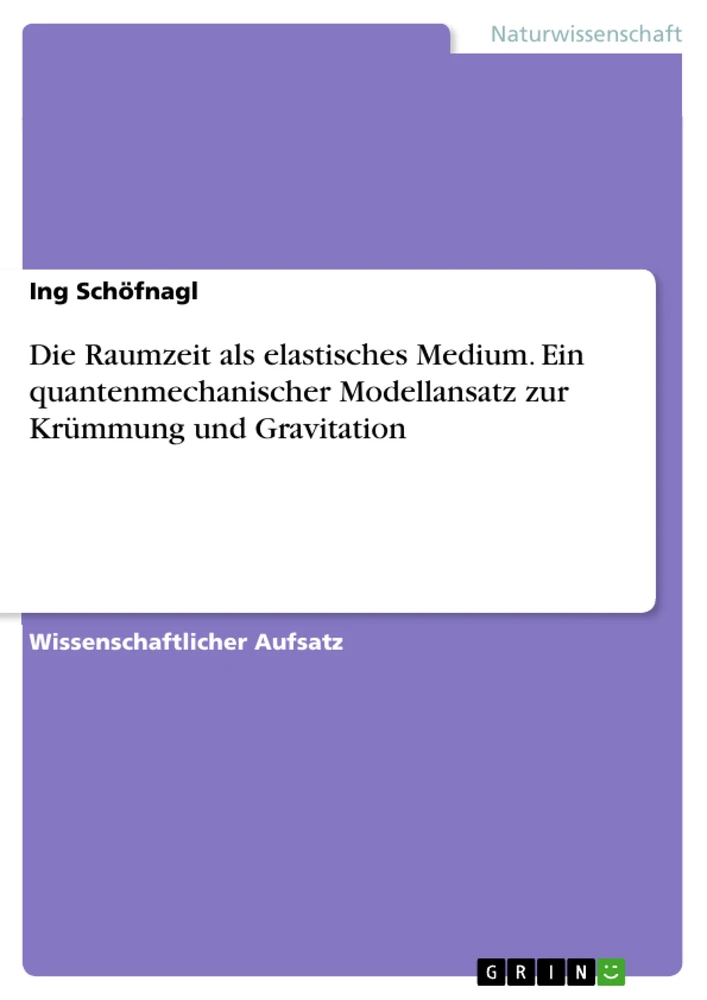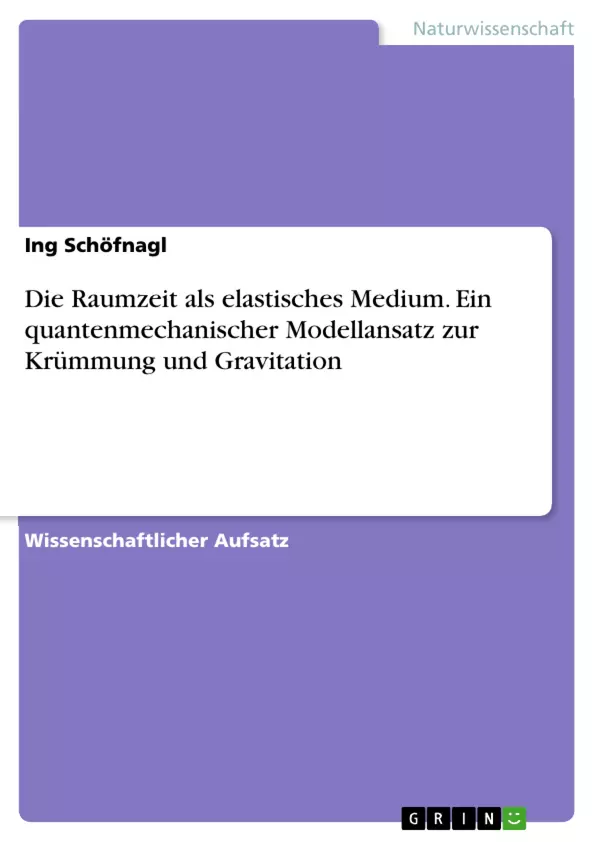In dieser Arbeit wird ein alternatives Modell der Raumzeit vorgeschlagen, das deren Struktur als ein elastisches, gelartiges Medium aus Raumquanten beschreibt. Diese Quanten interagieren über gerichtete, kurze Bindungskräfte und eine starke abstoßende Komponente auf kleinstem Skalenbereich, wodurch ein raumfüllendes, scherspannungsfähiges Netzwerk entsteht. Analog zu einem Polymergel speichert die Raumzeit Energie durch elastische Deformation – insbesondere im Umfeld extremer Gravitation.
Anstatt einer klassischen Singularität entwickelt sich bei dieser Betrachtung ein kontinuierlicher, differenzierbarer Krümmungsverlauf. Der Kretschmann-Skalar steigt im Inneren eines Schwarzen Lochs mit abnehmendem Radius stark an und divergiert in der Zentralsingularität bei r=0. Am Ereignishorizont ist er endlich und fällt außerhalb gemäß der Schwarzschildlösung mit wachsender Entfernung ab. Das vorgestellte Modell zeigt, wie mikroskopische Quantenkräfte zu einem makroskopisch elastischen Verhalten der Raumzeit führen und ermöglicht eine elegante Auflösung der Singularität bei gleichzeitigem Erhalt klassischer Lösungen im Außenraum.
Abstract
In dieser Arbeit wird ein alternatives Modell der Raumzeit vorgeschlagen, das deren Struktur als ein elastisches, gelartiges Medium aus Raumquanten beschreibt. Diese Quanten interagieren über gerichtete, kurze Bindungskräfte und eine starke abstoßende Komponente auf kleinstem Skalenbereich, wodurch ein raumfüllendes, scherspannungsfähiges Netzwerk entsteht. Analog zu einem Polymergel speichert die Raumzeit Energie durch elastische Deformation – insbesondere im Umfeld extremer Gravitation. Anstatt einer klassischen Singularität entwickelt sich bei dieser Betrachtung ein kontinuierlicher, differenzierbarer Krümmungsverlauf. Der Kretschmann-Skalar steigt im Inneren eines Schwarzen Lochs mit abnehmendem Radius stark an und divergiert in der Zentralsingularität bei r=0. Am Ereignishorizont ist er endlich und fällt außerhalb gemäß der Schwarzschildlösung mit wachsender Entfernung ab. Das vorgestellte Modell zeigt, wie mikroskopische Quantenkräfte zu einem makroskopisch elastischen Verhalten der Raumzeit führen und ermöglicht eine elegante Auflösung der Singularität bei gleichzeitigem Erhalt klassischer Lösungen im Außenraum.
1. Einleitung
Die klassische Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Raumzeitkrümmung [5] durch Masse und Energie, führt jedoch im Inneren Schwarzer Löcher zu mathematischen Singularitäten. In dieser Arbeit wird ein neues Modell vorgestellt, in dem die Raumzeit eine elastisch strukturierte Mikrobeziehung besitzt, bestehend aus Raumquanten. Diese verhalten sich ähnlich wie Polymerketten mit gerichteten Bindungen, die auf externe Spannungen mit rückstellenden Kräften reagieren.
2. Modellannahmen
Die Raumzeit besteht aus Raumquanten, die durch drei Kraftarten miteinander wechselwirken:
- eine stark abstoßende Kraft auf Kurzdistanz
- eine langreichweitende , schwache Bindungskraft zwischen Raumquanten
- eine gerichtete, sättigbare Polarbindung, analog zur Elektronenbindung. Diese Kombination erzeugt eine elastische Netzstruktur, in der lokale Spannungen durch Verschiebung oder Scherung aufgebaut und zurückgegeben werden können.
3. Herleitung der Kraft und Energie im Raumquantenmodell
- Abstoßende Kraft: F(r) = A₁ · r⁻⁹, A₁ = 10⁴
- Anziehungskraft 2: F(r) = A₂ · r⁻⁶, A₂ = –1
- Anziehungskraft 1: F(r) = A3· r⁻⁹, A3 =–1/9
- Diese Kräfte wurden willkürlich angenommen
- Winkelgewichtung über cos(θ) zur Projektion auf die Horizontalkomponente.
Die Rückstellkraft bei Verschiebung eines Raumquants gegenüber einer Quantenkette wurde berechnet, indem sämtliche Quantenkräfte auf das äußere Quant in Horizontalkomponenten zerlegt und aufsummiert wurden .Die berechnete Kraftverteilung zeigt ein nahezu sinusförmiges Verhalten -charakteristisch für elastische Systeme. Die folgende Abbildung zeigt den normierten Verlauf der Kraft und Energie (bzw. Krümmung) über der Verschiebung des externen Quants im bei einem Quantenabstand von 3.in der Kette.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Berücksichtigung vertikaler Kräfte und Einfluss auf die Rückstellkurve
In einer erweiterten Berechnung wurde berücksichtigt, dass bei der Verschiebung des externen Quants auch eine vertikale Kraftkomponente auftritt. Diese führt zu einer geringen Modifikation des vertikalen Gleichgewichtsabstands zur Kette, wodurch sich wiederum der effektive Winkel der Einzelkräfte leicht verändert. In der Summe zeigt sich, dass dadurch die Rückstellkraft geringfügig ansteigt, insbesondere in Bereichen größerer horizontaler Auslenkung. Der resultierende Verlauf der Rückstellkraft bleibt qualitativ sinusförmig, weist jedoch eine messbare Abweichung auf, die zu einer leichten Asymmetrie und einem verschobenen Maximum führen kann. Diese Unterschiede sind nicht auf numerisches Rauschen zurückzuführen, sondern lassen sich systematisch mit dem veränderten Kräftedreieck erklären. Dennoch bleibt der Gesamtcharakter des Modells – ein elastisch rückstellendes Verhalten mit endlicher Energie – auch unter Einbeziehung dieser Korrektur erhalten.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
4. Krümmungsmodell mit Kretschmann-Skalar und Quantenmodell
Die Energie (Krümmung) für das Quantenmodell wurde aus der Simulation der Verschiebung eines externen Quants gegenüber einer Quantenkette aus 500 linear .elastisch gebundenen Quanten errechnet.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung: normierter Kretschmann-Skalar K(x).mit zugeordneter quantenmechanischer Verschiebung (in % des Quantenabstandes in der Kette)
5.Krümmungsabweichung im Bereich großer Raumkrümmung und Übereinstimmung mit der ART
Die Berechnung des Kretschmann-Skalares im Raumquantenmodell zeigt eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) in Bereichen geringer Raumkrümmung – also bei großen Radien, deutlich über dem Schwarzschildradius (Rs). Für Vielfache von Rs im Bereich von etwa 10 bis 10⁶ ergibt sich zwischen beiden Modellen ein nahezu deckungsgleicher Verlauf der Raumkrümmung. Dies bestätigt, dass das Raumquantenmodell im Bereich der klassischen Tests der ART [5, 6] (z. B. Lichtablenkung im Gravitationsfeld der Sonne, Peripheldrehung des Merkur, Zeitdilatation in Satellitenbahnen) konsistent ist.
Erst im Bereich starker Raumkrümmung, d. h. unterhalb von etwa 10 Rs, treten systematische Abweichungen auf: Während die ART in diesem Bereich eine weiterhin steil ansteigende Krümmung vorhersagt (entsprechend der ∝1/R⁶-Skalierung des Kretschmann-Skalares), zeigt das Quantenmodell eine abgeflachte Krümmungskurve. Diese Abweichung lässt sich physikalisch mit den elastischen Rückstellkräften des Raumnetzwerks erklären, die im Modell als sinusähnlich verteilt angenommen werden. Die maximale Raumkrümmung tritt daher nicht an einer Singularität auf, sondern ist am Ereignishorizont (bei Rs) definiert und fällt innerhalb Rs wieder kontinuierlich ab.
Die Übergänge lassen sich durch eine skalierte Zuordnung der Quantenverschiebung zur normierten Kretschmann-Krümmung rekonstruieren. Die Übereinstimmung mit der ART außerhalb 10 Rs sowie die sanfte Abweichung im Bereich starker Gravitation legen nahe, dass das Quantenmodell nicht im Widerspruch zur ART steht, sondern deren Aussage bei extremen Bedingungen erweitert – ohne Singularitäten vorauszusetzen
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Erweiterter Raumkrümmungsverlauf im Raumzeit-Gelmodell
Im Rahmen des Raumquantenmodells, das die Raumzeit als elastisches Medium [7, 8, 9] mit diskreter Struktur auffasst, wurde der Verlauf der Raumkrümmung K(R_s) auf Basis der klassischen Schwarzschildlösung untersucht. Dabei wurde die Krümmung außerhalb des Ereignishorizonts durch eine empirisch gefittete Formel der Form K(R_s) = C / (R_s - R_0)^alpha beschrieben.
Da sich in diesem Modell der Ereignishorizont als mechanischer Strukturbruch der Raumzeit interpretieren lässt - analog einem Riss in einem Gel - wurde angenommen, dass sich die Raumkrümmung auf der Innenseite symmetrisch verhält. Dies bedeutet: der Krümmungsverlauf ist um R_s = 1 gespiegelt, fällt also auch im Inneren gegen R_s → 0 kontinuierlich gegen Null ab. Dies steht im Gegensatz zur klassischen Allgemeinen Relativitätstheorie, in der eine Divergenz (Singularität) auftritt. Diese Darstellung ist spekulativ, aber nicht unlogisch, wenn man Raumzeit als ein nichtlinear elastisches Medium interpretiert, in dem starke Krümmung und Brüche einer begrenzten Energieaufnahmefähigkeit unterliegen. Die symmetrische Raumkrümmung um den Ereignishorizont vermeidet die Singularität und liefert eine anschauliche Deutung im Sinne des Raumzeit-Gelmodells.
Abbildung: Symmetrischer Verlauf der Raumkrümmung K(R_s)
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
6. Überprüfbarkeit und Vorhersagekraft des Raumquantenmodells
Gravitationswellenereignisse bieten eine der wenigen Möglichkeiten [1, 2, 3, 11], die Dynamik starker Raumkrümmung experimentell zugänglich zu machen. Besonders im letzten Abschnitt des sogenannten 'Chirp'-Signals – der Phase unmittelbar vor der Verschmelzung zweier kompakter Objekte – tritt die Raumkrümmung in extremen Formen auf. Genau in diesem Bereich weicht das hier entwickelte Raumquantenmodell systematisch von den Vorhersagen der klassischen Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) ab.
Während die ART einen stetig beschleunigten Frequenzanstieg bis zur Singularität prognostiziert, postuliert das Raumquantenmodell eine natürliche Sättigung der Raumkrümmung am Ereignishorizont. Diese strukturelle Begrenzung führt zu einem abgeflachten Anstieg der Gravitationswellenfrequenz, der besonders bei der Verschmelzung sehr massereicher Schwarzer Löcher deutlich von der klassischen Prognose abweichen kann.
Da viele veröffentlichte Gravitationswellensignale durch Modellanpassung an klassische ART-Simulationen rekonstruiert wurden, können genaue numerische Vergleiche derzeit nicht unabhängig erfolgen. Dennoch lassen sich systematische Unterschiede identifizieren: Die ART beschreibt eine überproportionale Steigerung der Krümmung für Abstände kleiner als ca. 6-facher Schwarzschildradius (Rₛ), während das Raumquantenmodell in diesem Bereich eine deutlich flachere Entwicklung vorhersagt. Diese Abweichung wirkt sich direkt auf die Steilheit des Chirp-Signals aus und sollte prinzipiell durch hochpräzise Beobachtungen künftiger Ereignisse mit hoher Masse quantifizierbar sein.
Die Vorhersagekraft des Raumquantenmodells liegt somit weniger in der numerischen Nachbildung einzelner Ereignisse, sondern vielmehr in der andersartigen strukturellen Beschreibung des Krümmungsverlaufs. Diese Unterschiede sollten sich in den kommenden Jahren mit verbesserten Detektoren wie LISA [1, 2] oder der dritten Generation von Interferometern überprüfen lassen.
„Da die gegenwärtig publizierten Signalrekonstruktionen in hohem Maße durch ART-basierte Modellierung beeinflusst sind, bleibt der Spielraum für alternative Krümmungsmodelle wie das Raumquantenmodell methodisch stark eingeschränkt. Eine unabhängige, modellfreie Analyse könnte hier neue Einsichten ermöglichen.“
7. Q-Theorie (Quantenmodell) und Gravitationswellen
Die Q-Theorie postuliert, dass Raumquanten als masselose, bosonische Einheiten die Raumstruktur bilden. Bei dynamischer Raumkrümmung – wie bei der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher – werden diese Raumquanten periodisch verschoben. Diese Verschiebung erzeugt eine elastische Rückstellkraft, die sich wellenförmig durch das Medium der Raumquanten fortpflanzt – also eine Gravitationswelle.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Im klassischen Bild der ART wird die abgestrahlte Gravitationswellenenergie durch den quadratischen Verlauf des Strain-Signals beschrieben: E_GW ∝ h(t)^2 Die Energieabstrahlung erfolgt dabei vorrangig in der letzten Phase vor der Kollision – der sogenannten Inspiral-Phase.
Demgegenüber ergibt sich in der Q-Theorie der Energieverlauf aus dem Integral der Rückstellkraft über die Verschiebung x, die wiederum durch ein sinusartiges Verhalten beschrieben wird. Die Energie ist somit direkt an den Verschiebungsweg gekoppelt. Der Verlauf ergibt sich aus dem Zusammenhang: K(x) ∝ ∫F(x)dxAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieses Diagramm zeigt den Vergleich des erwarteten normalisierten Verlaufes des Strains der Q Theorie zu der derzeitigen Erwartung für BH Fusionen mit Spin 0 (Schwarzschild Mertrik) und Spin 0,9 (extreme Kerr Metrik).Wie erwartet ähnelt die Q Theorie der der heutigen Theorie für Fusionen von BHs ohne Spin ,weicht aber im letzten Bereich deutlich ab.
8. Unterstützung durch KI
Diese Arbeit wurde mit inhaltlicher und mathematischer Unterstützung von ChatGPT (OpenAI, 2025) erstellt. Dabei kamen automatisierte Kraftsimulation, Kurvenanpassung, Diagrammerstellung sowie strukturierte Textformulierung zum Einsatz. Die Autorenschaft, Strukturierung und wissenschaftliche Logik wurden durch den Nutzer geleistet, der Modellidee, Hypothesenbildung und Konzeption vollständig selbst entwickelt hat.
9. Fazit
Das vorgestellte Raumquantenmodell bietet eine alternative Sichtweise auf die Struktur der Raumzeit: Anstelle einer kontinuierlichen, klassisch-geometrischen Mannigfaltigkeit wird ein elastisch vernetztes Medium angenommen, dessen Mikrostruktur aus gerichteten, nichtlinearen Quantenbindungen besteht. Diese Struktur führt zu einem rückstellenden Verhalten unter Deformation und ermöglicht es, Raumkrümmung als Ausdruck gespeicherter elastischer Energie zu deuten.
Ein zentraler Vorteil des Modells liegt in der Vermeidung der klassischen Singularität: Die Raumkrümmung erreicht am Ereignishorizont ein Maximum und fällt innerhalb wieder ab, wodurch das Zentrum entlastet und die Divergenz beseitigt wird. Diese Interpretation ist mathematisch glatt und physikalisch plausibel.
Zusammenfassend liefert das Modell eine kohärente, überprüfbare Beschreibung der Raumzeitstruktur, die sowohl mit makroskopisch bekannten Lösungen als auch mit mikroskopischen Kräftemodellen vereinbar ist. Es eröffnet neue Wege zur Integration von Elastizität, Gravitation und möglicherweise auch Information im Rahmen eines quantisierten Raumzeitverständnisses.Weitere Arbeiten könnten sich auf analytischw Herleitungen,Veralgemeinerung für rotierende Systeme und eine Verknüpfung mit Tensorgrößen der ART konzentrieren.
10. Literatur
1. Lovelace, G. et al., Modeling the source of GW150914 with targeted numerical-relativity simulations, Class. Quantum Grav. 33, 244002 (2016). https://arxiv.org/abs/1607.05377
2. Abbott, B.P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), Reanalysis of the binary neutron star mergers GW170817 and GW190425, Class. Quantum Grav. 37, 045006 (2020). https://arxiv.org/abs/2001.01761
3. Abbott, B.P. et al., GW190521: A Binary Black Hole Merger with a Total Mass of 150 M⊙, Phys. Rev. Lett. 125, 101102 (2020). https://arxiv.org/abs/2009.01075
4. Schwarzschild, K., Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1916.
5. Einstein, A., Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie, Annalen der Physik 49, 769–822 (1916).
6. Misner, C.W., Thorne, K.S., Wheeler, J.A., Gravitation, W. H. Freeman, San Francisco, 1973.
7. Melissinos, A.C., Upper limit on the stiffness of space-time, arXiv:1806.01133 (2018). https://arxiv.org/abs/1806.01133
8. Tenev, D. and Horstemeyer, M.F., The Mechanics of Spacetime – A Solid Mechanics Perspective on General Relativity, 2020. https://www.researchgate.net/publication/342157159_The_Mechanics_of_Spacetime
9. Destrade, M., Jordan, P.M., Saccomandi, G., Scalar evolution equations for shear waves in incompressible solids, J. Nonlinear Sci. 23, 343–358 (2013). https://arxiv.org/abs/1302.0109
10. Eigene Simulationen und Modellanalysen basierend auf inverspotenziellen Quantenkräften und elastischer Raumstruktur, nicht veröffentlicht.
11. Thorne, K. S. (1987). Gravitational Radiation. In S. W. Hawking & W. Israel (Eds.), 300 Years of Gravitation.
11. Anhang Tabelle
Berechnung der Abweichung des Quantenmodells von der ART
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Formel für Näherung :Verschiebung=0,636619772367644*Kretschmann normiert ^0,5
[...]
- Quote paper
- Ing Schöfnagl (Author), 2025, Die Raumzeit als elastisches Medium. Ein quantenmechanischer Modellansatz zur Krümmung und Gravitation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1595582