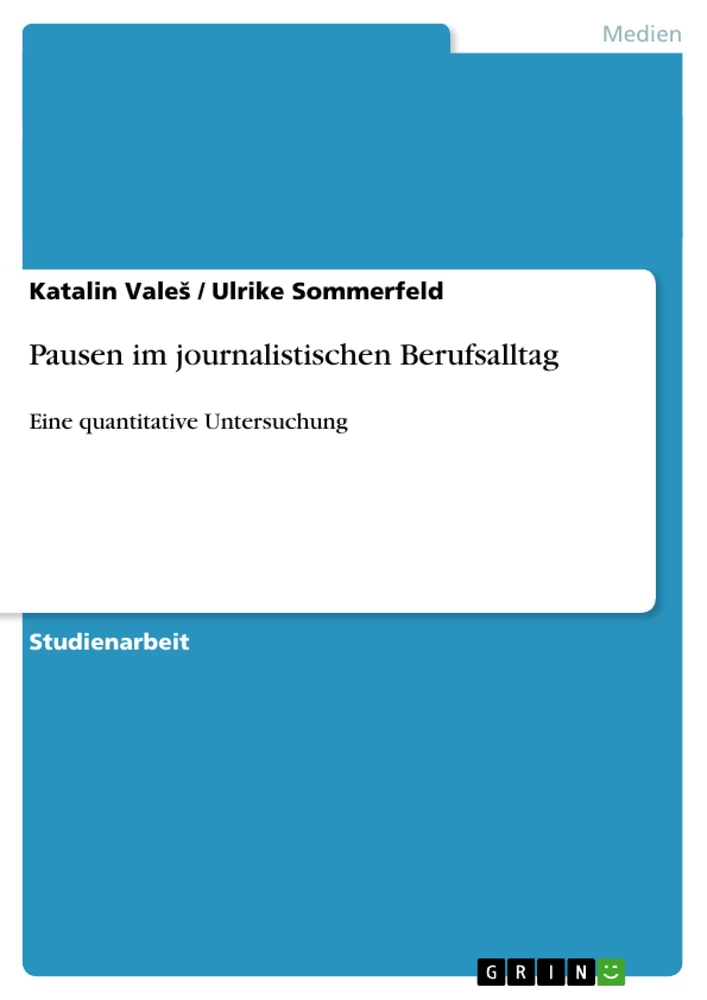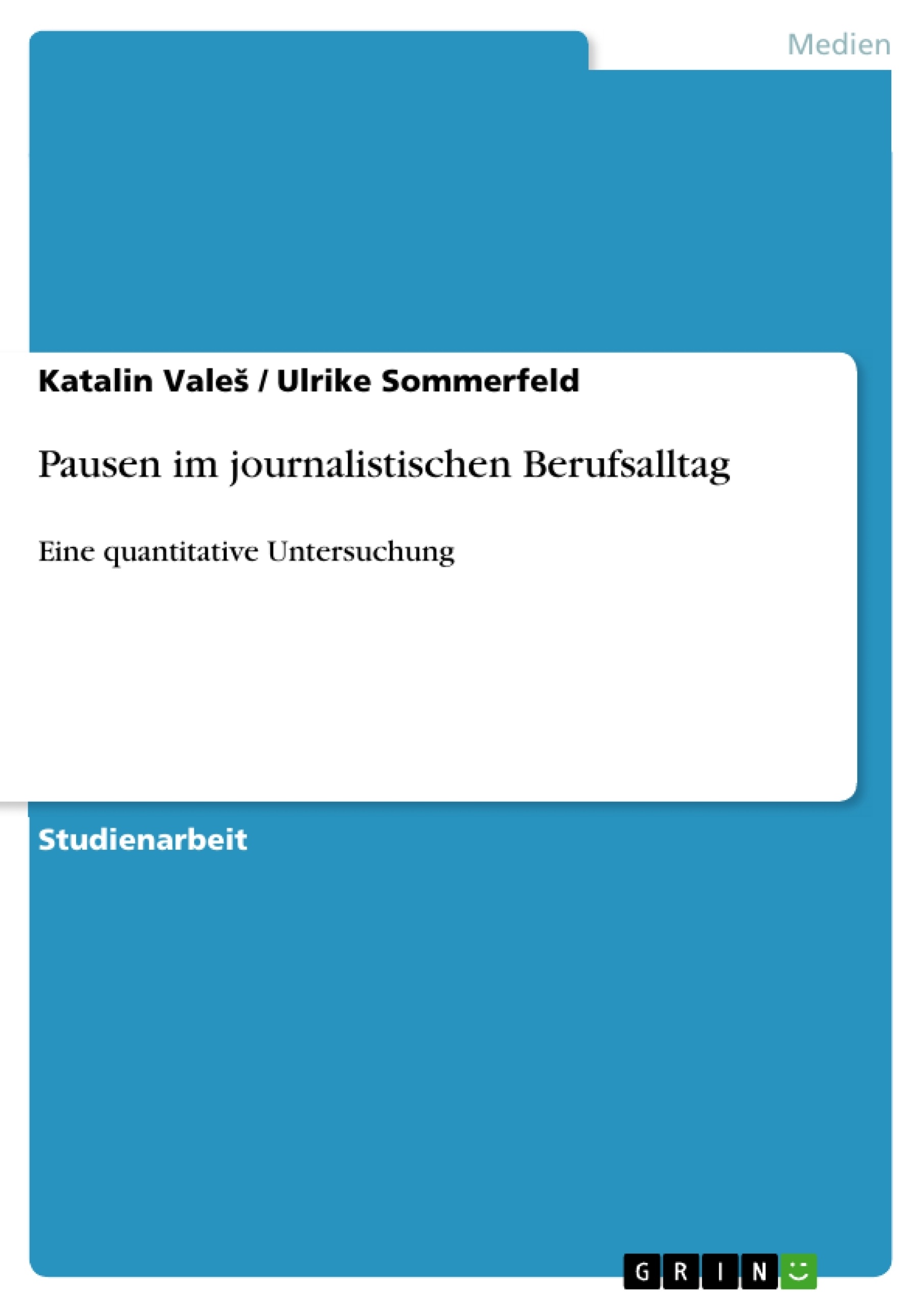Welche Einstellung haben Journalisten zu Pausen?
Wie verbringen Journalisten ihre Pausen?
Machen Journalisten überhaupt Pausen?
* * *
„Zeit sparen“, „keine Zeit haben“ und „keine Zeit verlieren zu wollen“ – das sind geflügelte Wörter unserer Zeit. Einer Zeit, in der man pausenlos von einem Termin zum nächsten hetzt und sich nicht die Zeit nimmt, sie auch mal zu genießen, sich selten eine Auszeit gönnt. Doch gerade die Auszeiten sind es, die das Leben lebenswert machen. Daher stehen sie im Zentrum der Betrachtungen dieser Studienarbeit. „Für Proust beispielsweise sind Auszeiten jene Momente, die unerwartet für die Dauer eines Blitzes ein kleines Quantum Zeit freizusetzen vermögen […]. Indem das Subjekt für einen Augenblick die Identität zwischen Gegenwart und Vergangenheit erfährt, steht es außerhalb der Zeit“ (Muri 2010, S. 65) – man könnte auch sagen, dass Subjekt macht dann eine Pause.
Zu Beginn der Auseinandersetzung mit dieser Arbeit haben wir Pausen in erster Linie als einen von vielen Aspekten im Zusammenhang mit Zeitmanagement betrachtet. Wer in der Lage ist, regelmäßig Pausen zu machen, kann sich seine Zeit gut einteilen und effizient arbeiten, so war unsere Vermutung – auch wir sind Kinder unserer Zeit. Doch „Pausen" sind weit mehr als ein „notwendiges Übel“ im Sinne des Zeitmanagements. Pause hat eine Geschichte und ist eng verbunden mit dem menschlichen Individuum und mit der Zeit. Wer denkt, keine Zeit für eine Pause zu haben, sollte dringend eine einlegen.
Doch wie sehen Journalisten das in einer Zeit, in der selbst die Sendepause abgeschafft wurde? Inzwischen ist das Burnout-Syndrom zur Volkskrankheit unserer pausenlosen Arbeitsgesellschaft geworden. Betroffen sind davon vor allem Menschen die unter großem Zeitdruck und Stress arbeiten, aber auch Menschen, die sich mit ihrem Beruf so sehr identifizieren, dass sie aufgrund von Übereifer, Verausgabung und enttäuschten Erwartungen irgendwann „ausbrennen“. Journalisten und Redakteure gehören an vorderster Arbeitsfront zu denen, die immer häufiger von diesem Krankheitsbild betroffen sind - und unter Umständen dadurch berufsunfähig werden.
Eine der Ursachen ist der Anspruch, Teil einer pausenlosen Gesellschaft sein zu wollen in der wichtig erscheint, wer seine Zeit nicht mit Nichtstun vergeudet und zu jeder Zeit für alles bereit ist. Doch: „Pausen sind nicht nichts“ (Geißler, Karlheinz, A. (2010), S. 92) sagt der Zeitforscher Karlheinz Geißler. Und er hat Recht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- TEIL A: BEDEUTUNG VON PAUSEN IN DER GESELLSCHAFT
- 1. Der Begriff "Pause"
- 1.1. Funktionen von Pausen
- 1.2. Größenordnungen von Pausen
- 2. Die Bedeutung von Pausen in der Gesellschaft
- 3. Die Arten von Pausen
- 3.1. Wochenende
- 3.2. Feiertage
- 3.3. Urlaub
- 3.4. Die Schulpause
- 3.5. Arbeitspausen im Berufsalltag
- 3.5. Zeitliche Einteilung von Arbeitspausen
- 3.6. Organisatorische Einteilung von Arbeitspausen
- 4. Die Entwicklung des Zeitverständnisses im Lauf der Geschichte
- 4.1. Formen der Zeit, des Zeitbewusstseins und des Zeitverständnisses
- 4.2. Historische Entwicklung von Zeit und Zeitbewusstsein
- 4.3. Zeitverständnis und -bewusstsein der Gegenwart
- 5. Die Rahmenbedingung für Pausen
- 5.1. Arbeit als Rahmenbedingung für Pausen (im Gegensatz zur Freizeit)
- 5.2. Definitionsansätze des Begriffs Arbeit
- 5.3. Arbeit in der römisch-griechischen Antike
- 5.4. Ambivalentes Arbeitsverständnis im Mittelalter
- 5.5. Beruf als Berufung - Arbeitsverständnis der Reformation
- 5.6. Arbeitsbegriff der bürgerlichen Gesellschaft
- 5.7. Arbeitsverständnis der Neuzeit
- 5.8. Zwischen Verwirklichung und „Entfremdung“
- 5.9. Arbeit im Schatten der Stoppuhr
- 5.10. Grundrecht auf Arbeit
- 5.11. Bedeutung von Arbeit in der Gegenwart
- 6. Die Geschichte von Pausen
- 6.1. Pause und Müßiggang im Mittelalter
- 6.2. Kritik am Müßiggang – Beispiel Martin Luther
- 6.3. Pausen im Fokus der Wissenschaft
- 6.4. Verordnete Pausen im 20. Jahrhundert
- TEIL B: CHRONOBIOLOGIE – PAUSEN UND DER BIOLOGISCHE RHYTHMUS
- 27. Der Ursprung der Chronobiologie
- 7.1. Die Bunkerexperimente
- 7.2. Die innere Uhr
- 7.3. Die verschiedenen Rhythmen des Organismus
- 8. Der Tagesrhythmus
- 8.1. Die persönliche Leistungskurve
- 8.2. Phasen des Tagesrhythmus
- 8.3. Der 90-Minuten-Rhythmus
- 8.4. Die Bedeutung der Tiefs
- 8.5. Was den Rhythmus stört
- 9. Ermüdung – wichtiger Indikator für den Zeitpunkt von Pausen
- 9.1. Ermüdung - eine Begriffsbestimmung
- 9.2. Ermüdungsarten
- 9.3. Messbarkeit von Ermüdung
- 10. Die Wirkung von Pausen auf den menschlichen Organismus
- 10.1. Verschiedene Einflussfaktoren
- 10.2. Pausen im Tagesrhythmus
- 10.3. Ermüdung vorbeugen statt bekämpfen
- 10.4. Pausen zur Regeneration und Erholung
- 10.5. Pausen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit
- 10.6. Bedingungen für Erholpausen I – Zeitpunkte und Dauer
- 10.7. Problematik willkürlicher und maskierter Pausen
- 10.8. Motivationseffekt durch regelmäßige Pausen
- 10.9. Grundhaltung auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
- 10.10. Soziale Funktion von Pausen
- 10.11. Einfluss der Kenntnis von Pausenwirkung
- 11. Die Gestaltung von Pausen
- 11.1. Pausenkultur
- 11.2. Pauseninfrastruktur
- 11.3. Pausenräume
- 11.4. Pausenernährung
- 12. Die Zielrichtung von Pausen
- 12.1. Pausenziele „Energie tanken“ und „Zur Ruhe kommen"
- 12.2. Pausenziele - „Etwas Anregendes machen“
- 12.3. Pausenziel – „Dampf ablassen"
- 12.4. Pausenziel „,Etwas Sinnvolles tun"
- 13. Einstellung zu Pausen
- TEIL C: IM ZENTRUM DER BETRACHTUNG: DER JOURNALIST
- 14. Definition "Journalist"
- 15. Tätigkeitsfelder: Wandel Rollen und Arbeitsweisen
- 15.1. Entwicklung des Journalismus im Radio
- 15.2. Studie "Journalismus in Deutschland II"
- 16. Rollenselbstverständnis des Journalistenberufs
- 16.1. Image von Journalisten in der Gesellschaft
- 16.2. Berufsmotivation und Rollenbilder
- 16.3. Aufgabenfelder von Journalisten
- 16.4. Idealistische Vorstellungen des Berufsbildes
- 16.5. Idealtypische, empirische und normative Rollenbilder
- 16.6. Das Selbstverständnis Deutscher Journalisten
- 16.7. Gesellschaftliche Einflüsse auf das Berufsbild
- 17. Zeit und Journalismus
- 18. Einfluss der Arbeitszeit auf Pausen
- 18.1. Tariflich geregelte Arbeits- und Pausenzeiten
- 18.2. Reelle Ausprägungen von Arbeitszeit
- 18.2. Zeitstrukturen von festen Redakteuren und freien Journalisten
- 19. Zeitmanagement von Journalisten
- 19.1. Exkurs: Links- und rechtshirniges Denken
- 19.2. Zeitdiebe im Journalismus – und wie man ihnen entkommt
- 20. Arbeitszufriedenheit von Journalisten
- 21. Motivationsstrategien und Arbeiten im Flow
- 21.1. Intrinsische Motivation
- 21.2. Motivation und Arbeit
- 21.3. Berufsarbeit und Flow
- 21.4. Zeitempfinden und Flow
- 21.5. Flow und Pausen
- 22. Stress und Burnout bei Journalisten
- 22.1. Wenn Stress krank macht - Burnout
- 22.2. Prävention
- TEIL D: EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
- 23. Untersuchung: Pausenverhalten von Journalisten
- 23.1. Methodik
- 23.2. Fragebogen
- 23.3. Fragestellung und Hypothesen
- 23.4. Untersuchungsgruppe
- 24. Datenerhebung und Datenanalyse
- 24.1. Soziodemografie
- 24.2. Besonderheiten der Stichprobe
- 24.3. Assoziationen in Bezug auf Pausen
- 24.4. Pausenverhalten der Befragten
- 24.5. Soziale Kontakte
- 24.6. Pausenorte
- 24.7. Pausenaktivitäten
- 24.8. Ernährung
- 24.9. Bedeutung von Pausen
- 24.10. Pausen beeinflussende Faktoren
- 25. Auswertung und Diskussion
- F1: Wie, wo und mit wem machen Journalisten Pause?
- F2: Gibt es einen Unterschied im Pausenverhalten zwischen Frauen und Männern?
- F3: Haben ältere Journalisten ein anderes Pausenverhalten als jüngere?
- F4: Hat das Arbeiten in einer bestimmten Redaktion oder einem bestimmten Medium Einfluss auf das Pausenverhalten?
- F6: Wie wirkt sich die Arbeitsweise von Journalisten auf deren Pausenverhalten aus?
- F7: Wirkt sich das Selbstverständnis von Journalisten auf deren Pausenverhalten aus?
- 26. Zusammenfassung
- 27. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie befasst sich mit dem Pausenverhalten von Journalisten. Sie untersucht die Bedeutung von Pausen im journalistischen Berufsalltag und analysiert die Faktoren, die das Pausenverhalten beeinflussen. Die Studie soll zu einem besseren Verständnis der Arbeitsbedingungen von Journalisten beitragen und Hinweise für die Gestaltung von Arbeitszeit und Pausen geben.
- Der Begriff "Pause" und seine Funktionen im Berufsalltag
- Der Einfluss von Chronobiologie und Tagesrhythmus auf das Pausenverhalten
- Die Bedeutung von Pausen für die Erholung, Regeneration und Leistungsfähigkeit von Journalisten
- Die Gestaltung von Pausen im journalistischen Berufsalltag
- Das Pausenverhalten von Journalisten in einer empirischen Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff "Pause" und erläutert die unterschiedlichen Funktionen von Pausen im Berufsalltag. Das zweite Kapitel widmet sich der Bedeutung von Pausen in der Gesellschaft und beleuchtet die historischen Entwicklungen des Zeitverständnisses. Das dritte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Arten von Pausen, insbesondere mit Arbeitspausen im journalistischen Berufsalltag. Das vierte Kapitel beleuchtet die Rahmenbedingungen für Pausen und analysiert die Bedeutung von Arbeit im Kontext der Pausen. Das fünfte Kapitel untersucht die Geschichte von Pausen und beleuchtet die Kritik am Müßiggang.
Schlüsselwörter
Journalismus, Pausen, Arbeitszeit, Chronobiologie, Tagesrhythmus, Ermüdung, Regeneration, Leistungsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit, Stress, Burnout, Empirische Untersuchung, Pausenverhalten, Zeitmanagement
- Citation du texte
- Katalin Valeš (Auteur), Ulrike Sommerfeld (Auteur), 2010, Pausen im journalistischen Berufsalltag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159767