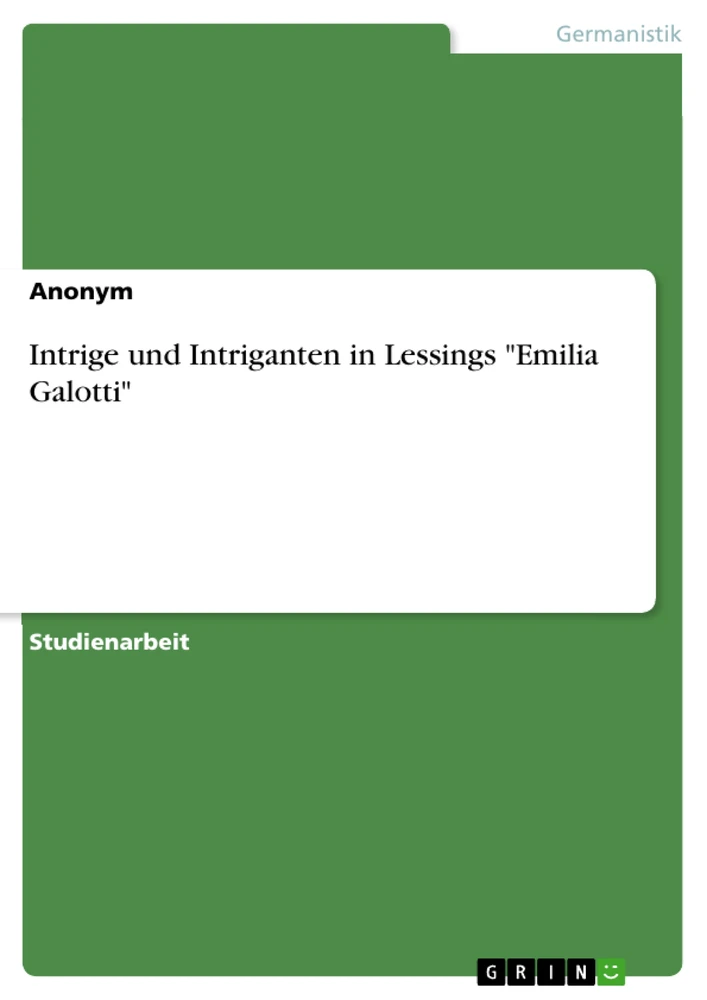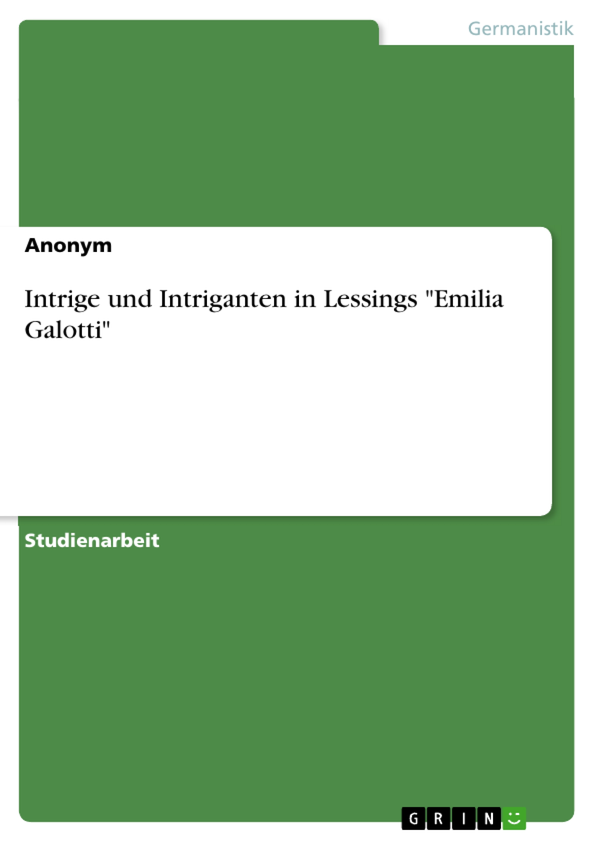Hinter höfischer Fassade entfaltet sich in Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti ein raffiniertes Spiel der Täuschung: Die Intrige wird zum zentralen Handlungsmotor, gesteuert von Figuren wie dem Kammerherrn Marinelli und der Gräfin Orsina. Diese Hausarbeit untersucht die Mechanismen und Merkmale der Intrige als dramatisches Konzept und analysiert, wie Lessing seine Intriganten als treibende Kräfte der tragischen Zuspitzung einsetzt. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem strategischen und rhetorischen Vorgehen der Figuren sowie ihrer Funktion innerhalb der höfischen Machtstruktur. Im Kontext aufklärerischer Ideale werden Marinelli und Orsina als Gegenentwürfe zu einem rationalen, moralisch handelnden Menschen dargestellt – Figuren, deren Handeln manipulativ, eigennützig und zutiefst unaufgeklärt bleibt.
Inhalt
1. Einleitung
2. Historischer Abriss: Intrige und Intrigant im Drama
2.1 Entwicklung der Figur des Intriganten seit dem 17. Jahrhundert
2.2 Merkmale und Funktionsweise der Intrige
3. Intriganten in Emilia Galotti: Marinelli und Orsina
3.1 Charakterisierung der Figuren
3.1.1 Marinelli
3.1.2 Orsina
3.2 Strategisches Vorgehen der Intriganten
3.2.1 Funktionsweise und Prinzipien der Intrige – Gemeinsamkeiten bei Marinelli und Orsina
3.2.2 Strategisches Kommunikationsverhalten des Marinelli
3.2.3 Strategisches Kommunikationsverhalten der Orsina
4. Die Intriganten in Emilia Galotti als Musterbeispiele für unaufgeklärtes Handeln
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Angenehm von Gestalt, lebhaft, witzig, und von Jugend auf am Hofe erzogen, war er gründlich in dem ganzen Umfange der Wissenschaften desselben unterrichtet. […] Alle seine Gebärden standen vollkommen in seiner Gewalt, und durch seine betrügliche Gesichtsbildung wurden auch die behutsamen verführt. […] [E]r kannte weder Religion noch Tugend, ob er gleich, wenn es die Nothwendigkeit erforderte, den Schein von beiden vollkommen gut anzunehmen wußte. […] Unter dem Schutz der Gnade seines Herrn, beging er die größten Ungerechtigkeiten, und schrieb die Schuld den Befehlen des Prinzen zu, welcher nicht ein Wort davon wußte. (Korn 1769, zit. nach Martens 1995: 75)
Mit dieser Charakterisierung wird nicht etwa der Kammerherr Marinelli aus Gotthold Ephraim Lessings Trauerspiel Emilia Galotti (Erscheinungsjahr: 1772) eingeführt, sondern der höfische Intrigant Herr von Scheingut im zweibändigen Roman Die tugendhafte und redliche Frau am Hofe in der Geschichte der Henriette von Rivera (Erscheinungsjahr: 1769) von Christoph Heinrich Korn. Obwohl die Werke des schwäbischen Schriftstellers heute größtenteils unbekannt sind, springen die Gemeinsamkeiten zwischen den Figuren des Marinelli und des Herrn von Scheingut schnell ins Auge. So sind beide u. a. hofkundig und klug, gelehrt in der Kunst der Verstellung und geschickt in der Beeinflussung des Herrschers und seiner Leidenschaften, wofür sie ihre Beraterrolle ausnutzen. Auch wenn es sich bei den Werken von Lessing und Korn um unterschiedliche Textgattungen handelt, so ist die Figur des höfischen gelehrten Intriganten gegen Ende des 18. Jahrhunderts in der deutschen Literatur doch weit verbreitet. In der folgenden Arbeit soll neben der Figur des Marinelli auch die intrigante Gräfin Orsina in Emilia Galotti untersucht werden. Beide Charaktere tragen mit ihrem Handeln als aktive Schlüsselfiguren zum tragischen Ende der Handlung bei; beide sind zudem die einzigen Hauptfiguren im Drama, die „unabhängig von der in den römischen Quellen umrissenen Konstellation [des Virginia-Stoffes] konzipiert wurde[n]“ (Martens 1995: 70). Nach einem knappen historischen Abriss über die Figur des Intriganten und seiner Entwicklung ab dem 17. Jahrhundert, das den Beginn der Blütezeit dieses Typus auf der deutschen Bühne markiert, sollen Wirkungsprinzip und Merkmale der Intrige kurz erläutert und anschließend die beiden Intriganten Marinelli und Orsina in den Fokus gerückt werden. Dabei wird auch auf den gemischten Charakter des Prinzen jeweils an geeigneter Stelle näher eingegangen. Nach den Charakterisierungen von Marinelli und Orsina soll das strategische Vorgehen der beiden untersucht werden. Dabei werden neben der Handlungsfunktion sowie dem Aufbau bzw. den Prinzipien ihrer Intrigen v. a. auch rhetorische Aspekte näher betrachtet – Lessing selbst kannte nicht zuletzt aufgrund seiner lebenslangen Begeisterung für die Kunst der Rhetorik die Macht von Worten und Überzeugungsstrategien. Zum Schluss soll das Verhalten der Figuren im Hinblick auf die Ideen der Aufklärung reflektiert werden, woran gezeigt werden soll, dass die Figuren Musterbeispiele für unaufgeklärtes Handeln darstellen.
2. Historischer Abriss: Intrige und Intrigant im Drama
2.1 Entwicklung der Figur des Intriganten seit dem 17. Jahrhundert
Seit der Konzeption der ersten literarischen Intrigantenfiguren bis hin zur Gegenwart ist es v. a. ein wiederkehrendes Merkmal, dass auf der Bühne Intriganten jeglicher Art miteinander verbindet: die Fähigkeit zur Verstellung. Im Zeitalter des Absolutismus prägen Verstellungsstrategien den sozialen Alltag und das politische Geschehen an den Höfen, wobei zunehmend Lehren vom klugen und angemessenen Verhalten des Hofmanns, die ursprünglich den Weg zu einem moralischen Vollkommenheitsideal bahnen sollten, zu „Anleitungen zu feiner Verstellung, zu opportunistischer Anpassung, zu egoistisch-amoralischem Handeln“ (Martens 1995: 75) werden. Bereits der Intrigant Iago verkörpert in Shakespeares Tragödie Othello (Erscheinungsjahr: 1604) die immer wachsende operative Freiheit und zunehmend unkontrollierbare Autonomie dieses Typus, er ist „Prototyp des autonom, im Zeichen des Selbstzwecks agierenden Intriganten, der – in verändertem Rollenkostüm – erst im Zeitalter der Aufklärung wieder auf die Theaterbühne zurückkehrt“ (Alt 2004: 21). Im barocken Trauerspiel des 17. Jahrhunderts, wie z. B. Lohensteins Agrippina (Erscheinungsjahr: 1665), das unter Verwendung von römischem Stoff neben religiösen Fragen auch Wollust, Grausamkeit, politisches Machtspiel und den Einfluss der Affekte auf den Menschen thematisiert, übernimmt der Intrigant eine weitere wichtige Funktion: Mehr noch als um die Thematisierung seiner persönlichen Handlungsmotivation geht es darum, dem Herrscher jegliche Skrupel vor einer vollumfänglichen Anwendung seiner Machtbefugnisse zu nehmen, zu der der Intrigant ihn u. a. durch die Verbreitung von Gerüchten und Misstrauen Schritt für Schritt treibt (vgl. ebd., S. 4).
Das bürgerliche Trauerspiel des 18. Jahrhunderts zeugt von der immer komplexer werdenden Struktur der Intrige, die nun in zunehmend systematischer Anwendung zur „Domäne der ‚Lasterhaften‘ [wird], die ihre Opfer mit einem Netzwerk von Verleumdung, Täuschung und Lüge umgarnen“ (Grzesiuk 2004: 73). Dabei steht neben der Figur des Herrschers auch die für das bürgerliche Trauerspiel typische Thematik der Unschuld bzw. Verführung einer jungen, als tugendhaft angesehenen Tochter (wie z. B. Sara in Lessings Miss Sara Sampson, Emilia in Emilia Galotti und Luise in Schillers Kabale und Liebe) im Mittelpunkt. In einem Umfeld, das von Besitzstreben, Korruption und Machtspielen am Hof, gekränkten Gegenspielerinnen und Mätressen, sowie dem Konflikt zwischen höfischen und bürgerlichen Werten geprägt ist, findet sich die Herrscherfigur im Einflussbereich eines Intriganten wieder, der in seiner Vorgehensweise und Rolle als Figur zunehmend hybrider wird: So ist beispielsweise Carlos in Goethes Trauerspiel Clavigo (Erscheinungsjahr: 1774) zugleich Ohrenbläser, Berater und Freund des leicht beeinflussbaren und schwachen Protagonisten, dem Herrscher Clavigo (vgl. Alt 2004: 17). Gerade die Ratgeberrolle ist Ansatzpunkt für den höfischen Intriganten, der eben nicht wie ein uneigennütziger Helfer handelt und an die Klugheit und Bedachtsamkeit des Herrschers appelliert, sondern in vielfältiger und berechnender Weise sein Gegenüber zu Gewaltanwendung und schnellem Handeln drängt, z. B. indem er den Herrscher auf dessen politische Macht hinweist, seine (nicht zuletzt auch erotischen) Leidenschaften verstärkt, sich auf soziale Normen beruft oder eben – wie in Clavigo – all diese und ähnliche Argumente kombiniert:
Die Deutungsmuster der Autonomie – Rückgriff auf die absolute Freiheit des Ich – und der Heteronomie – Subordination unter die Gesetze des sozialen Systems – dienen in Carlos’ Ausführungen jeweils dazu, Clavigo aus unterschiedlichen Perspektiven eine carte blanche für unbeschränkten Selbstgenuß auszustellen. (Alt 2004: 19)
Der Typus der Intrigantin, der im Drama deutlich später als im Roman auftaucht, wurde von dem Idealbild der gelehrten Frau, das sich im Zusammenhang mit der Frühaufklärung ausbildete, sich allerdings nur für wenige Jahre gesellschaftlich gegen die Vorstellung vom empfindsamen Ideal der schönen weiblichen Natur durchsetzen konnte, stark beeinflusst. Die Intrigantin, „die eigenen Ehrgeiz auf die im Zentrum stehenden männlichen Akteure überträgt“ (Alt 2004: 14) und vom inneren Zentrum der Macht grundsätzlich ausgeschlossen ist, taucht vorwiegend in der Rolle der Ohrenbläserin und Antreiberin auf der Bühne auf, wobei sie erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts als Figur mit stark ausgeprägten individuellen Zügen und größeren Spielräumen auftritt.1 Obwohl ihre Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme reduziert sind, gelingt es weiblichen Intrigantenfiguren wie der Gräfin Terzky aus Schillers Dramen-Trilogie Wallenstein (Erscheinungsjahr: 1800) dennoch, in kalkulierter und subtiler Weise, die Schwäche ihres Gegenübers ausnutzend, Einfluss auf das Handlungsgeschehen zu nehmen. Die dabei von den Intrigantinnen verwendete Argumentationsweise ist nicht neu:
Charakteristisch ist hier die Gräfin Terzky aus Schillers Wallenstein -Trilogie (1800), die ihre weitgespannten Pläne nur mit Hilfe ihres Schwagers verwirklichen kann. So erscheint sie als Wallensteins Beraterin, die, anders als seine Ehefrau, die dünne Luft der Macht nicht nur erträgt, sondern sogar genießt. Es ist bezeichnend, daß die Gräfin […] auf psychologisch subtilere Weise jenen Typus von Argumenten nutzt2, mit dem der intrigante Berater im Trauerspiel des 17. Jahrhunderts den Herrscher an seine grenzenlose Handlungsfreiheit zu erinnern pflegte, um sein Gewissen stillzustellen. (Alt 2004: 15)
Im Drama von Lessing und Schiller wird auf die Darstellung eines abgrundtief und unergründlich boshaften Intriganten grundsätzlich verzichtet, auch wenn negative Charakterzüge, v. a. bei der männlichen Intrigantenfigur, deutlich überwiegen. Mätressen wie Marwood, Orsina oder Milford sind „ebensowenig nur lasterhaft […] wie die tugendhaften Heldinnen Sara, Emilia und Luise nur tugendhaft sind“ (Stephan 1985: 10), und auch der aus eigennützigen Motiven handelnde höfische Intrigant ist von einem Klima der Verstellung beeinflusst, in dem Konkurrenz um den größtmöglichen Machteinfluss, fein abgestimmte Lehren vom richtigen Verhalten im Umgang mit anderen sowie verschwenderische und glanzvolle Repräsentationskultur den Alltag bestimmen. Zudem lässt sich feststellen, dass nur selten in Lessings Dramen „eine einzelne mit List ausgestattete Figur die Regie über das Spiel der Veränderung [führt], in den Lustspielen nicht weniger als in den Trauerspielen“ (Memmolo 1995: 153), und dass v. a. dort, wo dies doch der Fall ist, der gewünschte Erfolg nicht eintritt: „Die getäuschte Absicht oder die kluge Machination ruft meistens die den Absichten entgegengesetzte Wirkung hervor. Ein Vorgreifen auf Künftiges, das absichtsvoll, durch das Tun der anderen in die Wege geleitet wird, bewährt sich in den seltensten Fällen.“ (ebd.).
2.2 Merkmale und Funktionsweise der Intrige
Die Intrige – gesteuert durch einen Intriganten, der als destabilisierender Akteur3 und Beobachter zugleich auftritt – verändert „Kommunikations- und Interaktionszusammenhänge“ (Alt 2004: 1) zwischen den einzelnen Figuren fundamental. „Durch die intriganten Figuren besonders werden Umwege gesteckt, die eine mögliche Aussöhnung und Verständigung der Figuren untereinander retardieren.“ (Memmolo 1995: 156). Dabei operiert der Intrigant im Rahmen einer „Handlungsfreiheit […], die er sich gegenüber externen Ordnungen – der Moral, der Religion oder des Rechts – zueignet“ (Alt 2004: 2). Die Intrige des Trauerspiels zeichnet sich durch einen „drängenden Dezisionismus“ (ebd., S. 6) aus, durch den der Intrigant Zeitnot suggeriert und auf unverzügliches Handeln drängt. Das vernünftige Abwägen aller Argumente ist dabei nicht in seinem Sinne, vielmehr soll das „Urteilsvermögen des Herrschers außer Kraft [gesetzt werden]“ (ebd.). Die sich so entwickelnde Eigendynamik der Intrige, mit der die Ereignisse rasant ihren Lauf nehmen, erschwert es oft, den Urheber der Intrige auszumachen und das Komplott in seinem gesamten Ausmaß rechtzeitig zu durchschauen. Der Intrigant muss sich stets seinem Gegenüber anpassen, was sich beispielsweise bei der Art des Herrschers, den es zu manipulieren gilt, zeigt: Bei Lessing, wo sich Marinelli nicht einem „barocken Despoten“ gegenübersieht, sondern einem „leidenschaftlich-empfindsame[n] Souverän“, der ein zumindest ambivalenteres Verhältnis zur Anwendung von Gewalt hat, zählt jetzt nicht mehr vorrangig „die Stimulation der fürstlichen Gewaltpotentiale“, sondern die Entwicklung einer „Ereignisinszenierung […], die es dem Souverän gerade ersparen soll, als Machthaber aufzutreten“ (ebd., S. 8).
3. Intriganten in Emilia Galotti: Marinelli und Orsina
3.1 Charakterisierung der Figuren
3.1.1 Marinelli
Der Marchese Marinelli bringt die Katastrophe mit dem Auftrag zum Überfall der Hochzeitskutsche, der in der Entführung Emilias und dem Mord an deren Bräutigam Appiani resultiert, erst ins Rollen. Als Intrigant, der innerhalb der höfischen Sphäre operiert, „verkörpert [er] das Schurkische und Negative des höfischen Lebens und der politischen Klugheit“ (Memmolo 1995: 179). Interessanterweise ist es genau die Figur des Marinellis, der Monika Fick (2010: 399) eine „rein funktionale Rolle“ zuschreibt – und wir erfahren in der Tat wenig über seine genauen persönlichen Motive4 – von der im Stück von allen Beteiligten (wenn auch – wie im Fall des Prinzen – nicht immer durchgehend) ein negatives Charakterbild gezeichnet wird: Claudia, die Mutter Emilias, nennt ihn einen „feige[n], elende[n] Mörder“ und „Kuppler“, der von „ehrlichen Mörder[n]“ niemals geduldet werden würde (III/8, S. 53)5, da er in feiger Art und Weise die Umsetzung seiner Gewaltpläne an andere Akteure überträgt. Orsina, die gekränkte ehemalige Geliebte des Prinzen Hettore Gonzaga, stellt ihn als Sünder dar, der „verdammt“ sei (IV/5, S. 65). Graf Appiani schimpft ihn in einem Streitgespräch einen „Affe[n]“ (II/10, S. 38). Nicht zuletzt der Prinz selbst, den Marinelli als Mittel zum Zweck missbraucht, erkennt in immer wieder aufblitzenden Momenten der Einsicht, die jedoch – wie bei Emilias Vater Odoardo – nicht von langer Dauer sind, den „treulos[en]“ und „hämisch[en]“ Charakter seines Kammerherrn, an dessen aufrichtiger Freundschaft er starke Zweifel hegt: „Nur dass Sie, Marinelli, der Sie so oft mich Ihrer innigsten Freundschaft versicherten – O ein Fürst hat keinen Freund! kann keinen Freund haben!“ (I/6, S. 16). In der Tat sind für Marinelli ehrliche freundschaftliche Verhältnisse wenig wert, vielmehr steht bei ihm die rigorose Durchsetzung von strategischer Klugheit an erster Stelle: „Vorwärts! denkt der Sieger: es falle neben ihm Feind oder Freund.“ (V/1, S. 75). Im menschlichen Umgang sieht er „illusionslos ein Verhältnis, das nach Vorteilen und Nachteilen, Mittel und Zweck nüchtern, das heißt spielerisch strategisch zu gestalten ist“ (Memmolo 1995: 181). So sieht er z. B. in den Geliebten des Prinzen nicht mehr als Waren, die es sich anzueignen und zu Nutze zu machen gilt: „Waren, die man aus der ersten Hand nicht haben kann, kauft man aus der zweiten: – und solche Waren nicht selten aus der zweiten um so viel wohlfeiler.“ (I/6, S. 17).
Seine Haltung zum Mätressenwesen, das an fast allen deutschen Höfen gang und gäbe war, ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie sehr Marinellis Verhalten von der höfischen Perspektive geprägt ist, die er geradezu verinnerlicht hat. Auch die Verwirklichung einer empfindsamen, ständeübergreifenden Liebe, wie etwa zwischen einem adligen Bräutigam Appiani und einem bürgerlichen Mädchen Emilia, hält er für lächerlich und ein Zeichen von Schwäche: „Die Liebe spielet ihnen [den Empfindsamen] immer die schlimmsten Streiche. Ein Mädchen ohne Vermögen und ohne Rang hat ihn in ihre Schlinge zu ziehen gewusst, – mit ein wenig Larve: aber mit vielem Prunke von Tugend und Gefühl und Witz, – und was weiß ich?“ (I/6, S. 14, Herv. d. Verf.). Dabei kommentiert er mit einem für ihn charakteristischen sarkastischen Unterton die Pläne Appianis: „Denn soviel ich höre, ist sein Plan gar nicht, bei Hofe sein Glück zu machen. – Er will mit seiner Gebieterin nach seinen Tälern von Piemont: – Gämsen zu jagen, auf den Alpen; und Murmeltiere abzurichten. – Was kann er Besseres tun?“ (ebd.). In Marinellis Welt haben gesellschaftliches Ansehen, Standesbewusstsein und die Kontrolle über die eigenen Affekte Vorrang vor Werten der Empfindsamkeit, Toleranz und Selbstgenügsamkeit, deren gesellschaftliche Verbreitung eine Gefahr für ihn als Höfling darstellt, der er sich durchaus bewusst ist:
Die Kultivierung des Eigenmenschlichen, der Subjektivität, und die Verabsolutierung des bürgerlichen Ich sowie die Kultivierung des Allgemeinmenschlichen, der Humanität, stufen sozial den Hofadel herab, ja verstoßen Hofadlige und deren Lebensführung aus der Gesellschaft. […] [Marinelli] erkennt […] die Gefahr, die von dieser Umwertung der Werte ausgeht, die ihn als Höfling existentiell betrifft. Die Steigerung des Menschlichen, die sich im natürlichen Prunk von Tugend und Witz widerspiegelt, bewirkt nicht nur die Egalität der Menschen, sondern auch und vor allem eine Superiorität des Bürgertums. Den Preis, den der Hofadel für den Übergang von der höfischen zur bürgerlichen Gesellschaft zu entrichten hat, weiß Marinelli sehr genau einzuschätzen. (Schenkel 1986: 168 f.)
Marinellis Verhalten im gesamten Stück ist gekennzeichnet durch Heuchelei und Verstellung. Obwohl sein Verhältnis zu Appiani keineswegs freundschaftlich war und er selbst hinter dem Tod des Grafen steckt, heuchelt er in lügnerischer Weise vor Odoardo und dem Prinzen tiefe Bestürzung über die Tat: „Sie wissen, gnädiger Herr, wie sehr ich den Grafen Appiani liebte; wie sehr unser beider Seelen ineinander verwebt schienen –“ (V/5, S. 79). Der Intrigant ist sich der Wichtigkeit des beherrschten Auftretens sowie der präzisen Beobachtung seines Gegenübers6 im Alltag, aber auch für das Gelingen seiner Pläne, bewusst; sowohl Mimik als auch Tonfall seines Gesprächspartners versucht er möglichst genau zu interpretieren.7 Auch auf eine schnelle Kombinationsgabe8 und gewisse Menschenkenntnis, v. a. in rasanten Situationen, in denen zum Abwägen aller Optionen nicht mehr viel Zeit bleibt9, verlässt er sich in seinen Aktionen. Gute Vorbereitung sieht er als essentiell an, so weiß er lange vor dem Prinzen schon über alle Details zur Trauung von Appiani und Emilia Bescheid (vgl. I/6, S. 16). Gefühle und Affekte drückt er in spielerisch berechnender Weise aus, wobei er einen authentischen Eindruck auf seinen Dialogpartner machen will: „Er simuliert Zorn und Beleidigung, wenn man seinem Wort mißtraut, und dissimuliert seine Gemütsbewegungen und Absichten, um sein Gegenüber in die Irre zu führen.“ (Memmolo 1995: 180). Wenn er einmal – wie im Gespräch mit Appiani (vgl. II/10, S. 37 f.) – spontane, nicht bewusst kalkulierte Regungen zeigt, so sind es lediglich „die der Schadenfreude und des Rachedurstes“ (ebd.).
Marinelli bildet somit das völlige Gegenstück zu Camillo Rota, einem der Räte des Prinzen, der als Nebenfigur vorbildlich handelt und von der ihm im Zuge der hitzigen und egoistischen Leidenschaften des Prinzen aufgetragenen Macht keinen Gebrauch macht: Als er bemerkt, dass der Prinz ein Todesurteil ohne vorherige Überprüfung rasch unterschreiben will, gibt er vor, das Schriftstück doch nicht mitgenommen zu haben. Der Gerechtigkeitssinn des Camillo und dessen Achtung vor dem Menschenleben – „Ich hätt es [das Todesurteil] ihn in diesem Augenblicke nicht mögen unterschreiben lassen, und wenn es den Mörder meines einzigen Sohnes betroffen hätte.“ (I/8, S. 20) – stehen in klarem Gegensatz zu Marinelli, der sich Sorgen macht, dass Appiani bei dem Anschlag nur verwundet worden sein könnte und schließlich sogar über dessen Tod spottet: „Ha, Herr Graf, […] [w]er hatte Sie die Affen so kennen gelehrt? […] Jawohl sind sie hämisch.“ (III/2, S. 43). Auch das Menschenleben anderer Beteiligter interessiert ihn nicht, er drängt lediglich auf die schnelle Erfüllung seines Auftrags: „[Genug] [m]it deinem Nicolo! – Aber der Graf, der Graf –“ (III/2, S. 44).
3.1.2 Orsina
Die Gräfin Orsina, die erst im vierten Akt erstmals auf der Bühne erscheint, wird uns als eine stolze Frau präsentiert, die selbstbewusst auch im Umgang mit anderen Angehörigen der ihr vertrauten höfischen Sphäre ist. Bereits zu Beginn ihres ersten Auftritts beklagt sie die Art des Empfangs, die ihr auf dem Schloss des Prinzen bereitet wird, und erinnert sich an das „ganze[] Heer geschäftiger Augendiener […], [die sie früher mit] Liebe und Entzücken erwarteten“ (IV/3, S. 59). In Marinelli, der sie in schmeichlerischer und berechnender Weise als „Philosophin“ bezeichnet (IV/3, S. 61), um sie zu beruhigen, sieht sie einen Repräsentanten von höfischem Lug und Trug, dessen Welt sie schon längst durchschaut hat: „Hofgeschmeiß! So viel Worte, so viel Lügen!“ (IV/3, S. 60). Sie kontert ihm in flippig-frechem Ton, bezeichnet ihn sogar als „Gehirnchen“ (IV/3, S. 59) und „nachplauderndes Hofmännchen“ (IV/3, S. 61). Die Bezeichnung „Philosophin“ lehnt sie zwar nicht ab („Ja, ja; ich bin eine“ [ebd.]), allerdings sieht sie gerade in ihrem selbstständigen und kritischen Denken, das auch von einer Überschreitung der für die Zeit typischen Geschlechterrollen zeugt10, den Grund dafür, dass sie vom Prinzen verstoßen wurde: „Wie kann ein Mann ein Ding lieben, das, ihm zum Trotze, auch denken will? Ein Frauenzimmer, das denket, ist ebenso ekel als ein Mann, der sich schminket.“ (IV/3, S. 61). Gerade weil Orsina in ihrem Verstand den Grund für ihre Kränkung sieht, ist sie fest entschlossen, die Männer genau durch den Einsatz von diesem eines Besseren zu belehren: Schnell entlockt sie dem strategisch unterlegenen Marinelli, der sie wie auch der Prinz zuvor noch als „Närrin“ bezeichnet hatte (I/6, S. 13; IV/2, S. 58), in einem Gespräch wichtige Informationen, aus denen sie sich durch ihre schnelle Kombinationsgabe die wahren Umstände über Appianis Tod und Emilias Entführung erschließt, die auf den Prinzen als Drahtzieher der Tat hindeuten. Erst jetzt, da sie sich das erworbene Wissen für ihre Rachegelüste zu Nutze machen kann, ist sie mit ihrem Verstand das erste Mal zufrieden: „Von Sinnen? […] Ich bin selten, oder nie, mit meinem Verstande so wohl zufrieden gewesen, als eben itzt.“ (IV/5, S. 65). Auch an weiteren Stellen im Stück wird deutlich, dass Orsinas Rachedurst ihre anderen Gedanken und Emotionen übertrumpft. So hebt die Gräfin beispielsweise das grausame Schicksal der Braut hervor11, allerdings verfliegt dieser Ausdruck von Empathie in dem Moment, als sie von Marinelli Gewissheit über die Identität der Braut erhält: „Bravo! o bravo! bravo! […] Ja, küssen, küssen möcht ich ihn [den Teufel, der ihn dazu verleitet hat] – Und wenn Sie selbst dieser Teufel wären, Marinelli.“ (IV/5, S. 65). Ihre Wut auf den Prinzen ist grenzenlos, sie verleiht ihr vor Odoardo sogar mit der zornigen Beschreibung ihrer Rachefantasie Ausdruck, in der der Prinz von im Rausch handelnden Bacchantinnen und rächenden Furien, in die sich all seine von ihm verlassenen Geliebten verwandeln, zerfleischt und seines Herzens beraubt wird (vgl. IV/7, S. 71).
Orsinas strategisches Vorgehen und selbstbewusstes Auftreten zeugen von ihrem Verlangen, nicht nur den Prinzen, sondern auch ihren männlichen Gegenspieler Marinelli zu übertreffen, was sie zunächst am effektivsten mit der Beschaffung von Informationen erreichen kann. Dafür hat sie sogar ihre eigenen Kundschafter, die z. B. das Gespräch zwischen Emilia und dem Prinzen in der Kirche in ihrem Auftrag mithören. Dieses Verlangen klingt auch in ihrem süffisant-selbstsicheren Unterton an, mit dem sie Marinelli mit ihren Informationen auf dem Lustschloss des Prinzen konfrontiert: „Nun, guter Herr? Bin ich von Sinnen?“ (IV/5, S. 66). Es zeigt sich also, dass Orsina nicht nur mit ihrem Denken, sondern auch in ihrem Auftreten und Handeln gesellschaftliche Geschlechtergrenzen überschreitet, was Völker Dörr auch an der Art, wie ihr Name im ersten Auftritt des ersten Akts eingeführt wird, sowie an ihrer Wirkung auf den Prinzen festmacht:
An [Orsina] fällt zunächst auf, dass sie, anders als Emilia, nicht als Objekt der Verfügungsgewalt männlichen Sprechens12 eingeführt wird, sondern als Subjekt der Schrift: durch einen von ihr stammenden Brief. Deutlich wird, dass der Prinz an Orsina gerade den Aspekt zielgerichteten Handelns fürchtet, die Inversion der Geschlechterrollen, die ihn zum Objekt ihrer Verfügung macht: Wenn er Marinelli unterstellt, er wolle ihn in eine Verbindung mit Orsina treiben und zähle zu jenen, denen er ‚der tollen Orsina schimpfliche Fesseln lieber ewig tragen sollte‘ [I/6, S. 16], dann wird deutlich, wie groß die Furcht des Prinzen davor ist, zum Objekt reduziert zu werden. (Dörr 2012: 315)
Lessing zeichnet also von Orsina das Bild einer verletzten und enttäuschten, zugleich aber auch stolzen und ehrgeizigen Intrigantin, die zwar über Leidenschaften und Verstand verfügt, beide jedoch nur zur Erfüllung ihrer Rachepläne kombiniert. Eifersucht auf andere Geliebte des Prinzen spielt als Motivation für Orsinas Handeln eine eher untergeordnete Rolle, da der Dolch nicht für Emilia, sondern für den Prinzen bestimmt ist.
3.2 Strategisches Vorgehen der Intriganten
3.2.1 Funktionsweise und Prinzipien der Intrige – Gemeinsamkeiten bei Marinelli und Orsina
Bei der Entwicklung bzw. Dynamisierung der Intrige lassen sich bei beiden Intrigantenfiguren einige Gemeinsamkeiten feststellen. Sowohl Marinelli als auch Orsina wissen um die Macht der Affekte und die Gefahr, die von unreflektiertem, unbedachtem, schnellem Handeln ausgeht. Genau zu einem solchen Handeln wollen sie ihr Gegenüber durch geschickte Manipulation treiben: „Sowohl für Hettore als auch für Odoardo gibt es Dinge, über die sie ihren Verstand verlieren.“ (Schenkel 1986: 177). Der Prinz, ein leicht beeinflussbarer, schwankender13, inkonsequenter14 und durchaus naiver15 Charakter, will die noch am selben Tag anstehende Heirat Appianis mit Emilia, nach der er ein starkes Verlangen empfindet, so schnell wie möglich verhindern. In einem Moment der Schwäche gewährt er Marinelli freie Hand und begibt sich damit fast vollständig in dessen Abhängigkeit, wodurch er – ob gewollt oder ungewollt – zumindest zum Komplizen der Tat wird. Im Fall von Odoardo appelliert Orsina rhetorisch geschickt neben der Sorge um die entführte Tochter auch an das rigide Tugendbewusstsein des Vaters sowie an sein Verständnis von väterlicher Ehre und Stolz, wodurch auch er in einem Moment der Schwäche sein kritisches Reflexionsvermögen verliert und den Dolch von Orsina an sich nimmt. Mit jeder Andeutung der Gräfin, Emilia könne vom Prinzen verführt, ja sogar in das Mordkomplott verwickelt worden sein, zerbröckelt Odoardos starre Bild der tugendhaften Tochter, das er in den Darstellungen Orsinas nicht mehr wiedererkennt. Beide Intriganten kennen also den Schwachpunkt ihres Gegenübers, der durch Erregung von Leidenschaften und dem Unterdrücken eines selbstständigen, kritischen Denkens aktiviert werden soll – oder in den Worten des Prinzen: „Liebster, bester Marinelli, denken Sie für mich.“ (I/6, S. 17, Herv. d. Verf.). Dass es gerade der Affekt ist, der Anknüpfungspunkt für den Intriganten ist, liegt an seiner zweischneidigen Wirkungsweise: „Im Affekt liegt die Chance zur Versöhnung, zugleich aber auch zum [sic!] Verderbnis. Das Leiden entspinnt sich aus den Handlungen der Charaktere selbst, die nicht Herr ihrer Affekte bleiben können und in das Pathos stürzen.“ (Memmolo 1995: 161). So kann ein leidenschaftlicher Prinz, der offen für Werte der Empfindsamkeit ist, sich allerdings nicht einem mündigen Erzieher vom Schlage eines Nathans, sondern einem intriganten Berater gegenübersieht, genauso ins Verderben geführt werden wie ein besorgter Vater, dessen Vaterliebe von einer gekränkten Rächerin für ihre Zwecke pervertiert wird.
Beide Intriganten bauen auf dem in Kapitel 2.2 bereits erwähnten, von Peter-André Alt als drängender Dezisionismus bezeichneten Prinzip, bei dem der Intrigant Zeitknappheit suggeriert und die Notwendigkeit eines schnellen Handelns betont, was eine Dynamisierung des Geschehens bewirkt. Dabei spiegelt die Intrige auf Textebene die Struktur des Dramas wider: „Die Struktur der Intrige entfaltet sich analog zu jener des Trauerspiels, indem sie mit den Mitteln der Zeitbeschleunigung arbeitet, um den Effekt der Überraschung und Überwältigung zu erzielen.“ (Alt 2004: 13). Der Prinz ist überrascht, als Marinelli ihm berichtet, dass die Hochzeit noch am selben Tag stattfinden soll, und stimmt dessen Forderung, „keine Zeit [zu] verlieren“ (I/6, S. 18), eindrücklich zu: „Gehen Sie, eilen Sie.“ (ebd.). Auch Odoardo ist zu Beginn des fünften Aktes entschlossen, schnell und spontan zu handeln und keine Zeit zu verlieren: „Erwägen! erwägen! Ich erwäge, dass hier nichts zu erwägen ist. Sie soll, sie muss mit mir.“ (V/3, S. 77).
Sowohl Marinelli als auch Orsina verwenden Lügen und lassen wesentliche Details in ihren Schilderungen weg, um falsche Eindrücke zu schaffen. So behauptet beispielsweise Marinelli in seinem Bericht an den Prinzen, Appiani habe ein Duell mit ihm ausgeschlagen16, obwohl Appiani derjenige war, der das Duell sogar vorgeschlagen hatte. Vielmehr war es Marinelli selbst, der sich von dem Grafen losriss und wegging (vgl. II/10, S. 38). Auch was den Auftrag zum Überfall der Hochzeitskutsche angeht, lügt Marinelli: „Ich hatte es dem Angelo auf die Seele gebunden, zu verhüten, dass niemanden Leides geschähe.“ (IV/1, S. 55). Orsinas Schilderung von dem Treffen zwischen Emilia und dem Prinzen in der Kirche – das angeblich von „einer Vertraulichkeit“ und „einer Inbrunst“ zeugte (IV/7, S. 70) –, deckt sich nicht mit der glaubwürdigen Schilderung der verängstigten, schüchternen, aus der Kirche fliehenden Emilia (vgl. II/6, S. 28-30).
Obwohl Marinelli und v. a. Orsina davon überzeugt sind, dass der Zufall das Gelingen ihrer Intrigen nicht gefährden könne (Marinelli: „Vorsatz und Zufall: alles ist eins“ [IV/1, S. 55]; Orsina: „[D]as Wort Zufall ist Gotteslästerung. Nichts unter der Sonne ist Zufall“ [IV/3, S. 62]), scheitern ihre Pläne ironischerweise gerade an der Unberechenbarkeit und am Zufall. Orsinas Rachegelüste und Marinellis höfische „Vernunft“, die für ihn in Form eines minutiösen Vorausplanens keinen Raum für Zwischenfälle lässt, erlauben es den beiden z. B. nicht vorauszusehen, dass Odoardo nach der Auseinandersetzung mit dem Prinzen und Marinelli unter Einfluss von Emilias ausgeprägter Überredungskunst seine eigene Tochter töten wird – Orsina hatte zudem auch noch auf den Tod des Prinzen gehofft. Marinelli wird durch das eben doch zufällige Erscheinen Orsinas auf dem Lustschloss des Prinzen17 völlig überrumpelt: Er scheitert daran, Orsina von Odoardo und zugleich Odoardo vom Prinzen, mit dem er erst die weiteren Schritte abklären muss, fernzuhalten. Marinelli entscheidet sich dafür, Odoardo mit Orsina allein zu lassen, von deren Unglaubwürdigkeit er kurz zuvor allerdings Odoardo noch zu überzeugen versucht, wodurch er sich aber letztlich nur noch verdächtiger macht, da Orsina Odoardo schnell vom Gegenteil überzeugen kann und er einen völlig anderen Eindruck von ihr bekommt. Auch das Verhalten des von seinen Leidenschaften beherrschten Prinzen ist für den Marchesen nicht immer voraussehbar, so z. B., als der Prinz sich entgegen der Abmachung mit Marinelli anstatt abzuwarten in die Kirche zu Emilia begibt18, oder als er plötzlich einwilligt, dass der Vater seine Tochter in ein Kloster außerhalb des Einflussbereichs des Prinzen bringen könne: „Doch allerdings: dem Vater hat niemand einzureden. Bringen Sie Ihre Tochter, Galotti, wohin Sie wollen.“ (V/5, S. 79). Erst nach der Intervention Marinellis, der seine Kontrolle mehr und mehr aus der Hand gleiten sieht und versucht, zu retten, was noch zu retten ist, schwingt der Prinz in seiner Meinung um. Lessing setzt den Einflussmöglichkeiten der Intriganten somit klare Grenzen und zeigt, dass auch noch so geplantes Vorgehen eben doch aufgrund von Zufall und unkalkulierbaren Leidenschaften der Beteiligten, deren Perspektiven und Wahrnehmungsweisen deutlich unterschiedlich sind, scheitern kann:
Der Sinn des dramatischen Geschehens besteht für [Lessing] nicht (wie für Wolff oder Gottsched) in der Enthüllung bzw. Veranschaulichung einer moralischen Wahrheit, sondern in der Entfaltung der individuellen Wahrnehmungsweisen und Figurenperspektiven, die konfliktreich aufeinanderstoßen und nicht ohne weiteres auszugleichen sind […]. Lessing räumt den ‚unbewußten Perceptionen‘, den dunklen sinnlichen Antrieben, einen relativ breiten Spielraum ein […]; in Emilia Galotti beispielsweise deutet der Dialog immer wieder auf eine Schicht verschwiegener, unerkannter Impulse und Gefühle, die sich in der – oft überraschenden – Handlungsweise der Figuren Bahn brechen. (Fick 2010: 42)
Zuletzt sei noch auf die Bedeutung der höfischen Sphäre hingewiesen, deren Kenner sowohl Orsina als auch Marinelli sind, was sie sich in ihren Intrigen auch zu Nutze machen. Marinelli kennt die Atmosphäre aus öffentlicher Selbstdarstellung, Verstellungskunst, Verschwendungssucht, Statusrepräsentation und Zwang zu politischer Heirat, die am Hof herrscht und dem Prinzen nur wenig Freiraum für authentische Gefühle und Privatheit lässt. Er weiß auch, dass der Prinz sich nach einer Alternative sehnt, weshalb er innerhalb einer „quasi-privaten Sphäre der höfischen Welt, wo die Willkür und Begierde des Prinzen herrscht“ und „die Mätresse institutionalisiert“ (Takahashi 1995: 24) ist, die Leidenschaften des Herrschers entfachen will. Auch bei der genauen Beobachtung anderer Personen, die es zu durchschauen gilt, hat er durch das routinierte Vortäuschen von Gefühlen bereits einen Vorteil. Die Gräfin Orsina verlässt sich für das Gelingen ihrer Intrige darauf, dass Odoardo Lug und Trug, Heuchelei und Schein am Hof durchschauen wird, nachdem sie Zweifel und Unsicherheit in ihm gestreut hat. Sie ist sogar so siegessicher, dass sie mit Claudia in die Stadt fährt, nachdem sie Odoardo den Dolch in die Hand gedrückt und kurz vorher noch seine Zweifel bzw. ihre Glaubwürdigkeit verstärkt hat: „Nun, hab ich gelogen?“; „Bin ich wahnwitzig?“ (IV/8, S. 72). Und in der Tat spielen ihr Marinelli und der Prinz in die Hände, als sie trotz Odoardos wiederholter Bitten nicht von ihrem Vorhaben abrücken, Emilia ins Haus des Kanzlers Grimaldi zu bringen (vgl. V/5, S. 82). Wie von Orsina kalkuliert, empfindet Odoardo Machtlosigkeit und Hohn; er muss feststellen, dass seine väterliche Autorität im Vergleich zu den egoistischen Bedürfnissen am Hof nichts wert ist.
3.2.2 Strategisches Kommunikationsverhalten des Marinelli
Marinelli ist es wichtig, die Person des Prinzen in Verbindung mit seinem eigenen Handeln zu bringen und ihn an dessen Rolle in dem Komplott zu erinnern: „Nun vergessen Sie nicht, Prinz, wessen Sie mich eben versichert. – Ich habe nochmals Ihr Wort“ (III/1, S. 42); „Wollen Sie mir freie Hand lassen, Prinz? Wollen Sie alles genehmigen, was ich tue?“ (I/6, S. 17). Der Intrigant spielt damit mit der im Trauerspiel häufig angewandten Strategie der „präventiven Exkulpation des Herrschers“ (Alt 2004: 7), die den Herrscher glauben lässt, er selber habe keine Verantwortung mehr für das Geschehen, da er nicht direkt als Akteur bei der Tat auftritt. Allerdings wird er durch seine wiederholte Zustimmung von seinem Kammerherrn immer mehr in das Geschehen hineingezogen. Auch mit dem Rekurs auf institutionelle Macht bzw. Herrscherrolle soll dem Prinzen die Zustimmung leichter gemacht werden: „Vor allen Dingen, eine Kleinigkeit als eine Kleinigkeit ansehen; – und mir sagen, dass ich nicht vergebens sein wolle, was ich bin – Herr!“ (I/6, S. 17). Marinelli demonstriert im Verlaufe des Dramas seine Kontrolle immer unverblümter, da er zunehmend an Sicherheit gewinnt, so z. B. als er Hettore auf seinen Fehler, zu Emilia in die Kirche gegangen zu sein, hinweist: Er verwendet im Gespräch eine Er-Anrede und spricht von dem Prinzen in 3. Person Singular19, was zusätzlich Distanz zwischen ihm und seinem Gegenüber schafft und dem Prinzen seine eigene Verantwortung für sein Handeln signalisiert. Mit einer Aneinanderreihung von rhetorischen Fragen20 konstruiert er einen Gedankengang, der dem Prinzen verdeutlichen soll, wie verdächtig er sich selbst durch sein Verhalten gemacht habe, was dieser wieder einmal nicht hinterfragt: „Dass Sie Recht haben!“ (IV/1, S. 57). Auch Marinellis zunehmend gleichgültiger und kalter Tonfall gegenüber dem Prinzen zeugt von der Selbstsicherheit, in der er sich wiegt. „Schwerlich“ werde man Appianis Tod für einen Zufall halten, aber „[w]ahrscheinlich genug“ werde man Hettore für den Täter halten, so Marinelli in einem „ kalt[en] “ und „ noch kälter[en] “ Ton (IV/1, S. 56). Kurz vor der Ankunft des Mörders Angelo auf dem Schloss befiehlt er sogar dem Prinzen wiederholt, sich zu entfernen21.
Im Gespräch mit seinem Gegenüber gibt sich Marinelli Mühe, den Redefluss aufrechtzuerhalten und den Eindruck eines interessierten, unwissenden, authentischen, schlagfertigen Redepartners zu erzeugen. So greift er oft mit einer Anadiplose die letzte Aussage seines Dialogpartners auf, wie z. B. im Gespräch mit Claudia Galotti: „Streit?“ (III/8, S. 51)22 ; „Des sterbenden Grafen?“ (III/8, S. 52)23 ; „Mit einem Tone?“ (III/8, S. 52)24. Dabei spielt er die Dinge oft herunter bzw. relativiert Geschehenes in Form von Untertreibungen („Streit [mit dem Grafen]? – Was ich nicht wüsste: ein unbedeutender Wortwechsel in herrschaftlichen Angelegenheiten“ [III/8, S. 51]) oder bleibt in seiner Aussage so vage wie möglich25, was sich auch an seiner häufigen Verwendung des Indefinitpronomens „man“26 zeigt. In besonders perfider Weise greift er auch die Aussage einer anderen Person in einem völlig veränderten, aus dem Zusammenhang gerissenen Kontext wieder auf. So versichert er beispielsweise Odoardo kurz vor dessen Tat, dass er als Appianis Rächer ernannt worden sei und führt als Beweis den Bericht Claudias an: „Fragen Sie nur Ihre Gemahlin. Marinelli, der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen: und in einem Tone! in einem Tone!“ (V/5, S. 79). Marinelli verkörpert damit auch ein weiteres wesentliches Merkmal der Figur des Intriganten: „Die intrigante Figur macht das natürliche Zeichen der anderen zum willkürlichen und ihr willkürliches Zeichen zum natürlichen. Nachgeahmtes und Spontan-Natürliches sind solcherart auf der Bühne nicht zu unterscheiden.“ (Memmolo 1995: 169). Wie vom Intriganten beabsichtigt, verfließen Schein und Sein ineinander, was Marinelli mit einer contradictio in adiecto selbst passend ausdrückt, als er die aufgewühlte Emilia zum ersten Mal auf dem Schloss begrüßt: „Ah, gnädiges Fräulein! Was für ein Unglück, oder vielmehr, was für ein Glück, – was für ein glückliches Unglück verschafft uns die Ehre –” (III/4, S. 46, Herv. d. Verf.).
Wie bereits in den vorherigen Kapiteln angerissen, ist Marinelli routiniert im Vortäuschen von gespielten Reaktionen und Emotionen. Im Verlaufe des gesamten Trauerspiels heuchelt er beispielsweise Erregung27, Überraschung28 und Entsetzen29, Neugier30 und Mitleid31. Er ist stets bemüht, das Bild eines unvoreingenommenen, glaubwürdigen, abwägenden Gesprächspartners aufrechtzuerhalten; so heuchelt er oft zunächst Verständnis, schwächt dann aber anschließend sofort mit Modalpartikeln und Konnektoren wie „aber doch“ (II/10, S. 37) und „Aber bei dem allen“ (V/5, S. 80) bzw. „bei dem allen“ (ebd.) seine vorherige Aussage ab.
3.2.3 Strategisches Kommunikationsverhalten der Orsina
Orsina weiß um die Bedeutung des Verstandes, was sie selbstbewusster als Marinelli im Gespräch mit Odoardo im 7. Auftritt der 4. Akts offen zum Ausdruck bringt: „Auch Sie haben Verstand; und es kostet mich ein Wort, – so haben Sie keinen.“ (S. 6932 ). Sie schmeichelt dem besorgten Vater („Denn auch Sie haben Verstand, guter Alter; auch Sie. Ich seh es an dieser entschlossenen, ehrwürdigen Miene.“ [ebd.]), will dessen Neugier und Aufmerksamkeit durch Verwendung vager Phrasen wie „unglücklicher Mann“; „Sie wissen nichts.“ (S. 68); „Ihre Tochter – schlimmer als tot“ (S. 69) wecken, und erschleicht sich mehr und mehr auch unter geschicktem Einsatz ihrer Mimik (so betrachtet sie Odoardo mit Mitleid [vgl. S. 68]) und philosophischen Argumenten („Das unglückliche Kind, ist immer das einzige.“ [ebd.]) dessen Vertrauen. Orsinas Ziel ist es, Odoardo von einer geistigen Verwandtschaft zwischen den beiden zu überzeugen, ein Wir-Gefühl zwischen zwei Betrogenen herzustellen: „Wir, Alter, wir können uns alles vertrauen. Denn wir sind beide beleidiget; von dem nämlichen Verführer beleidiget“ (S. 71). In der Gräfin soll Odoardo sich selbst wiederkennen und ihr vertrauen: „Verzeihen Sie! die Unglücklichen ketten sich so gern aneinander. – Ich wollte treulich Schmerz und Wut mit Ihnen teilen.“ (S. 68). In der Tat gelingt es Orsina auch, nach nur wenigen Sätzen die von Marinelli gestreuten Zweifel in Odoardo zu beseitigen: „Doch, bei Gott, so spricht keine Wahnwitzige!“ (ebd.). Im Gegenteil: Sie greift Marinellis Vorbehalt33 auf und verwendet ihn für eigenes Argument: „Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verlieret, der hat keinen zu verlieren.“ (S. 69). Marinellis Versuch, Orsina im Vorhinein zu diskreditieren, scheitert also nicht zuletzt auch an den Überredungskünsten und der Schlagkraft der Gräfin. Ihre Glaubwürdigkeit wiederhergestellt, wirkt jetzt auch ihre negative Darstellung des Prinzen34, in dessen Anwesenheit sich Emilia ja gerade befindet, für Odoardo glaubwürdiger und schmerzhafter. So verfliegt Odoardos anfangs noch vorhandene Sicherheit („Verleumdung! verdammte Verleumdung! Ich kenne meine Tochter.“ [S. 70]) zunehmend: „Ja wohl hat sie Recht die gute Sibylle: Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verlieret, der hat keinen zu verlieren!“ (V/5, S. 82); „Aber – (Pause) wenn sie [Emilia] mit ihm sich verstünde? Wenn sie es nicht wert wäre, was ich für sie tun will?“ (V/6, S. 83).35 Orsina nutzt Odoardos Moment der Schwäche auf der Stelle aus und überreicht ihm den Dolch, als sie feststellt, dass er unbewaffnet ist. Dabei appelliert sie an sein stolzes Mannesbild und bezieht sich auf die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse, die sie für ihre Zwecke ausnutzt: „und Sie werden sie [diese Gelegenheit] ergreifen, die erste, die beste – wenn Sie ein Mann sind. – Ich, ich bin nur ein Weib, aber so kam ich her! fest entschlossen!“ (IV/7, S. 71).
Auch in der Interaktion mit Marinelli zeigt sich ihre Fähigkeit, die Kontrolle zu übernehmen. Als der Marchese sie mit einem vorgeschobenen Hinweis auf seine gesellschaftliche Pflicht („Erlauben Sie, dass ich meine Schuldigkeit beobachte.“ [IV/6, S. 67]) aus dem Schloss führen will, um sie von Odoardo fernzuhalten, kontert sie effektiv und greift auch hier wieder Marinellis Argument auf, um es für ihre Zwecke umzugestalten: „Ich erlasse Sie deren [der Schuldigkeit], mein Herr. […] Diesen würdigen Mann je eher lieber zu melden, das ist Ihre Schuldigkeit.“ (ebd.). Marinelli wird mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Auch Orsinas Bewegungen auf der Bühne zeugen von ihrer Überlegenheit; so führt sie beispielsweise Marinelli weg von der Tür, legt ihm den Finger auf den Mund und schreit ihm überraschend ins Ohr: „Der Prinz ist ein Mörder!“ (IV/5, S. 65). Bereits im ersten Gespräch zwischen Marinelli und Orsina im Vorsaal auf dem Lustschloss des Prinzen überwiegen ihre Redeanteile deutlich; sie gibt sich, sicherlich auch von ihrer Wut angetrieben, selbstbewusst; spricht in einem ernsthaften, befehlenden und konfrontativen Ton mit dem Kammerherrn („So lachen Sie doch!“; „Machen Sie, Marinelli, machen Sie, dass ich ihn bald spreche, den Prinzen“ [IV/3, S. 62]). Orsina gibt im wahrsten Sinne des Wortes den Ton an; sie weiß diesen, je nachdem wem sie gerade gegenübersteht, auch sehr gut anzupassen, weshalb sie sich im Gespräch mit Odoardo wie bereits dargestellt freundlicher und weitaus weniger konfrontativ verhält, wenn auch immer noch selbstbewusst. Auch ihre rhetorische Frage36 an Marinelli und das schnelle Konstruieren eines philosophischen Arguments37, das auf ihre spitze Bemerkung „Ist dir das zu hoch, Mensch?“ (IV/3, S. 61) folgt, spiegeln das Bild einer Frau wider, die ihrer Zeit in ihrem Auftreten und Denken voraus ist und dennoch strategisch auch damit überlegt und berechnend umgehen kann. Sie entlockt Marinelli wichtige Informationen, indem sie vorgibt, an dessen Barmherzigkeit zu appellieren – eine „einzige kleine Lüge“ (IV/5, S. 63) verlangt sie – und indem sie ihre Unwissenheit betont: Allein im Gespräch mit Marinelli im 5. Auftritt des 4. Akts überfällt sie Marinelli förmlich in raschem Tempo mit 35 Fragen, bis sie von ihm Gewissheit erhält, dass Emilia Galotti sich gerade beim Prinzen befindet. Sie gibt vor, nichts zu wissen („Ich bin so lange aus der Stadt, dass ich von nichts weiß.“ [IV/5, S. 64]), obwohl sie ja sogar Kundschafter hat, die ihr vom Gespräch zwischen Appiani und Emilia berichtet haben. Auch wenn sie sich noch nicht völlig sicher über die Identität der Braut ist, weiß sie mit Sicherheit nicht von „nichts“, weshalb sie sich von Marinelli auch nicht so schnell abwimmeln lässt: „[Der Graf Appiani] [w]äre bei ihm? – Schade, dass ich über diese Lüge Sie ertappen muss. Geschwind eine andere. – Denn Graf Appiani, wenn Sie es noch nicht wissen, ist eben von Räubern erschossen worden.“ (ebd). Orsina geht also schnell und rhetorisch geschickt vor, um die Oberhand im Dialog mit ihrem Gegenüber zu gewinnen, wobei sie auch auf den Effekt der Überrumpelung ihres Dialogpartners baut, der – oft von seinen Leidenschaften geleitet bzw. in seiner Perspektive beschränkt – auch Widersprüchliches nicht erkennt.
4. Die Intriganten in Emilia Galotti als Musterbeispiele für unaufgeklärtes Handeln
Die Intriganten in Emilia Galotti erschweren mit ihrem Verhalten die Umsetzung von aufklärerischen Werten in der Gesellschaft. Die Macht des Wortes wird für eine Manipulationskunst missbraucht, die auf das sofortige, unbedachte, unselbstständige Handeln im Menschen zielt, der Leidenschaft und Vernunft nicht zum Guten kombinieren kann. Mit Lügen, Heuchelei, Schein, Lug und Trug verhindern sie kritisches, reflektierendes Denken in der Person, die schließlich nur noch auf das Wort des Intriganten reagiert, es aber nicht mehr hinterfragt. Ansätze von selbstständigem, unabhängigem Denken, wie sie beispielsweise beim Prinzen durchaus vorhanden sind38, werden von Marinelli, einem Kenner der höfischen Sphäre, der bestehende staatliche und gesellschaftliche Ordnungen für eigene Zwecke missbraucht statt sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen, unterdrückt. Marinelli zielt bei der Manipulation des Prinzen eben gerade nicht auf eine Kombination von Empfindsamkeit und Vernunft, sondern ein unselbstständiges, rein affektgeleitetes, spontanes Handeln, das auf andere keine Rücksicht nimmt.39 Dem negativen Einfluss eines berechnenden Höflings ausgesetzt, der selber Standesgrenzen nicht überschreiten will und seine Ratgeberrolle ausnutzt, gelingt dem Prinzen der Ausgang aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit somit nicht. ‚Kluftübergreifende‘ Kommunikation „zwischen höfisch-öffentlicher und privat-bürgerlicher Welt“ gelingt nur dort, „wo sich das Ideal ständeübergreifender Liebe und Freundschaft verwirklichen kann und wo die Bereitschaft vorhanden ist, im Geist der Aufklärung zu erziehen und sich erziehen zu lassen“ (Stauf 2002: 133). Auch wenn das Trauerspiel Lessings sicher nicht auf den Aspekt der Hofkritik reduziert werden sollte, so verkörpert die Figur des Marinelli doch die Atmosphäre einer höfischen Kälte und Scheinkultur, die die Umsetzung von aufklärerischen Werten erschwert und die Lessing kritisch sieht:
In seinen Schriften zur Dramentheorie und zum Theater sucht er unermüdlich, die Alternativen zur Hofkultur zu unterstützen; insbesondere kämpft er gegen die Dominanz des klassizistischen französischen Geschmacks, dessen ‚Kälte‘ er die neuen Werte entgegenhält: herzergreifende Rührung, Mitleid, Gefühl der Menschheit. (Fick 2010: 41)
Eine harmonische Einheit von Verstand, Wille und Gefühl, wie sie Martin Schenkel (1986: 169) als Bedingung für das aufklärerische Vollkommenheitsideal im Menschen formuliert, ist den intriganten Figuren nicht zu attestieren. Auch das Verhalten der gekränkten Orsina, die Emotionen in sich selbst und ihrem Gegenüber genau zu kalkulieren versucht, und in ihrem eigenen intriganten Verhalten auf die Dominanz des Verstandes über dem Ausdruck von authentischen Gefühlen baut, zeugt davon:
[D]ie geistige und sittliche Erhabenheit über den elenden Schwarm der Höflinge, wodurch sie [Orsina] uns ein Gegenstand der Achtung wird, mäßigt den Ausbruch ihrer Empfindungen, aber der rasche und wunderbare Wechsel von Stolz, Heftigkeit, Wehmuth, Entrüstung, Rührung, die dialektischen Spitzfindigkeiten, wodurch sie aus der Gewalt des Herzens sich loßzureißen und ihr ganzes Sein dem heitern Spiele des Verstandes zu unterwerfen sucht, zeigen ihre vollkommene Trostlosigkeit, sie enthüllen uns ihr Inneres, wie es den zerstörenden Gewalten überliefert ist, die der Mensch beherrschen soll. (Hölscher 1851/2015: 97)
Angetrieben von egoistischen Impulsen, sind die Figuren nicht zu selbstlosen Handlungen bereit. Es gibt in Emilia Galotti noch keinen besonnenen Protagonisten, der wie in Nathan der Weise (Erscheinungsjahr: 1779) Hassgefühle, ungezügelte Leidenschaften und berechnendes Kalkül überwinden kann, indem er z. B. ein christlich getauftes Kind aufnimmt und erzieht, obwohl seine Frau und Söhne zuvor von den Christen ermordet worden waren. Das Abtreten von Entscheidungen und Missbrauchen von anderen Figuren als Mittel zum Zweck – so töten weder Orsina noch Marinelli mit eigener Hand einen anderen Menschen – zeugen von einer fehlenden Bereitschaft, sich der eigenen Verantwortung zu stellen. Auch zu aufrichtigem Mitleid, dem „affektive[n] Äquivalent zu der geforderten Erkenntnis“ (Fick 2010: 400), sind die Figuren nicht bereit. So übergibt Marinelli dem Mörder Angelo einen Beutel mit Gold und bemerkt in hämischem Ton: „Nun da, für dein mitleidiges Herz!“ (III/2, S. 44). Auch der Prinz hat wenig Verständnis für Orsina, die er wie ihr Porträt, das der Maler Conti ihm in seinem Auftrag bringt (vgl. I/4), schnell und willkürlich gegen Emilia auswechselt: „Wenn sie aus Liebe närrisch wird, so wäre sie es, früher oder später, auch ohne Liebe geworden. – Und nun, genug von ihr.“ (I/6, S. 13 f.); „Nun ja; ich habe sie zu lieben geglaubt! Was glaubt man nicht alles? Kann sein, ich habe sie auch wirklich geliebt. Aber – ich habe!“ (I/1, S. 6).
Lessing zeigt an den intriganten Figuren, dass nicht jeder, der in Künsten wie der Rhetorik oder der Verstellung gelehrt ist, gleichzeitig auch weise und weltoffen sein muss. Auch hier ist es nötig, seine Stärken zu kombinieren und für ein tugendhaftes Ziel einzusetzen: „Weltoffenheit und Gelehrsamkeit sollen sich eben nicht ausschließen, sondern einander bereichern.“ (Fick 2010: 39). Mit dem Besitzstreben der Figuren – Marinelli sehnt sich nach Macht und Einfluss, Orsina nach Rache und dem Blut des Prinzen, der Prinz nach Emilia – verhält es sich ähnlich wie mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen die Figuren handeln: Jeder ist von seinem Handeln überzeugt, will seine Perspektive nicht erweitern bzw. überschreiten. Wie bereits die Ringparabel in Nathan der Weise gezeigt hat, kommt es jedoch weniger auf den Besitz selbst an als auf den tugendhaften Weg dorthin sowie darauf, was wir aus ihm machen.
5. Fazit
Zum Schluss der Arbeit soll hier noch einmal auf vier wichtige Punkte eingegangen werden, die die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassen und abrunden sollen:
· Die Figur des höfischen Intriganten, der in Emilia Galotti vom Kammerherrn Marinelli verkörpert wird, pocht rigoros auf der Umsetzung strategischer Klugheit und ist geübt in der Kunst der Verstellung sowie der Beherrschung der eigenen Affekte. Dabei ist der Intrigant von einer Umgebung am Hof geprägt, in der Machtspiele, Konkurrenzstreben, Statusrepräsentation und kalkuliertes Verhalten im Umgang mit anderen Menschen den Alltag bestimmen. Er missbraucht für sein intrigantes Verhalten sein Dienstverhältnis bzw. seine Beraterrolle, um den Herrscher zu manipulieren. Seiner strategischen Argumentationsweise sind keine Grenzen gesetzt: So kann er soziale Normen; die politische Macht des Herrschers; traditionell verankerte Ordnungen wie das Mätressensystem; das Streben des Individuums nach Privatsphäre, Freiheit und Selbstbestimmung; sowie unterdrückte Leidenschaften bzw. Begierden als Anknüpfungspunkt wählen. In seiner Welt haben gesellschaftliches Ansehen, Standesbewusstsein und Kontrolle über die eigenen Affekte Vorrang gegenüber Werten der Empfindsamkeit und Natürlichkeit. Für das Gelingen seiner Intrige baut er auf präzise Beobachtung, beherrschtes Auftreten und minutiöse Planung. Obwohl er den Herrscher zum Komplizen der Tat macht, indem er sich freie Hand von ihm gewähren lässt, soll dieser den Eindruck erhalten, er habe seine Verantwortung an seinen Berater abgegeben. Sprachlich kennzeichnen Spott, Häme, Sarkasmus und Heuchelei den Intriganten, der je nach Situation auch als authentischer und interessierter Dialogpartner auftreten kann, der bemüht ist, den Redefluss aufrechtzuerhalten und auf sein Gegenüber einzugehen.
· Die Intrigantin tritt auf der deutschen Bühne häufig in der Rolle der Ohrenbläserin bzw. Antreiberin auf, die Verantwortung auf die männlichen Akteure überträgt und vom inneren Zentrum der Macht oft ausgeschlossen ist. Als gelehrte Frau, wie es auch die Gräfin Orsina in Emilia Galotti ist, genießt sie nicht immer hohes gesellschaftliches Ansehen. Mit ihrem ausgeprägten Verstand, den sie selbst als Grund für ihre Einsamkeit sieht, aber auch in ihrem selbstbewussten Handeln und Auftreten, ist sie ihrer Zeit voraus. Auch wenn ihre Möglichkeiten zur direkten politischen Einflussnahme reduziert sind, schafft sie es doch, die Schwäche und strategische Unterlegenheit ihres Gegenübers auszunutzen und mit den männlichen Intriganten zumindest mitzuhalten, wenn nicht sogar sie zu übertreffen. Orsina wird uns als eine verletzte, aber zugleich auch berechnende Figur präsentiert, deren größte Motivation der Rachedurst ist.
· Sowohl Marinelli als auch Orsina sind Kenner der höfischen Sphäre, was sie sich in ihren Intrigen zu Nutze machen. Dabei verwenden sie ähnliche Strategien: Sie lügen, lassen wesentliche Details weg und spielen mit dem Einfluss der Affekte auf den Verstand des Menschen, wobei möglichst schnelles, unreflektiertes und unkritisches Handeln erzielt werden soll. Durch das Suggerieren von Zeitknappheit und einer Notwendigkeit zum schnellen Handeln wird eine Dynamisierung des Geschehens erreicht, die es schwer macht, das Komplott zu durchschauen und den Urheber der Intrige zu identifizieren. Sowohl auf Handlungs- als auch auf sprachlicher Ebene sollen Schein und Sein nicht mehr unterschieden werden können. Gute Vorbereitung ist für beide Intriganten wichtig, auch wenn Marinelli, der auf minutiöse Planung besteht, spontane Reaktionen auf unvorhergesehene Ereignisse deutlich schwerer fallen als Orsina.
· Das Beharren auf der eigenen Perspektive, z. B. in Form von einer kategorischen Ablehnung der Existenz des Zufalls, bewirkt nicht nur das Scheitern der Intrigen, sondern erschwert auch eine Umsetzung von aufklärerischen Werten. Eine stände- und interessenübergreifende Kommunikation, die nicht auf Heuchelei, Schein, Lug und Trug, Rache- und Hassgefühlen sowie berechnendem Kalkül basiert, sondern stattdessen Wille, Verstand und Gefühl in einer harmonisierenden Einheit zum Guten vereint, gelingt den von egoistischen Impulsen angetriebenen Figuren in Emilia Galotti nicht. Gerade der gemischte Charakter des Prinzen bedarf eines weisen Beraters vom Schlage eines Nathans und nicht eines Intriganten, der die Empfindungen und Ansätze selbstständigen Denkens in ihm unterdrückt.
Auch drei Jahrhunderte später hat Lessings Emilia Galotti nicht an Aktualität eingebüßt, da der Einfluss der Worte, Begierden und Leidenschaften auf unseren Verstand immer immens bleiben wird. Wie das Stück allerdings gezeigt hat, liegt es an uns, wie wir damit in unserem Handeln umgehen.
6. Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Lessing, Gotthold Ephraim; Krause, Thorsten (Hrsg.) (1772/2014): Emilia Galotti. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, Reihe „Reclam XL – Text und Kontext“ (Universal-Bibliothek, Nr. 45), Ditzingen: Philipp Reclam jun.
Sekundärliteratur
Alt, Peter-André (2004): Dramaturgie des Störfalls. Zur Typologie des Intriganten im Trauerspiel des 18. Jahrhunderts, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 29/1, S. 1-28.
Dörr, Volker (2012): „Aber Gift ist nur für uns Weiber; nicht für Männer.“. Sprache, Macht, Geschlecht in Lessings Emilia Galotti, in: Orbis Litterarum 67/4, S. 310-332.
Fick, Monika (2008): Verworrene Perzeptionen. Lessings Emilia Galotti, in: Markus Fauser (Hrsg.), Gotthold Ephraim Lessing. Neue Wege der Forschung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 75-94.
Fick, Monika (2010): Lessing-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, 3., neu bearb. u. erw. Auflage, Stuttgart: J. B. Metzler Verlag.
Grzesiuk, Ewa (2004): „Ich reime, dächt’ ich, doch noch ziemlich zusammen, was zusammengehört“. Intriganten und Intrigen in Lessings Emilia Galotti, in: Hartmut Eggert/Janusz Golec (Hrsg.), Lügen und ihre Widersacher. Literarische Ästhetik der Lüge seit dem 18. Jahrhundert: Ein deutsch-polnisches Symposion, Würzburg: Königshausen & Neumann, S. 72-83.
Hölscher, Ludwig (1851/2015): Ueber Lessing’s Emilia Galotti [1851], in: Carsten Gansel/Birka Siwczyk (Hrsg.), Gotthold Ephraim Lessings »Emilia Galotti« im Kulturraum Schule (1830-1914), Göttingen: V&R unipress, S. 85-106.
Kerner, Gustav (1893/2015): Über Lessings Emilia Galotti [1893], in: Carsten Gansel/Birka Siwczyk (Hrsg.), Gotthold Ephraim Lessings »Emilia Galotti« im Kulturraum Schule (1830-1914), Göttingen: V&R unipress, S. 247-264.
Marseille, Gustav (1904/2015): Die Urbilder der Frauengestalten in Lessings Meisterdramen [1904], in: Carsten Gansel/Birka Siwczyk (Hrsg.), Gotthold Ephraim Lessings »Emilia Galotti« im Kulturraum Schule (1830-1914), Göttingen: V&R unipress, S. 293-316.
Martens, Wolfgang (1995): Zum Marinelli-Typus vor Lessing, in: Richard Fisher (Hrsg.), Ethik und Ästhetik. Werke und Werte in der Literatur vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main: Peter Lang, S. 69-79.
McCarthy, John A. (1993): „So viel Worte, so viel Lügen“. Überzeugungsstrategien in Emilia Galotti und Nathan der Weise, in: Wolfram Mauser/Günter Saße (Hrsg.), Streitkultur. Strategien des Überzeugens im Werk Lessings, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, S. 349-362.
Memmolo, Pasquale (1995): Strategen der Subjektivität. Intriganten in Dramen der Neuzeit, Würzburg: Königshausen & Neumann (Epistemata: Würzburger wissenschaftliche Schriften, Reihe Literaturwissenschaft, Bd. 141).
Menke, Bettine (2014): Die ‚Äußerlichkeit‘ der Trauerspiel-Dramaturgie, Komik und Zufälle der Intrige. Mit Calderón und Shakespeare zu Grenzen und zum Nachleben des Trauerspiels, in: Claude Haas/Daniel Weidner (Hrsg.), Benjamins Trauerspiel. Theorie – Lektüren – Nachleben, Berlin: Kulturverlag Kadmos, S. 29-57.
Rösler, Johann Karl (1897/2015): Die Handlung und Charaktere in Lessings Emilia Galotti [1897], in: Carsten Gansel/Birka Siwczyk (Hrsg.), Gotthold Ephraim Lessings »Emilia Galotti« im Kulturraum Schule (1830-1914), Göttingen: V&R unipress, S. 265-276.
Schenkel, Martin (1986): „Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verlieret, der hat keinen zu verlieren.“ Zur Dialektik der bürgerlichen Aufklärung in Lessings Emilia Galotti, in: ZfdPh 105/2, S. 161-186.
Stauf, Renate (2002): „O Galotti, wenn Sie mein Freund, mein Führer, mein Vater seyn wollten!“ Über die versäumte Fürstenerziehung in Lessings Emilia Galotti, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 52, S. 129-152.
Stephan, Inge (1985): „So ist die Tugend ein Gespenst“. Frauenbild und Tugendbegriff im bürgerlichen Trauerspiel bei Lessing und Schiller, in: Lessing Yearbook/Jahrbuch 17, S. 1-20.
Takahashi, Yoshito (1995): Antagonismus zwischen bürgerlichem Ideal und höfischer Realität. Problematik des bürgerlichen Bewußtseins in Lessings "Emilia Galotti", in: Klaus Garber/Teruaki Takahashi (Hrsg.), „Sei mir, Dichter, Willkommen!“. Studien zur deutschen Literatur von Lessing bis Jünger, Köln: Böhlau Verlag, S. 17-28.
Thielicke, Helmut (1965): Nachwort, in: Die Erziehung des Menschengeschlechts und andere Schriften, Stuttgart: Philipp Reclam jun., S. 81-94.
[...]
1 Als bekannte Ausnahme hierzu führt Peter-André Alt (2004: 16) den Charakter der ehrgeizigen und skrupellosen Lady Macbeth aus Shakespeares Tragödie Macbeth (Erscheinungsjahr: 1606) an, die zusammen mit ihrem Ehemann ihre Mordgedanken umsetzt.
2 Gemeint ist v. a. der Verweis auf Macht und Gelegenheit statt Recht und Pflicht – die „ occasio “, wie es Alt (2004: 15) formuliert. Diese Argumente zielen mehr auf die Subjektivität und Autonomie des Individuums statt auf dessen Heteronomie-Bewusstsein.
3 Die Destabilisierung vollzieht sich dabei z. B. in Form einer (gewaltsamen) räumlichen Trennung der Figuren, dem Streuen von Gerüchten, dem Erwecken von falschen Eindrücken, dem Heraufbeschwören von Zweifeln im Gegenüber und/oder der Verstärkung bzw. Förderung der Polarisierung zwischen gegensätzlichen Moralvorstellungen oder gesellschaftlichen Sphären wie höfischer Welt vs. Bürgertum.
4 Neben Erweiterung von Machteinfluss spielt vermutlich auch das schlechte persönliche Verhältnis zwischen Marinelli und Appiani eine Rolle. Tiefere Hintergründe erfahren wir im Stück allerdings nicht; wir wissen nur, dass Marinelli Appiani v. a. seit den Heiratsplänen mit Emilia als seiner höfischen Welt nicht mehr würdig ansieht.
5 Hier und im Folgenden zitiert nach: Lessing, Gotthold Ephraim; Krause, Thorsten (Hrsg.) (1772/2014): Emilia Galotti. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, Reihe „Reclam XL – Text und Kontext“ (Universal-Bibliothek, Nr. 45), Ditzingen: Philipp Reclam jun.
6 Dabei liegt er jedoch oft falsch mit seiner Interpretation, so deutet er z. B. das Verhalten von Emilias Mutter auf dem Lustschloss zunächst als Freude über die Liebe des Prinzen zu Emilia, was sogar dieser als lächerlich zurückweist: „Sie sind ein schlechter Beobachter! – Die Tochter stürzte der Mutter ohnmächtig in die Arme. Darüber vergaß die Mutter ihre Wut: nicht über mir.“ (IV/1, S. 54)
7 So z. B. im Gespräch mit Orsina, von dem er dem Prinzen berichtet: „Sie wollte sich ganz gelassen und kalt stellen. Aber mitten in dem gleichgültigsten Gespräche, entfuhr ihr eine Wendung, eine Beziehung über die andere, die ihr gefoltertes Herz verriet. Mit dem lustigsten Wesen sagte sie die melancholischsten Dinge: und wiederum die lächerlichsten Possen mit der allertraurigsten Miene.“ (I/6, S. 13, Herv. d. Verf.)
8 „Wenn sie [Emilia] ihn [den Prinzen] nicht selbst stürzen gesehen – Und das muss sie wohl nicht; da sie so fortgeeilet“ (III/4, S. 46).
9 Auch hier sind seine Einschätzungen stark subjektiv und von seiner höfischen Perspektive gefärbt, daher nicht zwangsläufig korrekt. So äußert er gegenüber seinem Diener Battista kurz bevor Claudia auf dem Schloss eintrifft: „Wenn ich die Mütter recht kenne: – so etwas von einer Schwiegermutter eines Prinzen zu sein, schmeichelt die meisten.“ (III/6, S. 50)
10 Dies zeigt sich auch auf räumlicher Ebene: Marinelli muss sie davon abhalten, ungefragt in die Gemächer des Prinzen vorzudringen. (vgl. Dörr 2012: 316)
11 „Denn ihr Schicksal ist schrecklich. – Armes, gutes Mädchen, eben da er dein auf immer werden sollte, wird er [dein Bräutigam] dir auf immer entrissen!“ (IV/5, S. 64)
12 Gemeint sind hier die Bittschriften, die der Prinz gleich zu Beginn des Stücks überfliegt und willkürlich unterschreibt: „Eine Emilia? – Aber eine Emilia Bruneschi – nicht Galotti. […] Was will sie, diese Emilia Bruneschi? (Er lieset.) Viel gefordert; sehr viel. – Doch sie heißt Emilia. Gewährt!“ (I/1, S. 5)
13 Schnelle Meinungsumschwünge sind für Hettore typisch. So reicht schon ein einfacher (lügnerischer) Schwur Marinellis aus, um den Prinzen dazu zu bringen, ihm zu verzeihen und ihn nicht mehr als treulos und hämisch anzusehen (vgl. I/6, S. 16).
14 Gerade was die Anwendung von Gewalt angeht, bleibt er in seiner Positionierung sehr vage. Er wirft Marinelli zwar vor, zu weit gegangen zu sein, allerdings lehnt er Gewalt kategorisch nicht ab: „[A]uch ich erschrecke vor einem kleinen Verbrechen nicht. Nur, guter Freund, muss es ein kleines stilles Verbrechen, ein kleines heilsames Verbrechen sein.“ (IV/1, S. 56)
15 Er überlässt Marinelli freie Hand, ohne sich über die genauen Hintergründe seines Plans zu erkundigen. Dass er bewusst den Tod Appianis in Kauf nimmt, ist dabei nicht auszuschließen. Wahrscheinlicher scheint mir hier aber eine grobe Fahrlässigkeit bzw. Naivität, die u. a. in seinem triebhaften Begehren nach Emilia begründet liegt.
16 „Er versetzte, dass er auf heute doch noch etwas Wichtigers zu tun habe, als sich mit mir den Hals zu brechen. Und so beschied er mich auf die ersten acht Tage nach der Hochzeit.“ (III/1, S. 41)
17 Orsina hatte dem Prinzen zwar einen Brief geschrieben, in dem sie ihn bat, ihr auf das Schloss zu folgen, allerdings hatte der Prinz diesen nicht gelesen und war nur wegen Emilia dorthin gegangen.
18 Diesen Zwischenfall nutzt er allerdings auch für seine Zwecke aus. So redet Marinelli dem Prinzen ein, dass er sich selbst durch die Aktion verdächtig gemacht habe und dass er deswegen das weitere Handeln doch auch Marinelli überlassen solle. Zudem ist dies eine Gelegenheit für den Kammerherrn, seine angeblich grenzenlose und selbstlose Loyalität und Kampfbereitschaft für den Prinzen zu betonen. So behauptet er, dass er sogar sein Leben im Duell mit Appiani aufs Spiel gesetzt hätte (vgl. III/1, S. 40). Vgl. auch Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit.
19 „Nun dann! Was läge an meinen Anstalten? dass den Prinzen bei diesem Unfalle ein so sichtbarer Verdacht trifft? – An dem Meisterstreiche liegt das, den er selbst meinen Anstalten mit einzumengen die Gnade hatte. […] Er erlaube mir, ihm zu sagen, dass der Schritt, den er heute Morgen in der Kirche getan […] dennoch nicht in den Tanz gehörte.“ (IV/1, S. 57, Herv. d. Verf.). Es ist zwar richtig, dass die Er-Anrede im 18. Jahrhundert weitaus verbreiteter war, allerdings eher für Untergebene und Angehörige eines unteren Standes. Außerdem verwendet sie Marinelli in dem Stück sonst auch nicht.
20 Z. B. „Also, kurz und einfältig. Da ich die Sache übernahm, nicht wahr, da wusste Emilia von der Liebe des Prinzen noch nichts? Emiliens Mutter noch weniger. Wenn ich nun auf diesen Umstand baute? und der Prinz indes den Grund meines Gebäudes untergrub?“ (IV/1, S. 57)
21 „Entfernen Sie sich, gnädiger Herr. […] Geschwind entfernen Sie sich.“ (III/1, S. 43)
22 Zuvor Claudia: „Sie waren es ja – nicht? – […] mit dem er Streit bekam?“ (ebd.)
23 Zuvor Claudia: „Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen.“ (ebd.)
24 Zuvor Claudia: „Und Marinelli, Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen! Mit einem Tone!“ (ebd.)
25 V. a. was seine Pläne angeht: „Auf das alles weiß ich freilich noch nichts zu antworten. Aber wir müssen sehen. Gedulden Sie sich, gnädiger Herr. Der erste Schritt musste doch getan sein.“ (III/3, S. 45); „Da sind tausend Dinge, auf die sich weiter fußen lässt.“ (ebd.)
26 Z. B. „Man hat Verdacht, dass es nicht Räuber gewesen, welche den Grafen angefallen.“ (V/5, S. 79); „Man werde vorderhand nicht verstatten können, dass Mutter und Tochter sich sprechen.“; „Man werde genötiget sein, Mutter und Tochter zu trennen.“ (V/5, S. 81)
27 „ (Mit einer angenommenen Hitze.) Wer das von mir denken kann!“ (IV/1, S. 55)
28 „Schwur dann gegen Schwur: Wenn ich von dieser Liebe das Geringste gewusst, das Geringste vermutet habe; so möge weder Engel noch Heiliger von mir wissen!“ (I/6, S. 16)
29 Marinellis Antwort auf Appianis Hinweis, er könne nicht sofort als Gesandter nach Massa abreisen: „Sie scherzen, Herr Graf.“ (II/10, S. 36)
30 Obwohl er von der Hochzeit weiß, will er Appianis Entschuldigung hören: „Die bin ich begierig, zu hören.“ (ebd.)
31 „Einen zweiten Schuss wäre er ja wohl noch wert gewesen. – Und wie er sich vielleicht nun martern muss, der arme Graf! – Pfui, Angelo!“ (III/2, S. 44). Dabei geht es Marinelli nur um die Gewissheit darüber, dass Appiani auch tot ist.
32 Im Folgenden beziehen sich alle Seitenangaben auf IV/7, sofern dies nicht anders gekennzeichnet ist.
33 „Mein Herr, ich muss Sie hier mit einer Dame lassen, die – der – mit deren Verstande – Sie verstehen mich.“ (IV/6, S. 68)
34 „Ah, wenn Sie wüssten, – wenn Sie wüssten, wie überschwänglich, wie unaussprechlich, wie unbegreiflich ich von ihm beleidiget worden, und noch werde: – Sie könnten, Sie würden Ihre eigene Beleidigung darüber vergessen.“ (S. 71)
35 Orsinas „Gift“ wirkt also; hierzu passt auch ein Zitat von Claudia Galotti sehr gut: „[W]isse, mein Kind, dass ein Gift, welches nicht gleich wirket, darum kein minder gefährliches Gift ist.“ (II/6, S. 30)
36 „Aber warum denn eben Verachtung? Es braucht ja nur Gleichgültigkeit zu sein. Nicht wahr, Marinelli?“ (IV/3, S. 61)
37 „Dann lernen Sie, […] von einem Weibe, dass Gleichgültigkeit ein leeres Wort, ein bloßer Schall ist, dem nichts, gar nichts entspricht. Gleichgültig ist die Seele nur gegen das, woran sie nicht denkt; nur gegen ein Ding, das für sie kein Ding ist. Und nur gleichgültig für ein Ding, das kein Ding ist, – das ist so viel, als gar nicht gleichgültig.“ (ebd.)
38 So drückt er beispielsweise seine Sympathie für Appiani und dessen Empfindungen aus („Wer sich den Eindrücken, die Unschuld und Schönheit auf ihn machen, ohne weitere Rücksicht, so ganz überlassen darf; – ich dächte, der wäre eher zu beneiden, als zu belachen. […] [B]ei alldem ist [Appiani] doch ein sehr würdiger junger Mann, ein schöner Mann, ein reicher Mann, ein Mann voller Ehre.“ [I/6, S. 14]) und beklagt „das Zeremoniell, de[n] Zwang, die Langeweile, und nicht selten die Dürftigkeit“ (I/6, S. 14 f.) am Hof.
39 Auf dem Hof als politisch-kulturelles Zentrum hat dies besonders verheerende Auswirkungen: „Wo Macht und Verantwortung von einer einzigen Person abhängen, muss sich deren moralisches Versagen verheerend für die anderen auswirken. Fürstliche Liebenswürdigkeit und Gutherzigkeit – so zeigt sich – vermögen wenig, solange die Ausübung von Herrschaft auf Kreaturen vom Schlage eines Marinelli angewiesen ist.“ (Stauf 2002: 149)
- Quote paper
- Julian Tomic (Author), 2019, Intrige und Intriganten in Lessings "Emilia Galotti", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1601854