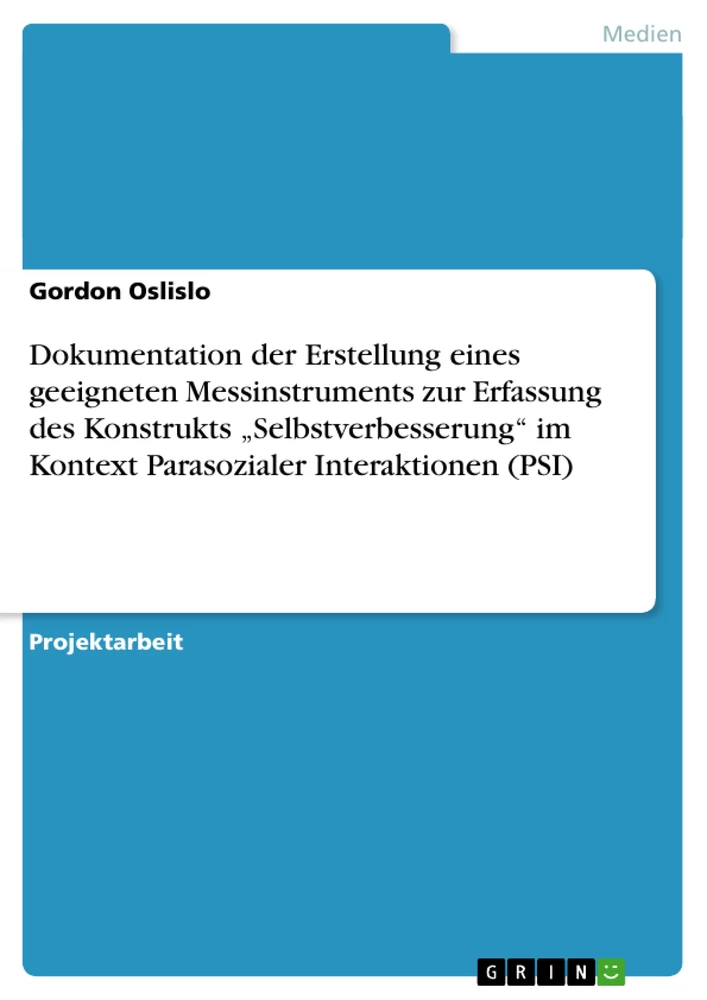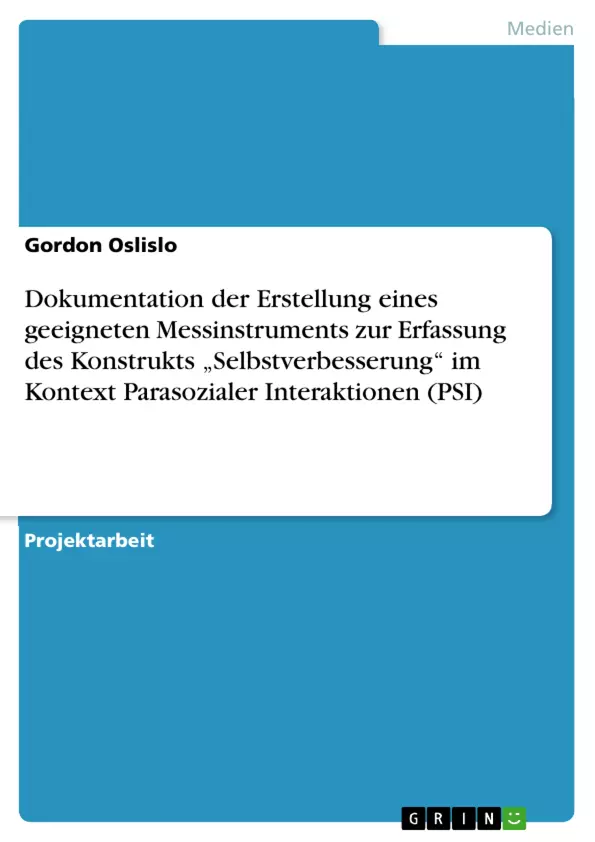Der vorliegende Text liefert die theoretische und praktische Dokumentation eines Messinstruments für das Konstrukt der "Selbstverbesserung" innerhalb der Theorie Parasozialer Interaktionen und Beziehungen (PSI/PSB). In gebotener Kürze und sachlogischer Vorgehensweise wird die Operationalisierung des Konstruktes und deren Übertragung in ein Befragungsinstrument vollzogen. Dabei werden theoretische Grundbegriffe für die Erstellung eines Befragungsinstruments berücksichtigt und exponiert. Im Anhang befindet sich das Instrument.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Dokumentation der Operationalisierung des Konstrukts
- 2. Dokumentation der Items
- 3. Dokumentation der Formalien des Instruments
- 4. Zusammenfassung & Ausblick
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, ein Messinstrument zur Erfassung des Konstrukts „Selbstverbesserung“ im Kontext parasozialer Interaktionen zu entwickeln. Das Konstrukt wird in verschiedene Dimensionen (psychologisch und physiologisch) und Subdimensionen (kognitiv, affektiv, konativ, optisch) zerlegt. Die Untersuchung analysiert die Zusammenhänge zwischen Selbstverbesserung, sozialen Vergleichsprozessen und Mediennutzung.
- Operationalisierung des Konstrukts „Selbstverbesserung“
- Entwicklung eines Itemkatalogs zur Messung der Selbstverbesserung
- Analyse der verwendeten Frageform und deren methodische Limitationen
- Zusammenhang zwischen Selbstverbesserung und sozialen Vergleichsprozessen
- Rolle der Mediennutzung bei Selbstverbesserungsprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Dokumentation der Operationalisierung des Konstrukts: Dieses Kapitel beschreibt die Operationalisierung des Konstrukts „Selbstverbesserung“ im Kontext von Mediennutzung und sozialen Vergleichsprozessen. „Selbstverbesserung“ wird in die Hauptdimensionen „psychologische Verbesserung“ (kognitiv, affektiv, konativ) und „physiologische Verbesserung“ (optisch) unterteilt. Die Operationalisierung legt den Fokus auf die soziale Ebene der Selbstverbesserung und deren Rolle im gesellschaftlichen Leben. Es werden Forschungsfragen formuliert, die die Grundlage für den späteren Itemkatalog bilden, beispielsweise die Frage, ob Menschen ihren Wissensstand, ihre Gefühlsregulation, ihr Verhalten oder ihr Aussehen verbessern möchten. Der Bezug zu Theorien sozialer Vergleichsprozesse (Festinger, Schemer) wird hergestellt, um den theoretischen Hintergrund der Selbstverbesserung zu belegen und deren Verbindung zu Selbstbewertungs- und Selbstwerterhöhungsprozessen zu erklären.
2. Dokumentation der Items: Dieses Kapitel präsentiert den Itemkatalog zur Messung der Selbstverbesserung. Es wird detailliert beschrieben, welche Items welche Subdimension (kognitiv, affektiv, konativ, optisch) messen und wie die Items im Fragebogen angeordnet sind. Beispielsweise messen die Items 1, 2, 4 und 18 die kognitive Subdimension (Wissenszuwachs), während Items 5, 10, 11, 12, 13 und 19 die affektive Subdimension (Gefühlsmanagement) erfassen. Die Kapitel verdeutlicht die Zuordnung der Items zu den verschiedenen Subdimensionen und diskutiert den konativen Charakter der Items aufgrund der gewählten Verhaltensfrage-Formulierung.
3. Dokumentation der Formalien des Messinstruments: Dieses Kapitel befasst sich mit den formalen Aspekten des entwickelten Messinstruments. Es wird erläutert, warum eine Verhaltensfrage zur Erfassung der intentionalen Natur des Konstrukts „Selbstverbesserung“ gewählt wurde. Die Vorteile und Nachteile dieser Frageform werden diskutiert, wobei insbesondere die Abhängigkeit von der Selbstauskunft der Befragten und die hypothetische Natur von Fragen zum zukünftigen Verhalten kritisch beleuchtet werden. Es wird betont, dass eine Beobachtung des Verhaltens eine adäquatere Erfassung ermöglichen würde. Die Kapitel beschreibt die gewählte Gesprächs- und Fragenlogik, die wertneutrale Formulierung der Fragen und die Bereitstellung genauer Instruktionen für die Befragten.
Schlüsselwörter
Selbstverbesserung, Soziale Vergleichsprozesse, Parasoziale Interaktionen, Mediennutzung, Messinstrument, Itementwicklung, Verhaltensfrage, kognitive, affektive, konative, optische Verbesserung, psychologische Verbesserung, physiologische Verbesserung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Messinstrument zur Erfassung von Selbstverbesserung im Kontext parasozialer Interaktionen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Dokumentation eines Messinstruments zur Erfassung des Konstrukts „Selbstverbesserung“ im Kontext parasozialer Interaktionen und der Analyse der Zusammenhänge zwischen Selbstverbesserung, sozialen Vergleichsprozessen und Mediennutzung.
Wie ist das Konstrukt „Selbstverbesserung“ operationalisiert?
Das Konstrukt „Selbstverbesserung“ wird in die Hauptdimensionen „psychologische Verbesserung“ (kognitiv, affektiv, konativ) und „physiologische Verbesserung“ (optisch) unterteilt. Der Fokus liegt auf der sozialen Ebene der Selbstverbesserung und ihrer Rolle im gesellschaftlichen Leben. Die Operationalisierung basiert auf Forschungsfragen, die untersuchen, ob Menschen ihren Wissensstand, ihre Gefühlsregulation, ihr Verhalten oder ihr Aussehen verbessern möchten. Der Bezug zu Theorien sozialer Vergleichsprozesse (Festinger, Schemer) wird hergestellt.
Welche Aspekte werden im Itemkatalog erfasst?
Der Itemkatalog erfasst verschiedene Subdimensionen der Selbstverbesserung: kognitive (Wissenszuwachs), affektive (Gefühlsmanagement), konative (Verhalten) und optische (Aussehen). Das Kapitel beschreibt detailliert, welche Items welche Subdimension messen und wie die Items im Fragebogen angeordnet sind. Die Verhaltensfrage-Formulierung verleiht den Items einen konativen Charakter.
Welche Frageform wurde verwendet und welche methodischen Limitationen gibt es?
Es wurde eine Verhaltensfrage gewählt, um die intentionale Natur des Konstrukts „Selbstverbesserung“ zu erfassen. Die Vorteile und Nachteile dieser Frageform werden diskutiert. Kritisch beleuchtet werden die Abhängigkeit von der Selbstauskunft der Befragten und die hypothetische Natur von Fragen zum zukünftigen Verhalten. Eine Beobachtung des Verhaltens würde eine adäquatere Erfassung ermöglichen.
Welche Formalien des Messinstruments werden beschrieben?
Das Kapitel beschreibt die gewählte Gesprächs- und Fragenlogik, die wertneutrale Formulierung der Fragen und die Bereitstellung genauer Instruktionen für die Befragten. Es wird erläutert, warum eine Verhaltensfrage gewählt wurde und welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstverbesserung, Soziale Vergleichsprozesse, Parasoziale Interaktionen, Mediennutzung, Messinstrument, Itementwicklung, Verhaltensfrage, kognitive, affektive, konative, optische Verbesserung, psychologische Verbesserung, physiologische Verbesserung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: 1. Dokumentation der Operationalisierung des Konstrukts, 2. Dokumentation der Items, 3. Dokumentation der Formalien des Instruments, 4. Zusammenfassung & Ausblick, 5. Literaturverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein Messinstrument zur Erfassung des Konstrukts „Selbstverbesserung“ im Kontext parasozialer Interaktionen zu entwickeln. Das Konstrukt wird in verschiedene Dimensionen (psychologisch und physiologisch) und Subdimensionen (kognitiv, affektiv, konativ, optisch) zerlegt.
- Citation du texte
- B.A. Gordon Oslislo (Auteur), 2009, Dokumentation der Erstellung eines geeigneten Messinstruments zur Erfassung des Konstrukts „Selbstverbesserung“ im Kontext Parasozialer Interaktionen (PSI), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160245