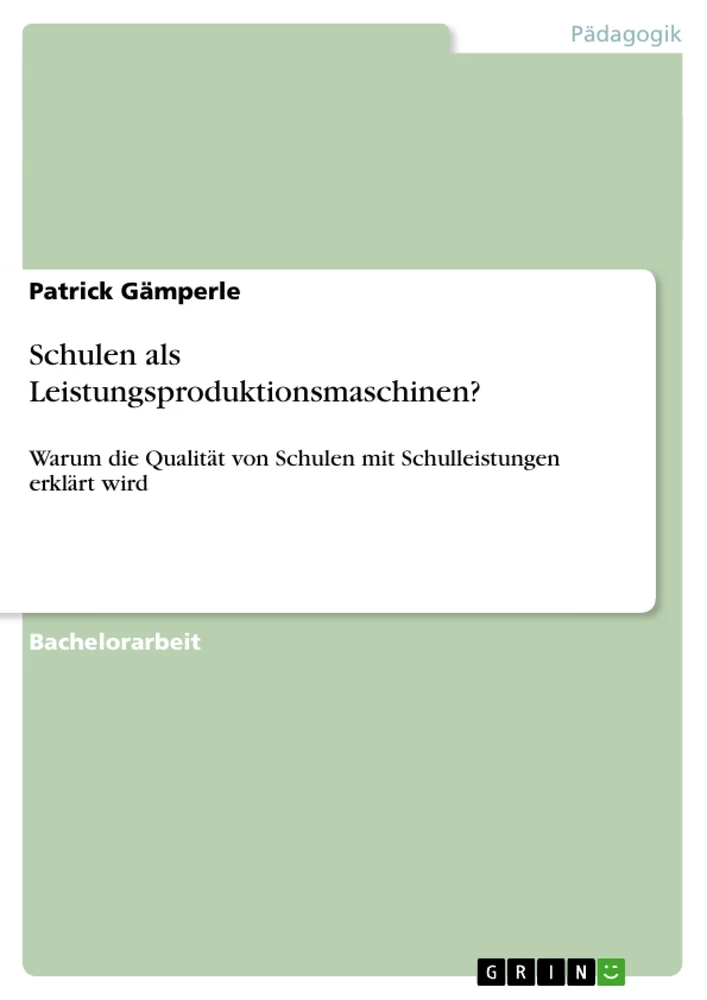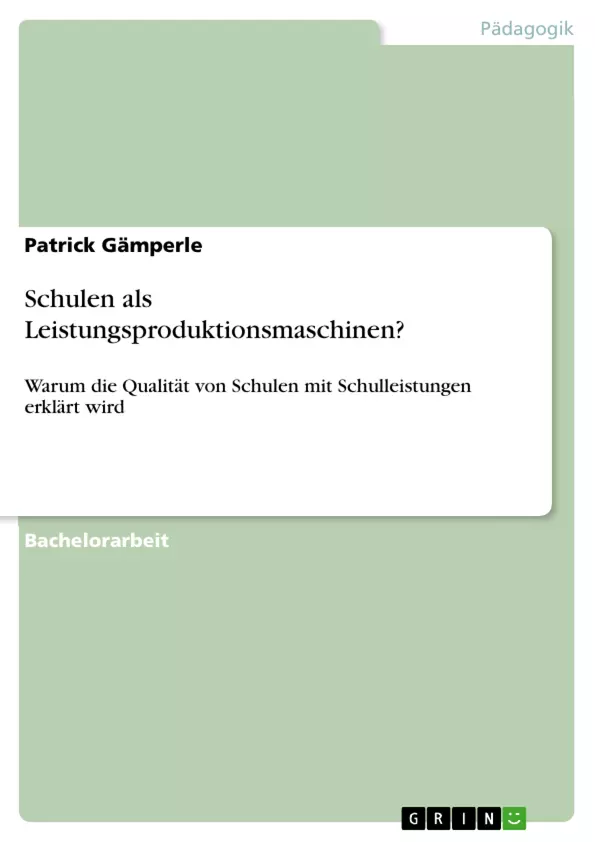Steigende Ansprüche an das Bildungswesen betonen Qualitätsfragen seit den 1990er Jahren immer stärker. Was diese Qualität hingegen ausmacht und wie sie gesichert werden könnte, ist bis heute ungeklärt geblieben. In der einschlägigen Qualitätsdebatte scheint sich allerdings abzuzeichnen, dass im Bildungswesen in der Regel von einem technologischen, der Betriebswirtschaftslehre entlehnten Paradigma ausgegangen wird. Analog zur Evaluation von Betrieben wird diesem Paradigma zufolge die Qualität von Bildungssystemen bzw. -institutionen zunehmend auf deren Wirksamkeit bzw. Leistungen zurückgeführt. Meine These lautet demnach, dass bei der Evaluation von Bildungsinstitutionen bzw. -systemen in erster Linie Schulleistungen als zentrales Qualitätskriterium herangezogen werden. Ich stelle mir aufgrund dieser These die Frage, inwieweit sich diese Leistungssteuerung bereits in der Praxis auswirkt und inwiefern wissenschaftstheoretische Input-Output-Modelle schulischer Wirksamkeit diesen bildungspolitischen Trend legitimieren.
Der Hauptteil ist in zwei Stränge aufgegliedert: Im ersten Teil wird der Paradigmenwechsel in der Steuerung des Schulwesens diskutiert Zunächst werde ich auf die Auslöser dieser neuen Schulsteuerungsmodelle hinweisen. In einem zweiten Schritt soll dieses neue Steuerungsparadigma vorgestellt werden. Das auf dieses Steuerungsparadigma zurück gehende New Public Management-Konzept wird anschliessend thematisiert. In einem abschliessenden Unterkapitel des ersten Stranges soll schliesslich am konkreten Beispiel der Bildungsstandards illustriert werden, inwiefern der Gedanke der Leistungssteuerung bereits Eingang in die Steuerung des Bildungswesens genommen hat. In einem zweiten Strang des Hauptteils werde ich den wissenschaftstheoretisch begründeten Stellenwert von Schulleistungen für die Effektivität bzw. Wirksamkeit von Schulen näher beleuchten. Input-Output-Modelle schulischer Wirksamkeit bilden hierbei meine analytische Grundlage. Zunächst werde ich nacheinander pädagogisch-psychologische, bildungsökonomische und organisationstheoretische Input-Output-Modelle vorstellen. In einer Synthese dieser Modelle werde ich anschliessend untersuchen, inwieweit der Schulleistungsaspekt als zentrales Output-Kriterium – und somit als zentrales Qualitätskriterium – wissenschaftstheoretisch legitimiert ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundbegriffe zu schulischer Wirksamkeit bzw. Qualität
- Systemebenen bei der Schulevaluation
- Das Bildungssystem als gesellschaftliches Teilsystem
- Systemebenen des Bildungssystems: Mikro-, Meso- und Makroebene...
- Wirksamkeit bzw. Effektivität im Bildungsbereich.........
- Schulische Wirksamkeit: „School Effectiveness“.
- Pädagogische Wirksamkeit: „Educational Effectiveness“.
- Input-(Prozess)-Output-Modelle schulischer Wirksamkeit...
- Paradigmenwechsel in der Steuerung des Bildungssystems
- Auslöser für die Diskussion neuer Steuerungsmodelle......
- Neue Steuerung des Bildungswesens: „Educational Governance“.
- Marktsteuerung und New Public Management....
- Der Schulleistungsaspekt am Beispiel der nationalen Bildungsstandards.
- Input-Output-Modelle schulischer Wirksamkeit..
- Pädagogisch-psychologische Perspektive
- Modelle unter dem Paradigma der Zeit.
- Das Modell von Carroll (1963).
- Das Modell von Cooley (et al. 1975).
- Das Modell von Bloom (1976)
- Das Modell von Harnischfeger (et al. 1976)
- Das Modell von Bennett (1978)..
- Modelle unter dem Paradigma psychologischer Lerntheorien….......
- Das Modell von Gagné (1977)..
- Das Modell von Bruner (1971).
- Das Modell von Glaser (1976)..
- Bildungsökonomische Perspektive........
- Ökonomisches Denken in der Erziehungswissenschaft
- Bildungsökonomische Modelle schulischer Wirksamkeit.
- Organisationstheoretische Perspektive.
- Organisationstheoretisches Denken in der Erziehungswissenschaft.
- Organisationstheoretische Modelle schulischer Wirksamkeit......
- Synthese: Der Schulleistungsaspekt in Input-Output-Modellen schulischer Wirksamkeit... - 55 -
- Diskussion........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit von Patrick Gämperle untersucht die zunehmende Betonung von Schulleistungen als zentrales Qualitätskriterium in der Evaluation von Bildungseinrichtungen. Der Text analysiert die Entwicklung hin zu einem technologischen Paradigma, das die Qualität von Bildungssystemen an deren Wirksamkeit und Leistung misst, insbesondere im Kontext von nationalen und internationalen Schulleistungsvergleichsstudien.
- Die Dominanz des Leistungsprinzips in der aktuellen Schulqualitätsevaluation
- Der Einfluss von Input-Output-Modellen auf die Steuerung des Bildungswesens
- Die Rolle von Bildungsstandards als Ausdruck der Leistungssteuerung
- Die wissenschaftliche Fundierung des Schulleistungsaspekts in Input-Output-Modellen
- Die Implikationen des Leistungsprinzips für die Bildungslandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung Die Einleitung stellt die Relevanz von Bildung in der Wissensgesellschaft heraus und zeigt die steigende Bedeutung von Qualitätsfragen im Bildungsbereich auf. Die Arbeit argumentiert, dass Schulleistungen in der Evaluation von Bildungseinrichtungen dominieren und untersucht den Einfluss von Input-Output-Modellen auf diesen Trend.
- Kapitel 2: Grundbegriffe zu schulischer Wirksamkeit bzw. Qualität Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es beleuchtet die Systemebenen bei der Schulevaluation, insbesondere das Bildungssystem als gesellschaftliches Teilsystem und die verschiedenen Ebenen des Bildungssystems. Der Fokus liegt auf den Begriffen Effektivität und Effizienz im Schulwesen, die eng mit dem Qualitätsbegriff verknüpft sind, sowie auf Input-Output-Modellen als Grundlage für die Analyse von Effektivität.
- Kapitel 3: Paradigmenwechsel in der Steuerung des Bildungssystems Das Kapitel diskutiert den Wandel in der Steuerung des Schulwesens. Es beleuchtet die Auslöser für neue Steuerungsmodelle, wie z.B. die Globalisierung und die Verknappung öffentlicher Finanzmittel, und stellt das Konzept des „Educational Governance“ vor. Der Einfluss von New Public Management und die Betonung des Leistungsaspekts im Zusammenhang mit Schulqualität werden ebenfalls betrachtet. Das Kapitel beleuchtet am Beispiel der Bildungsstandards, wie der Gedanke der Leistungssteuerung bereits Eingang in die Steuerung des Bildungswesens gefunden hat.
- Kapitel 4: Input-Output-Modelle schulischer Wirksamkeit Kapitel 4 analysiert wissenschaftliche Input-Output-Modelle, die den Stellenwert von Schulleistungen für die Effektivität und Wirksamkeit von Schulen beleuchten. Es stellt verschiedene Modelle aus pädagogisch-psychologischer, bildungsökonomischer und organisationstheoretischer Perspektive vor und untersucht, inwieweit der Schulleistungsaspekt als zentrales Output-Kriterium und damit als Qualitätskriterium wissenschaftstheoretisch legitimiert ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Paradigmenwechsel in der Steuerung des Bildungssystems, insbesondere mit der Dominanz des Leistungsprinzips in der Evaluation von Bildungseinrichtungen. Zentral sind die Begriffe Schulqualität, Wirksamkeit, Effektivität, Input-Output-Modelle, Bildungsstandards und New Public Management. Der Text analysiert die wissenschaftliche Fundierung des Schulleistungsaspekts im Kontext von Input-Output-Modellen und untersucht die Implikationen des Leistungsprinzips für die Bildungslandschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These dieser Arbeit zur Schulqualität?
Die These lautet, dass bei der Evaluation von Schulen zunehmend Schulleistungen als primäres Qualitätskriterium herangezogen werden, ähnlich einem betriebswirtschaftlichen Paradigma.
Was bedeutet 'New Public Management' im Bildungskontext?
Es beschreibt einen Steuerungswandel, bei dem Schulen nach Effizienz- und Leistungskriterien gesteuert werden, oft orientiert an Marktmechanismen.
Was sind Input-Output-Modelle in der Schulevaluation?
Diese Modelle analysieren die Wirksamkeit von Schulen, indem sie die Ressourcen (Input) ins Verhältnis zu den messbaren Leistungen der Schüler (Output) setzen.
Welche Rolle spielen Bildungsstandards bei der Leistungssteuerung?
Nationale Bildungsstandards dienen als Instrument, um Schulleistungen vergleichbar zu machen und die Qualität des Bildungssystems über den Output zu steuern.
Was versteht man unter 'Educational Governance'?
Es bezeichnet die neue Form der Steuerung und Koordinierung des Bildungswesens unter Berücksichtigung verschiedener Akteure und Ebenen (Mikro, Meso, Makro).
- Quote paper
- Patrick Gämperle (Author), 2009, Schulen als Leistungsproduktionsmaschinen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160667