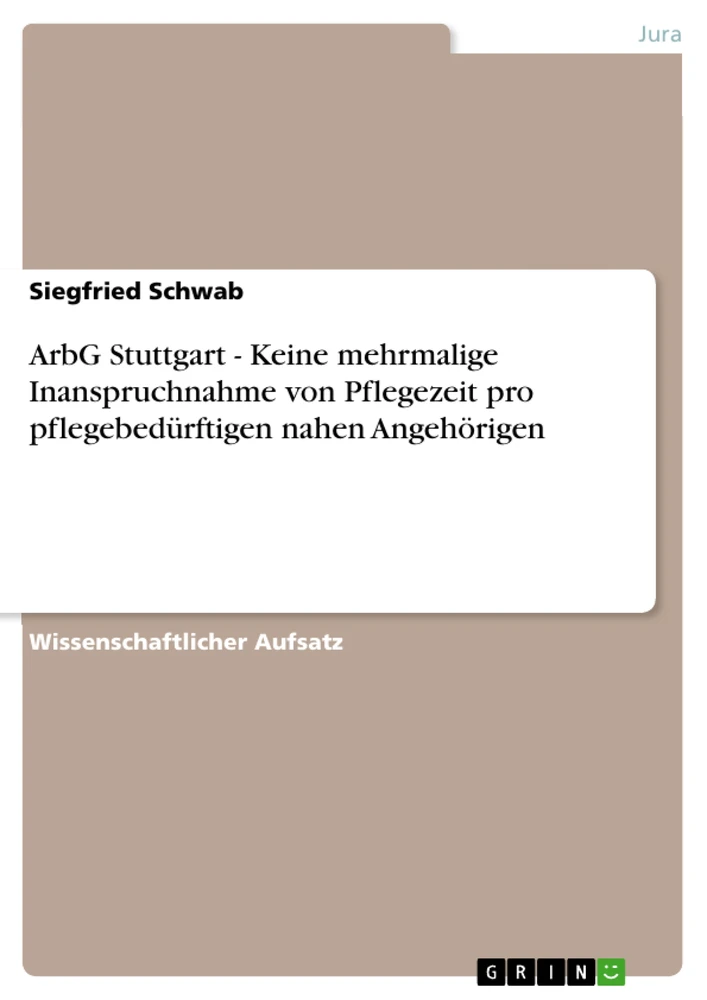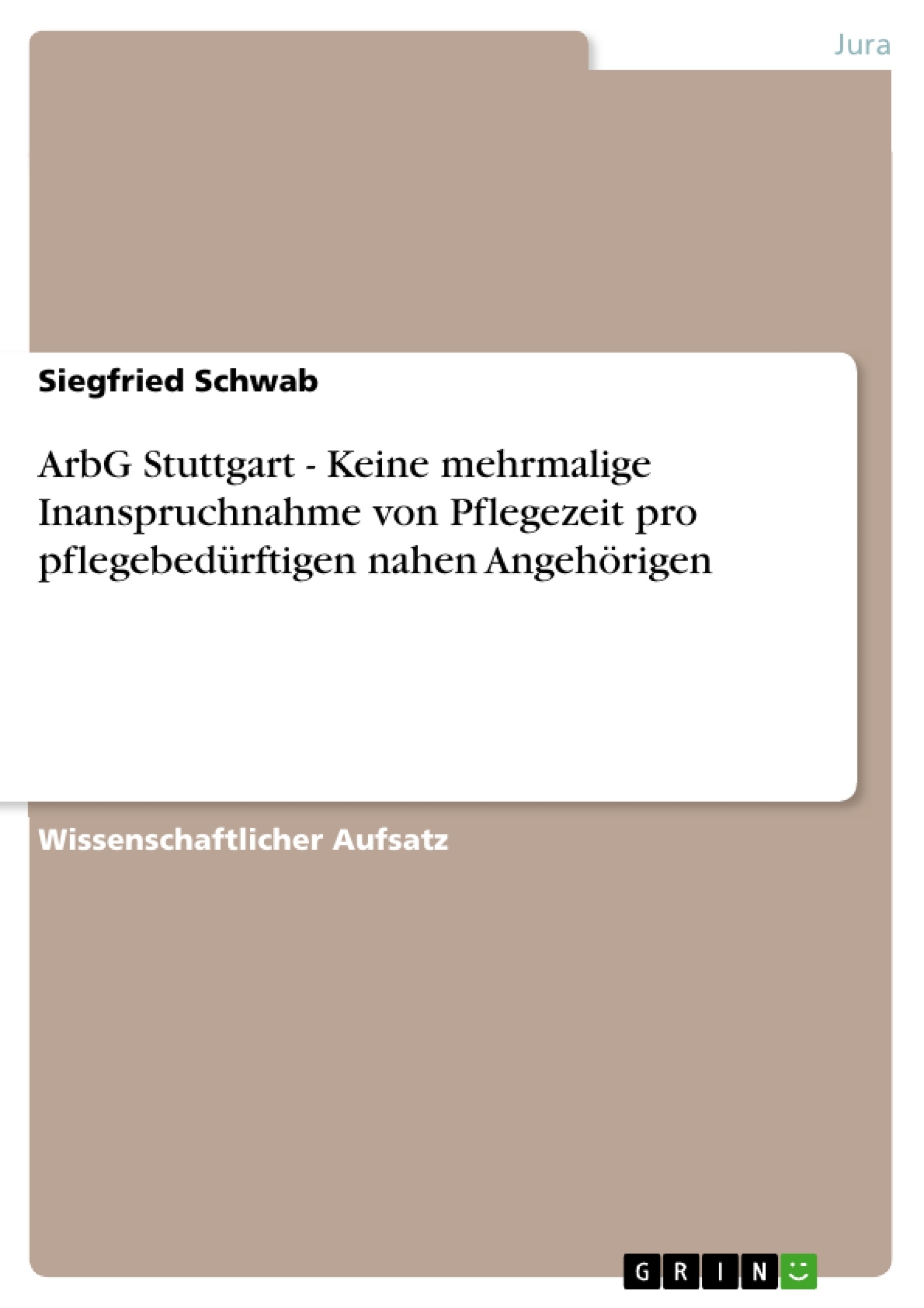Die Auseinandersetzung mit dem Gedanken, als Pflegefall langfristig oder gar dauernd auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, scheuen viele Menschen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Pflegebedürftigkeit und Pflege ein Stück Realität in einer alternden Gesellschaft darstellen. So gab es (Stand Dezember 2007) in Deutschland 2,25 Mio. Menschen, die pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) waren. Damit hat die Zahl der Pflegebedürftigen im Vergleich zu Dezember 1999 um 231.000 Personen oder 11,4 % zugenommen. Die Pflegezeit nach § 3 PflegeZG kann pro pflegebedürftigen nahen Angehörigen nur einmal ununterbrochen bis zu einer Gesamtdauer von längstens 6 Monaten beansprucht werden.
Das PflegeZG selbst enthält keine eigenständige Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers während der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung. Übt der Beschäftigte sein Leistungsverweigerungsrecht aus § 2 Abs. 1 PflegeZG aus, entfällt sein Vergütungsanspruch nach § 326 Abs. 1 S. 1 Halbs. 1 BGB
Der Begriff der Pflegebedürftigkeit entspricht dem der §§ 14, 15 SGB XI. § 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit (1) 1Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen. Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 1 sind:
1. Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und Bewegungsapparat,
2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane,
3. Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder Orientierungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinderungen, vgl. Müller, a.a.O., RN 19. Nach der Gesetzesbegründung reicht eine voraussichtlich zu erwartende Pflegebedürftigkeit aus, BT-Drucks 16/7439 S. 94. Ausreichend ist danach, wenn aufgrund der Erkrankung voraussichtlich eine Pflegestufe festgestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- ArbG Stuttgart*: Keine mehrmalige Inanspruchnahme von Pflegezeit pro pflegebedürftigen nahen Angehörigen
- Zielsetzung und Themenschwerpunkte
- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Pflege von Angehörigen
- Regulierung der Pflegezeit
- Inanspruchnahme von Pflegezeit
- Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Pflege von Angehörigen
- Entwicklung und Bedeutung der Pflegebedürftigkeit in der Gesellschaft
- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Pflege
- Zielsetzung des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG)
- Kapitel 2: Das Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
- Recht auf Pflegezeit
- Dauer der Pflegezeit
- Verlängerung der Pflegezeit
- Kapitel 3: Kurzzeitige Arbeitsverhinderung zur Organisation der Pflege
- Recht auf kurzzeitige Arbeitsverhinderung
- Dauer der Arbeitsverhinderung
- Voraussetzungen für die Inanspruchnahme
- Kapitel 4: Rechtsprechung zum Pflegezeitgesetz
- Keine mehrmalige Inanspruchnahme von Pflegezeit pro pflegebedürftigen nahen Angehörigen
- Rechtliche Auslegung des Pflegezeitgesetzes
- Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen
- Schlüsselwörter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text befasst sich mit der rechtlichen Auslegung und Anwendung des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG). Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Inanspruchnahme von Pflegezeit durch Beschäftigte zu beleuchten und die Rechtsprechung zu diesem Thema zu analysieren.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Pflege von Angehörigen
- Regulierung der Pflegezeit
- Inanspruchnahme von Pflegezeit
- Auslegung des Pflegezeitgesetzes durch die Rechtsprechung
- Auswirkungen des Pflegezeitgesetzes auf die Arbeitsbeziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Pflege von Angehörigen in Deutschland. Es beleuchtet die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit und die Bedeutung des ambulanten Pflegedienstes in einer alternden Gesellschaft. Das Kapitel führt in die Zielsetzung des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) ein, das die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege verbessern soll.
Kapitel 2 erläutert die Kernregelungen des Pflegezeitgesetzes. Es werden das Recht auf Pflegezeit, die Dauer der Pflegezeit und die Möglichkeiten zur Verlängerung der Pflegezeit behandelt.
Kapitel 3 befasst sich mit der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung, die Beschäftigten im Rahmen der Pflegeorganisation zusteht. Es werden die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme, die Dauer der Arbeitsverhinderung und die rechtlichen Grundlagen erläutert.
Kapitel 4 analysiert die Rechtsprechung zum Pflegezeitgesetz. Es werden die wichtigsten Gerichtsentscheidungen zum Thema Pflegezeit, insbesondere zum Thema der mehrmaligen Inanspruchnahme von Pflegezeit, zusammengefasst und die rechtlichen Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Pflegezeitgesetz, Pflegebedürftigkeit, Angehörige, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Arbeitsrecht, Rechtsprechung, Arbeitsverhinderung, ambulant vor stationär.
Häufig gestellte Fragen
Kann man Pflegezeit für denselben Angehörigen mehrmals nehmen?
Nein, gemäß der Rechtsprechung (ArbG Stuttgart) kann die Pflegezeit nach § 3 PflegeZG pro pflegebedürftigem Angehörigen nur einmal bis zu 6 Monate beansprucht werden.
Besteht während der Pflegezeit ein Anspruch auf Gehalt?
Das Pflegezeitgesetz sieht keine Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers vor. Der Vergütungsanspruch entfällt in der Regel während der Freistellung.
Was gilt als "Pflegebedürftigkeit" im Sinne des Gesetzes?
Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für mindestens sechs Monate in erheblichem Maße Hilfe bei täglichen Verrichtungen benötigen (§§ 14, 15 SGB XI).
Was ist die "kurzzeitige Arbeitsverhinderung"?
Beschäftigte haben das Recht, bis zu 10 Tage der Arbeit fernzubleiben, um eine bedarfsgerechte Pflege für einen nahen Angehörigen in einer Akutsituation zu organisieren.
Reicht eine voraussichtliche Pflegebedürftigkeit für den Antrag aus?
Ja, laut Gesetzesbegründung reicht es aus, wenn aufgrund einer Erkrankung voraussichtlich eine Pflegestufe festgestellt werden wird.
- Quote paper
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Author), 2010, ArbG Stuttgart - Keine mehrmalige Inanspruchnahme von Pflegezeit pro pflegebedürftigen nahen Angehörigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160818