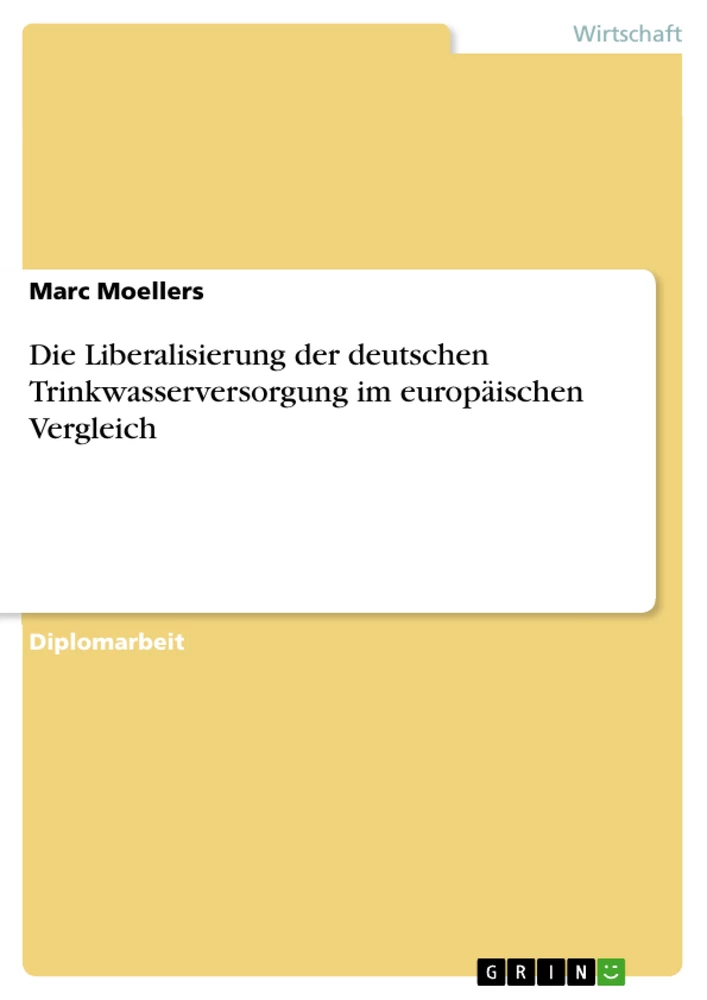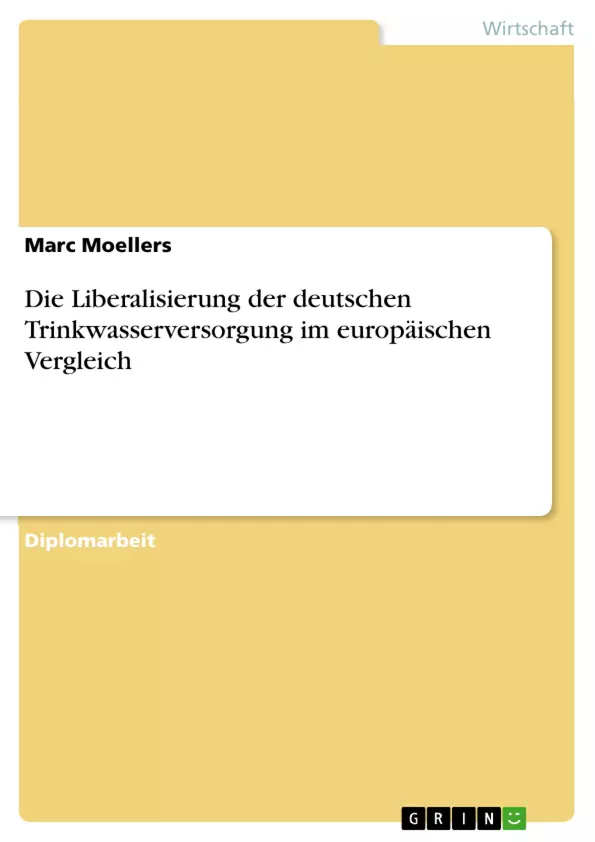Ziel dieser Arbeit soll die Darstellung und Diskussion einer möglichen Liberalisierung der deutschen Trinkwasserversorgung im europäischen Vergleich sein. Im ersten Abschnitt wird der Trinkwassermarkt gegenüber den Energie- und Gasmärkten abgegrenzt. Dabei werden auch die Besonderheiten des Gutes „Wasser“ dargestellt. Eine Aufgliederung des Trinkwassermarktes in einzelne Teilleistung rundet das erste Kapitel ab. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen von Infrastruktureinrichtungen untersucht. Das Hauptaugenmerk stellt dabei die Darstellung und Analyse der Theorien des natürlichen Monopols dar. Bei einem Vorliegen eines natürlichen Monopols lässt die Frage aufkommen, inwieweit es notwendig ist, dass der Staat in das Marktgeschehen eingreift oder nur die Rahmenbedingungen setzt. Im dritten Kapitel werden die zentralen Begriffe „Liberalisierung“ und „Privatisierung“ von einander abgegrenzt werden. Es wird ferner der Motivation von Privatisierung, sowie den Zielen einer Liberalisierung nachgegangen. Nach einer Beschreibung der verschiedenen Privatisierungsformen wird untersucht, ob Unternehmen in privater Rechtsform effizienter als Unternehmen in einer öffentlichen Rechtsform sind. In einem zweiten Schritt werden die verschiedenen Optionen einer Marktöffnung erörtert. Zuvor wird der Blick auf die Öffnung anderer Infrastruktursektoren gerichtet, um zu untersuchen, ob und wie sich der Wettbewerb intensiviert hat. Diese verschiedenen Wettbewerbsoptionen lassen sich dabei in zwei grobe Richtungen einteilen: Einmal „Wettbewerb um den Markt“ und zum zweiten „Wettbewerb im Markt“.
Das vierte Kapitel erweitert den Blick auf die praktische Umsetzung und die Organisation der Trinkwasserversorgung in den zu vergleichenden Ländern: Frankreich, England/Wales, den Niederlanden und Deutschland. Dabei soll auch auf die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung der unterschiedlichen Regulierungsmodelle eingegangen werden. Die gewonnenen Handlungsempfehlungen aus den untersuchten Ländern können dann Hinweise auf eine mögliche Organisation der Trinkwasserversorgung in Deutschland geben und verschiedene Strategieoptionen von Wasserversorgungsunternehmen aufzeigen. Das fünfte Kapitel geht der Frage nach, welche Bedeutung der Wettbewerb für die Erreichung anderer politischer Ziele, wie Umweltschutz, Versorgungssicherheit oder Wasserqualität hat. Im letzten Kapitel sollen die gewonnenen Erkenntnisse abschließend reflektiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Abgrenzung und Besonderheiten des Wassermarktes gegenüber Energie- und Gasmärkten
- Theoretische Grundlagen
- Informationsmängel und Informationsasymmetrien
- Anpassungsmängel
- Externe Effekte
- Natürliches Monopol als Form von Marktversagen aufgrund von Unteilbarkeiten
- Subadditivität
- Einproduktunternehmen
- Mehrproduktunternehmen
- Größenvorteile („economies of scale“)
- Verbundvorteile und Kostenkomplementarität („economies of scope“)
- Irreversibilität
- Interne Subventionierung (Quersubventionierung)
- Ebene der Regulierung
- Modelle zur Regulierung natürlicher Monopole
- Kostenregulierung („cost-plus-regulation“)
- Preisregulierung
- Preisobergrenze
- Pareto-optimale Angebotsmenge und Defizitabdeckung durch Preisdifferenzierung
- Ramsey Pricing
- Privatisierung oder Liberalisierung
- Definitionen
- Privatisierungsmotive und Ziele der Liberalisierung
- Privatisierungsformen
- Wettbewerb
- Wettbewerbsintensität
- Wettbewerbsformen
- Wettbewerb um den Markt (Ausschreibung)
- Wettbewerb im Markt
- Eigenversorgung
- Freier Leitungsbau
- Einschaltung von Zwischenhändlern
- Gemeinsame Netznutzung und Durchleitung („common carriage“)
- Aufspaltung der Wertschöpfungskette
- Wettbewerb durch Regulierung: „Yardstick Competition“
- Ländervergleich / Marktstrukturen
- Einleitung
- Europarechtliche Rahmenbedingungen
- Frankreich
- England und Wales
- Niederlande
- Deutschland
- Rechtlicher Hintergrund
- Gesetz gegen die Beschränkung des Wettbewerbs (GWB) § 103
- Art 28 Abs. 2 GG
- Organisationsformen der Wasserwirtschaft
- Regiebetrieb
- Eigenbetrieb
- Eigengesellschaft
- Betreibermodell
- Kooperationsmodell
- Privates Unternehmen (materielle Privatisierung)
- Marktstruktur
- Wettbewerber im internationalen Umfeld
- SUEZ
- Vivendi
- RWE
- Weitere Wasserversorgungsunternehmen
- Alternative Strategien für Wasserversorger
- Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen aus den einzelnen Ländern
- Bedeutung des Wettbewerbs für die Erreichung anderer politischer Ziele
- Wettbewerb und Wasserqualität
- Wettbewerb und Versorgungssicherheit
- Wettbewerb und Gesundheits-/Umweltschutz
- Möglichkeiten einer Effizienzsteigerung ohne Privatisierung
- Kooperationen
- Benchmarking
- Mitarbeiter als wertvolle Wissensressource
- Soziale Ungerechtigkeit beim Wettbewerb durch „Rosinenpickerei“
- Ausverkauf der deutschen Trinkwasserressourcen
- Preisargument
- Theoretische Grundlagen der Liberalisierung von natürlichen Monopolen
- Ländervergleich der Liberalisierung von Wasserversorgungsmärkten
- Auswirkungen der Liberalisierung auf die Effizienz und Qualität der Wasserversorgung
- Bewertung der Liberalisierung im Hinblick auf die Wasserqualität, die Versorgungssicherheit und den Gesundheits-/Umweltschutz
- Alternative Strategien zur Effizienzsteigerung ohne Privatisierung
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung der Liberalisierung der Wasserversorgung dar, erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit und grenzt den Wassermarkt gegenüber anderen Märkten ab.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Liberalisierung von natürlichen Monopolen. Es werden die Ursachen für Marktversagen, wie Informationsmängel, Anpassungsmängel und externe Effekte, sowie die Besonderheiten von natürlichen Monopolen, wie Subadditivität und Irreversibilität, untersucht. Weiterhin werden verschiedene Modelle zur Regulierung natürlicher Monopole, wie Kostenregulierung und Preisregulierung, vorgestellt.
- Privatisierung oder Liberalisierung: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Formen der Privatisierung und Liberalisierung, beleuchtet die Motive für eine Liberalisierung und analysiert die verschiedenen Wettbewerbsformen, die bei der Liberalisierung von natürlichen Monopolen auftreten können.
- Ländervergleich / Marktstrukturen: Dieses Kapitel führt einen Ländervergleich der Liberalisierung der Wasserversorgung durch. Dabei werden die Marktstrukturen in Frankreich, England und Wales, den Niederlanden und Deutschland analysiert. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Organisationsformen der Wasserwirtschaft, die Wettbewerbsintensität und die Entwicklung der Wasserversorgung in den einzelnen Ländern betrachtet.
- Bedeutung des Wettbewerbs für die Erreichung anderer politischer Ziele: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Wettbewerbs auf verschiedene politische Ziele, wie Wasserqualität, Versorgungssicherheit, Gesundheits-/Umweltschutz und soziale Ungerechtigkeit. Es werden auch alternative Strategien zur Effizienzsteigerung ohne Privatisierung vorgestellt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Liberalisierung der deutschen Trinkwasserversorgung im europäischen Vergleich. Ziel der Arbeit ist es, die theoretischen Grundlagen der Liberalisierung von natürlichen Monopolen zu beleuchten und anhand von Länderbeispielen die Auswirkungen der Liberalisierung auf die Wasserversorgung zu untersuchen. Dabei werden insbesondere die Wettbewerbsintensität, die Effizienzsteigerung und die Auswirkungen auf die Wasserqualität, die Versorgungssicherheit und den Gesundheits-/Umweltschutz betrachtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Liberalisierung der deutschen Trinkwasserversorgung im europäischen Vergleich. Wichtige Schlüsselwörter sind: natürliches Monopol, Marktversagen, Regulierung, Privatisierung, Liberalisierung, Wettbewerb, Effizienz, Wasserqualität, Versorgungssicherheit, Gesundheits-/Umweltschutz, soziale Ungerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt die Wasserversorgung oft als natürliches Monopol?
Aufgrund der hohen Fixkosten für das Leitungsnetz und der Unteilbarkeit der Infrastruktur ist es ökonomisch oft effizienter, wenn nur ein Anbieter eine Region versorgt, was jedoch staatliche Regulierung erfordert.
Was ist der Unterschied zwischen Privatisierung und Liberalisierung?
Privatisierung bezieht sich auf den Verkauf von öffentlichem Eigentum an Private. Liberalisierung bedeutet die Öffnung des Marktes für Wettbewerb, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen.
Wie funktioniert die Wasserversorgung in England und Wales?
Im Gegensatz zu Deutschland ist der Wassermarkt in England und Wales weitgehend materiell privatisiert, wobei private Unternehmen das gesamte System besitzen und betreiben, jedoch streng reguliert werden.
Welche Wettbewerbsformen gibt es im Wassermarkt?
Man unterscheidet „Wettbewerb um den Markt“ (z. B. durch zeitlich begrenzte Konzessionsausschreibungen) und „Wettbewerb im Markt“ (z. B. durch gemeinsame Netznutzung oder Durchleitung).
Gefährdet Wettbewerb die Wasserqualität?
Kritiker befürchten, dass Kostendruck zu Lasten von Qualität und Umweltschutz gehen könnte. Die Arbeit untersucht, inwieweit Regulierung diese Ziele auch in einem liberalisierten Markt sichern kann.
- Quote paper
- Marc Moellers (Author), 2004, Die Liberalisierung der deutschen Trinkwasserversorgung im europäischen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161112