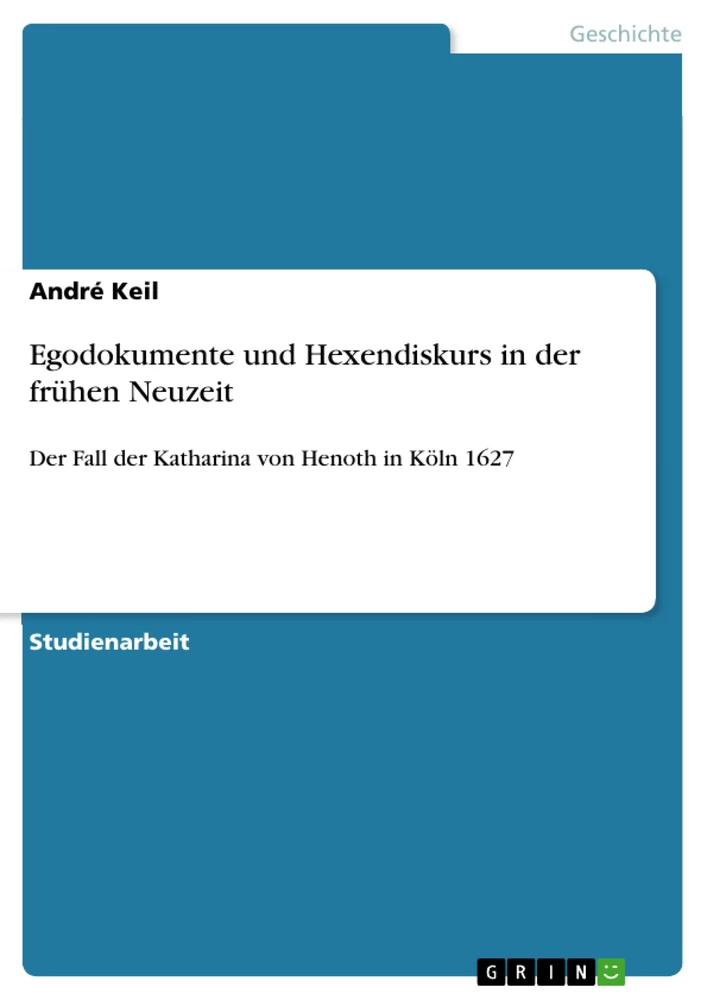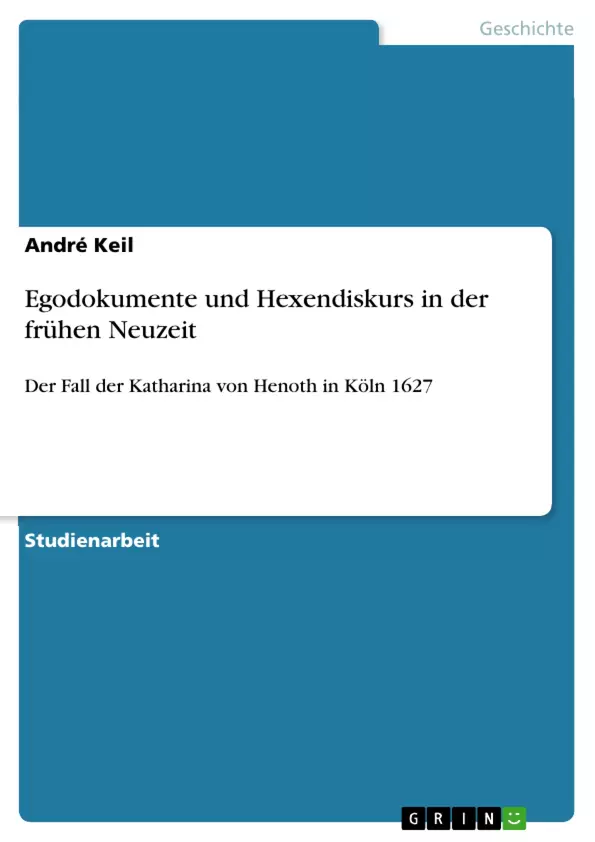Das Phänomen der Hexenprozesse gehört zweifelsohne zu den Schlüsselmomenten der europäischen frühen Neuzeit. Sie sind ein markanter Punkt der Übergangsphase von mittelalterlicher sozialer Praxis hin zu Praktiken, die uns gemeinhin als „modern“ anmuten. Das betrifft einerseits Praktiken im juridisch-administrativen Komplex andererseits aber auch Praktiken, die die Spannungsfelder von Individuum und sozialem Kollektiv, den Konflikt zwischen zunehmender Privatisierung einzelner Lebensbereiche und öffentlichem Raum sowie die Tradierung und Modernisierung sozialer und geschlechtlicher Rollenbilder bzw. deren politische Aufladung zu Zwecken der sozialen Disziplinierung und Durchsetzung frühstaatlicher Herrschaftspraxis betreffen. Besonders augenfällig ist hierbei, dass das Verbrechen der Hexerei (maleficium) nachweislich ein intellektuelles Konstrukt darstellt, das gerade in ländlichen und strukturell rückständigen Regionen Europas die Funktion eines allgemeinen Erklärungsmusters für Missernten, Epidemien, hohe Kindersterblichkeit und ähnlich existentiell bedrohliche Phänomene darstellte. Die Personifizierung der Existenzangst in Form der Hexe und deren aktive Bekämpfung durch die im Entstehen begriffene staatliche Gewalt scheinen aus moderner Perspektive vieles vorweg zunehmen, was im späten 19. und im ganzen 20. Jahrhundert hindurch durch rassistische und antisemitische Feindbildkonstruktionen soziale Praxis war und ist. Der Brief der der Hexerei angeklagten Katharina Henot aus dem Kölner Gefängnis von 1627 ist Zeugnis der Ohnmacht mit der die Betroffenen der allgemein üblichen Folterpraxis gegenüberstanden. Dieser Brief steht exemplarisch für viele andere erhaltene Dokumente, deren Entstehungskontext vergleichbar ist.
Dementsprechend soll bei der Behandlung des Dokuments weniger die Rekonstruktion des konkreten Einzelfalles im Mittelpunkt stehen, als viel mehr die Frage nach den Bedingungen seiner Entstehung. Das bedeutet einerseits, dass die Fragestellung nach der zunehmenden Verschriftlichung und der damit verbundenen Konstruktion neuer „Refugien der Intimität“ berührt wird, aber auch die schleichende Entwicklung des juridisch-administrativen Komplexes hin zu überwachenden, disziplinierenden und strafenden Institutionen, die die vorher weitestgehend vom sozialen Kollektiv ausgeübten Kontroll- und Disziplinierungsfunktionen zunehmend monopolisiert und institutionalisiert. Aber auch die Frage nach der ideologischen Genealogie des Verbrechens der Hexerei.
Inhaltsverzeichnis
- Anmerkungen zur Vorgehensweise
- Methodische Probleme
- Zum Aufbau des Textes
- Das Dokument
- Der direkte Entstehungskontext
- Die Form des Dokumentes
- Inhalt und Sprache des Dokumentes
- Synthetische Interpretation des Dokumentes
- Anknüpfungspunkte zum Dokument
- Makrohistorische Kontexte des Dokumentes
- Das Hexereidelikt
- Weiblichkeitskonstruktion
- Rechtsnormen und frühstaatliche Herrschaftspraxis
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit einem Egodokument, einem Dokument, das Einblicke in die persönliche Situation eines Individuums in der Vergangenheit gewährt. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des Falls der Katharina von Henoth, die im 17. Jahrhundert in Köln wegen Hexerei angeklagt wurde.
- Die Analyse des Egodokumentes im Kontext des Hexenprozesses der Katharina von Henoth
- Die Einordnung des Falls in die Geschichte der Hexenverfolgung im Erzbistum Köln
- Die Rolle von Rechtsnormen und frühstaatlicher Herrschaftspraxis im Zusammenhang mit Hexenprozessen
- Die Konstruktion von Weiblichkeit im Kontext der Hexenmythologie
- Der Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit anhand der Hexenprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Anmerkungen zur Vorgehensweise
Das erste Kapitel erläutert die methodischen Herausforderungen der (Re-)Konstruktion historischer Vergangenheit anhand von Dokumenten. Es werden die Schwierigkeiten des Umgangs mit Egodokumenten beleuchtet, die einerseits einen unmittelbaren Einblick in das Individuum gewähren, andererseits aber auch mit der Gefahr der Verzerrung durch den Interpreten verbunden sind.
Das Dokument
Dieses Kapitel präsentiert die Analyse des Egodokuments, das Katharina von Henoth im Kölner Gefängnis verfasst hat. Es beleuchtet den unmittelbaren Entstehungskontext des Dokumentes im Hexenprozess der Katharina von Henoth sowie die Form und Sprache des Dokumentes. Die Synthetische Interpretation des Dokumentes versucht, den Inhalt in seinen vielfältigen Kontexten zu verstehen.
Anknüpfungspunkte zum Dokument
Dieses Kapitel betrachtet die Einordnung des Falls der Katharina von Henoth in weitere historische, soziale und kulturelle Kontexte. Es werden Aspekte des Übergangs vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit behandelt, die im Kontext der Hexenprozesse deutlich werden. Dazu gehören frühneuzeitliche Rechtsnormen und frühstaatliche Herrschaftspraxis, die Konstruktion von Weiblichkeit in der Figur der Hexe sowie die Überlieferung und Aktualisierung der Deutungskonzepte Magie und Hexerei.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Egodokumenten, Hexenprozessen, frühneuzeitlicher Rechtsgeschichte, Weiblichkeitskonstruktion, frühstaatlicher Herrschaftspraxis, Magie und Hexerei, Köln, 17. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Katharina Henot?
Katharina Henot war eine Kölner Postmeisterin, die 1627 wegen Hexerei angeklagt und hingerichtet wurde. Ihr Fall gilt als eines der bekanntesten Beispiele für Hexenverfolgung in Deutschland.
Was ist ein Egodokument?
Ein Egodokument ist ein historisches Zeugnis (wie ein Brief oder Tagebuch), das unmittelbare Einblicke in die persönlichen Gedanken und die Lebenssituation eines Individuums gibt.
Welche Funktion hatte der Hexereidiskurs in der frühen Neuzeit?
Hexerei diente oft als Erklärungsmuster für unerklärliche Krisen wie Missernten oder Epidemien und wurde zur sozialen Disziplinierung und Durchsetzung staatlicher Herrschaft genutzt.
Warum wird Hexerei als „intellektuelles Konstrukt“ bezeichnet?
Weil das Verbrechen der Hexerei (maleficium) keine reale Grundlage hatte, sondern eine von Theologen und Juristen geschaffene Theorie war, um Sündenböcke für gesellschaftliche Probleme zu finden.
Wie veränderten Hexenprozesse das Rechtssystem?
Sie markieren den Übergang zu einem stärker überwachenden und institutionalisierten Justizsystem, das Kontrollfunktionen vom sozialen Kollektiv auf den Staat übertrug.
- Citar trabajo
- Magister André Keil (Autor), 2005, Egodokumente und Hexendiskurs in der frühen Neuzeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161418