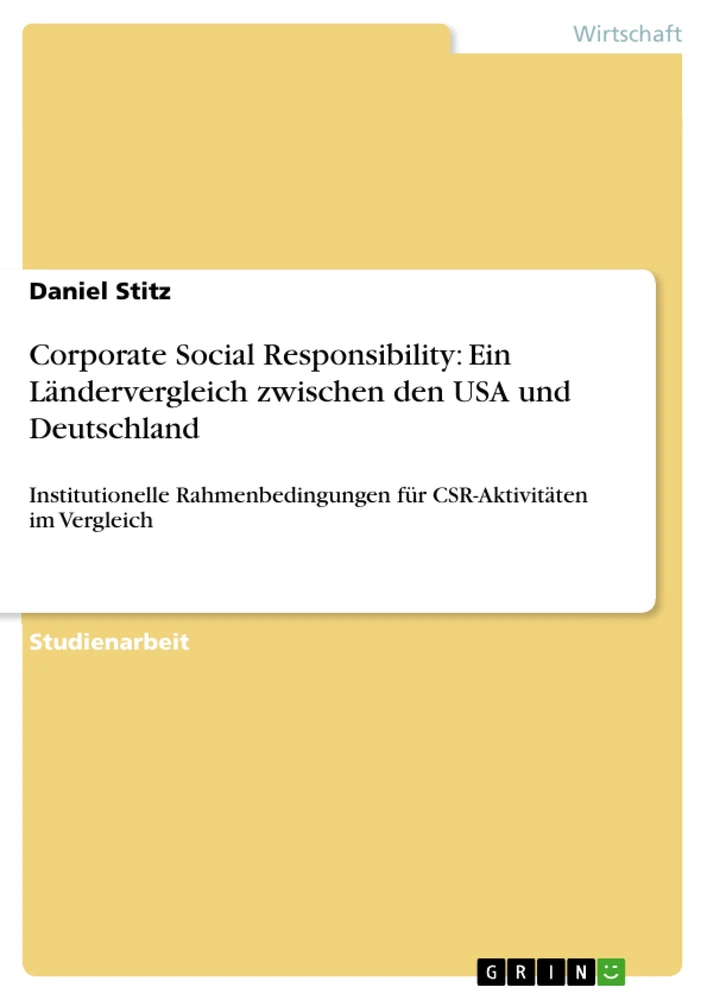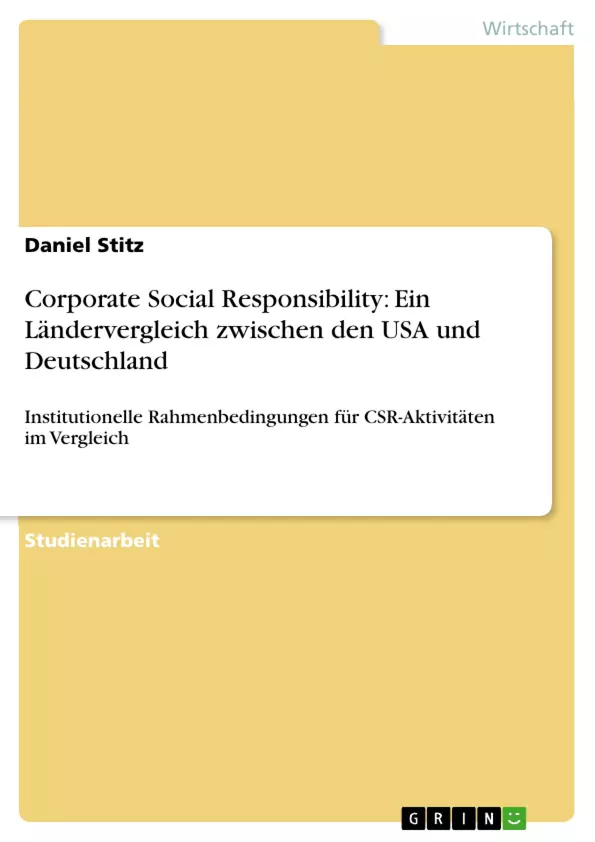Corporate Social Responsibility, oder kurz CSR, ist heutzutage ein weitverbreiteter und in den Medien sowie in den Berichten von Unternehmen häufig verwendeter Begriff. Man könnte meinen, dass dieser Begriff fest etabliert ist und von allen Beteiligten
einheitlich verstanden und verwendet wird. Das Gegenteil ist jedoch der Fall.
Weder gibt es eine allumfassende Definition, noch verstehen unterschiedliche Anspruchsgruppen, wie Mitarbeiter, Shareholder oder Umweltschutzorganisationen dasselbe unter sozial verantwortlichem Verhalten von Firmen, insbesondere wenn sie unterschiedlichen Nationalitäten angehören. Betrachtet man das ganze auf einer internationalen Ebene fällt schnell auf, dass CSR als eine amerikanische Erfindung angesehen werden kann (Bassen et al. 2005).
In Europa halten kommunizierte CSR-Aktivitäten bei den Unternehmen erst seit den 1990er Jahren in größerem Umfang Einzug. Oft wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass der Staat hier viele Verantwortlichkeiten der Unternehmen regelt (z. B. Kindermann 2008; Matten & Moon 2008). Aufgrund der evidenten und theoriebegründeten Unterschiede möchte sich diese Arbeit mit einem Vergleich der CSR-Ausgestaltung von Firmen aus den USA und Deutschland beschäftigen. Die Kernfrage dieser Arbeit lautet:
Lassen sich die theoriebegründeten Unterschiede der CSR- Ausgestaltung deutscher und amerikanischer Firmen tatsächlich in der Praxis wiederfinden?
Zur Beantwortung dieser Frage werden einerseits Studienergebnisse aus der CSR Forschung herangezogen, und andererseits eine Analyse der CSR- Aktivitäten der oben genannten Dimensionen von General Motors und Volkswagen, als jeweilige Repräsentanten eines landestypischen Industrieunternehmens, anhand ihrer Internetauftritt
und von CSR-Berichte vollzogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Corporate Social Responsibility - Definitionen und Diskurse
- Institutionelle Rahmenbedingungen für CSR
- Der Neo-Institutionalismus als Begründung
- Institutionelle Rahmenbedingungen im Ländervergleich: USA Deutschland
- Implizites und explizites CSR - Deutsches vs. Amerikanisches CSR?
- Exkurs: Lidl -Eine explizite Forderung nach implizitem CSR
- Besonderheiten beim Corporate Social Responsibility in Deutschland
- CSR im Branchenvergleich
- Typische CSR-Maßnahmen in Deutschland
- CSR-Aspekte im Ländervergleich: Arbeitnehmerrechte, umweltpolitische Maßnahmen und Diversity Management in Deutschland und den USA
- Umweltbezogene CSR-Maßnahmen
- CSR- Maßnahmen Arbeitnehmerrechte
- CSR-Maßnahmen Diversity Management
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich der Ausgestaltung von Corporate Social Responsibility (CSR) in Unternehmen aus den USA und Deutschland. Ziel ist es, die theoriebegründeten Unterschiede der CSR-Ausgestaltung in der Praxis zu untersuchen. Die Kernfrage lautet: Lassen sich die theoretischen Unterschiede in der Praxis wiederfinden?
- Definitionen und Diskurse von CSR
- Institutionelle Rahmenbedingungen in den USA und Deutschland
- Besonderheiten von CSR in Deutschland
- CSR-Aspekte im Ländervergleich: Umwelt, Arbeitsrecht, Diversity Management
- Analyse der CSR-Aktivitäten von General Motors und Volkswagen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff CSR vor und verdeutlicht die Notwendigkeit eines Ländervergleichs aufgrund unterschiedlicher Definitionen und institutioneller Rahmenbedingungen. Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Definitionen von CSR aus unterschiedlichen Perspektiven und skizziert die Dynamik des CSR-Diskurses. Kapitel 3 widmet sich den institutionellen Rahmenbedingungen für CSR im Neo-Institutionalismus und im Ländervergleich zwischen den USA und Deutschland. Hier werden auch die Unterschiede zwischen implizitem und explizitem CSR in den beiden Ländern betrachtet. Kapitel 4 beleuchtet Besonderheiten des deutschen CSR-verständnisses, insbesondere im Branchenvergleich und die typischen CSR-Maßnahmen in Deutschland. Kapitel 5 vertieft den Ländervergleich anhand von CSR-Aspekten wie Umwelt, Arbeitsrecht und Diversity Management, wobei Studienergebnisse und Analysen von General Motors und Volkswagen herangezogen werden.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility (CSR), Ländervergleich, USA, Deutschland, Definitionen, Diskurse, institutionelle Rahmenbedingungen, Neo-Institutionalismus, implizites CSR, explizites CSR, CSR-Maßnahmen, Arbeitnehmerrechte, Umwelt, Diversity Management, General Motors, Volkswagen
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen CSR in den USA und Deutschland?
In den USA ist CSR oft "explizit" und wird als freiwilliges Engagement der Firmen kommuniziert. In Deutschland ist CSR eher "implizit", da viele soziale Verantwortlichkeiten bereits durch staatliche Gesetze geregelt sind.
Welche Rolle spielt der Neo-Institutionalismus in diesem Vergleich?
Diese Theorie erklärt, wie institutionelle Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Erwartungen die Ausgestaltung von CSR-Aktivitäten in verschiedenen Ländern prägen.
Wie unterscheiden sich die CSR-Aktivitäten von Volkswagen und General Motors?
Die Arbeit analysiert die Internetauftritte und Berichte beider Firmen, um zu zeigen, wie landestypische Industriekulturen die Schwerpunkte bei Umwelt und Arbeitnehmerrechten beeinflussen.
Was versteht man unter Diversity Management im CSR-Kontext?
Es umfasst Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt in der Belegschaft. Die Arbeit vergleicht, wie dieses Konzept in den USA (oft proaktiver) und in Deutschland umgesetzt wird.
Warum gilt CSR als "amerikanische Erfindung"?
Weil in den USA die Tradition des privaten Philanthropismus aufgrund eines schwächer ausgeprägten Sozialstaats historisch stärker verwurzelt ist als in Europa.
- Citation du texte
- Daniel Stitz (Auteur), 2010, Corporate Social Responsibility: Ein Ländervergleich zwischen den USA und Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161817