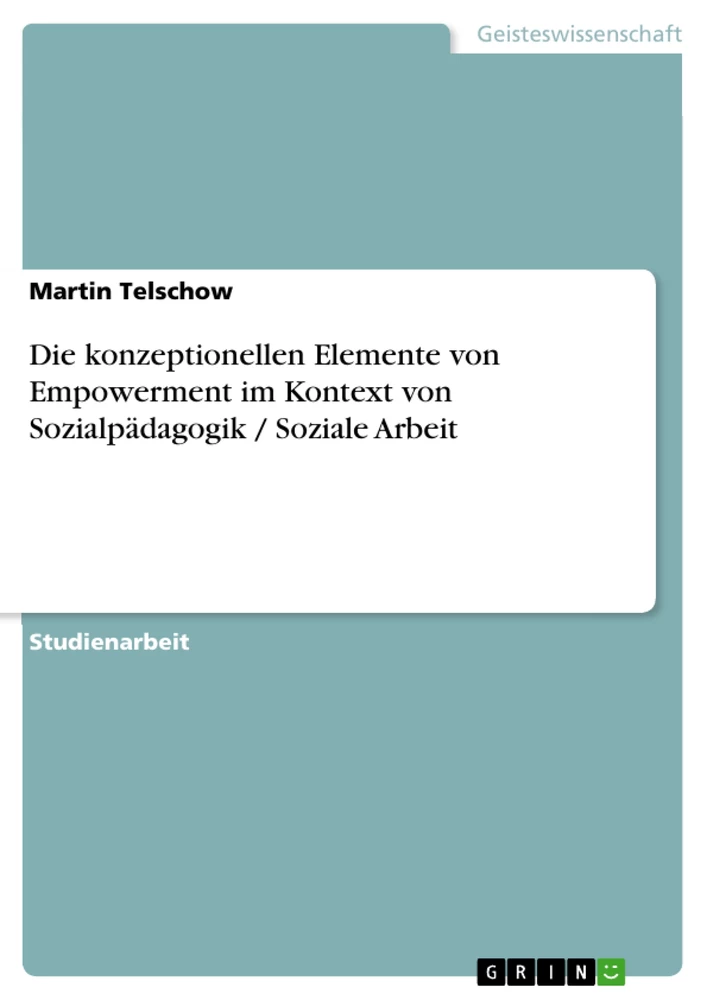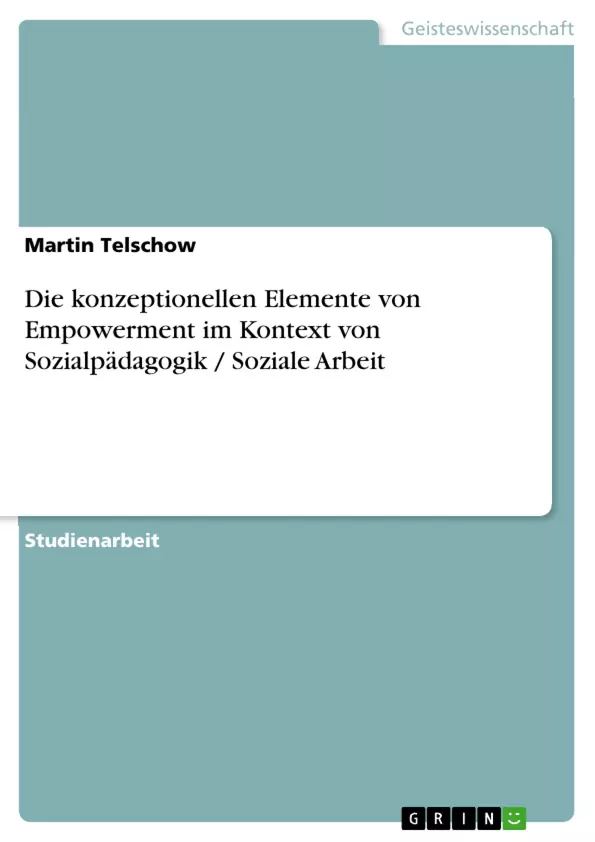Diese wissenschaftliche Hausarbeit analysiert die verschiedenen Aspekte von Empowerment im Zusammenhang mit sozialen und gesundheitsbezogenen Berufsfeldern. Dabei wurde Empowerment bei seiner anfänglichen Verbreitung vor allem als Grundhaltung bzw. Leitidee einer menschlichen Stärkeperspektive und als Prozess der „Selbstbemächtigung“ verstanden. Es entwickelten sich jedoch auch eine umfangreichere Zielsetzungen, sowie praxisbezogene methodische Aspekte. Dem Leser wird ein umfassendes Verständnis darüber vermittelt, was bedeutende Autoren unter Empowerment verstehen. Die Hausarbeit zeigt auf, in welchem konzeptionellen Rahmen Empowerment betrachtet werden kann. Belege für diese konzeptionelle Einordnung werden unter anderem auch in aktuellen praktischen Umsetzungsmöglichkeiten gesucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärungen für den Kontext dieser Arbeit
- 2.1 Der Methodenbegriff im engeren Sinne
- 2.2 Definition eines Konzeptes nach Geißler; Hege
- 3 Die Inhalte von Empowerment
- 3.1 Der Vorwurf: Die Defizitperspektive
- 3.2 Die Antwort: Die Philosophie der Menschenstärke
- 3.2.1 Empowerment als Grundhaltung bzw. Leitidee
- 3.2.2 Empowerment als Prozess
- 4 Die Ziele von Empowerment
- 5 Die Umsetzung von Empowerment
- 5.1 Der methodische Charakter der Realisierungsstrategien
- 5.2 Methoden bei Herriger
- 5.3 Empowerment-Training: Praxisbeispiel einer Methode
- 6 Zusammenfassung & Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der These, dass Empowerment nicht nur eine Grundhaltung oder ein Prozess ist, sondern auch methodische Aspekte besitzt. Sie analysiert den Empowermentbegriff im Kontext der Sozialpädagogik und Sozialen Arbeit, indem sie verschiedene Betrachtungswinkel und Umsetzungsmöglichkeiten beleuchtet.
- Analyse des Empowermentbegriffs im Kontext von Methoden
- Untersuchung der methodischen Aspekte von Empowerment
- Darstellung von Empowerment als Grundhaltung, Prozess und Konzept
- Beschreibung von Methoden und Modellen zur Umsetzung von Empowerment
- Diskussion der Bedeutung von Empowerment für die soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung beleuchtet den aktuellen Stand der Debatte um Empowerment und stellt die These der Arbeit vor: Empowerment besitzt methodische Aspekte, die es zu einem vollständigen Konzept im Sinne von Geißler und Hege machen. - Kapitel 2: Begriffsklärungen für den Kontext dieser Arbeit
Dieses Kapitel definiert den Begriff "Methode" im engeren Sinne und erweitert ihn im Anschluss zu einem umfassenderen Verständnis, das auch Konzept und Verfahren/Technik integriert. Dabei wird auf das Modell von Geißler und Hege Bezug genommen. - Kapitel 3: Die Inhalte von Empowerment
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Kritik an der Defizitperspektive in der Sozialen Arbeit und stellt Empowerment als Gegenentwurf vor. Empowerment wird als Grundhaltung und als Prozess beschrieben. - Kapitel 4: Die Ziele von Empowerment
Dieses Kapitel erläutert die Ziele von Empowerment und wie diese in der Praxis umgesetzt werden können. - Kapitel 5: Die Umsetzung von Empowerment
Kapitel 5 analysiert verschiedene methodische Ansätze zur Umsetzung von Empowerment. Es wird ein Praxisbeispiel eines "Empowerment-Trainings" vorgestellt, das die methodische Anwendbarkeit und Relevanz von Empowerment verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Empowerment, Methode, Konzept, Defizitperspektive, Menschenstärke, Grundhaltung, Prozess, Sozialpädagogik, Soziale Arbeit und Praxisbeispiel.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Empowerment in der Sozialen Arbeit?
Empowerment beschreibt einen Prozess der „Selbstbemächtigung“, bei dem Menschen unterstützt werden, ihre eigenen Stärken zu entdecken und ihre Lebensumstände eigenständig zu gestalten.
Ist Empowerment nur eine theoretische Leitidee oder eine Methode?
Die Arbeit zeigt auf, dass Empowerment beides ist: eine ethische Grundhaltung (Stärkenperspektive) und ein methodisches Konzept mit konkreten Realisierungsstrategien.
Was ist der Unterschied zwischen Defizit- und Stärkenperspektive?
Die Defizitperspektive blickt auf die Mängel eines Klienten. Empowerment setzt dagegen auf die „Philosophie der Menschenstärke“ und aktiviert vorhandene Ressourcen.
Wie sieht ein Empowerment-Training in der Praxis aus?
Ein solches Training nutzt gezielte Methoden, um die Selbstwahrnehmung und Handlungskompetenz der Teilnehmer zu stärken, oft in Gruppen- oder Workshop-Settings.
Welche Ziele verfolgt der Empowerment-Ansatz?
Zentrale Ziele sind die Erhöhung der Autonomie, die Verbesserung der Lebensqualität und die Befähigung zur politischen und sozialen Mitbestimmung.
- Quote paper
- Martin Telschow (Author), 2010, Die konzeptionellen Elemente von Empowerment im Kontext von Sozialpädagogik / Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161884