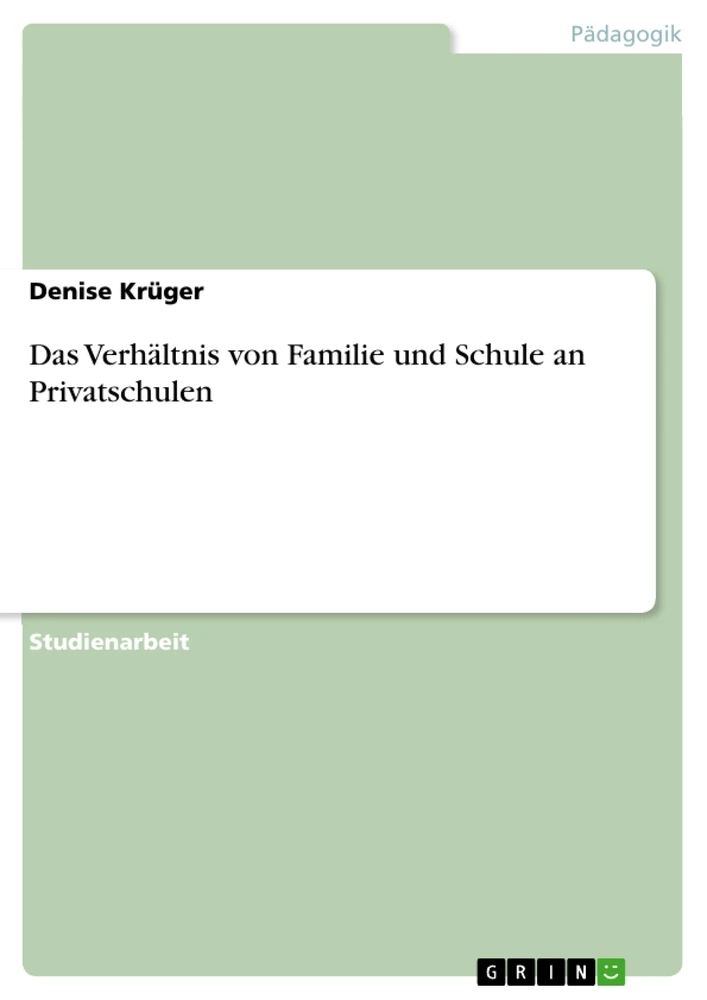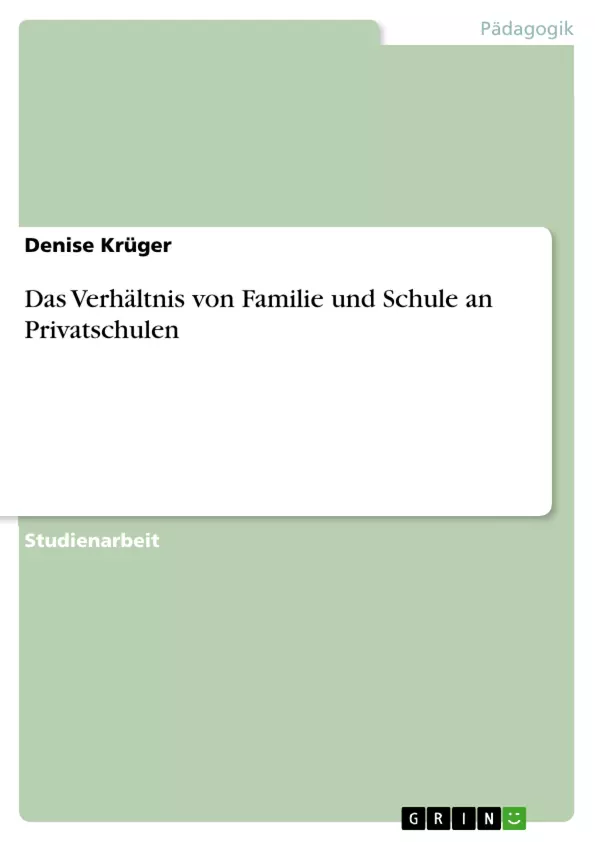Seit Pisa und Co sind Bildung und Erziehung stärker denn je in den Blickpunkt geraten - nicht nur in der wissenschaftlichen Diskussion, sondern auch im häuslichen Kreis der Familie. Bei immer mehr Eltern wächst das Bewusstsein für den Wert der Bildung, wie schon allein die steigenden Verkaufszahlen unzähliger Ratgeberliteratur für Eltern oder der große Erfolg von TV-Shows à la „Die Supernanny“ zeigen. In der gegenwärtigen Krise der Staatsschule vermelden besonders die Schulen in privater Trägerschaft eine stark steigende Nachfrage. Trotz (oder gerade wegen?) der angespannten wirtschaftlichen Lage greifen viele Eltern heute für eine gute Beschulung ihrer Kinder tief in die Tasche. So ist zuneh-mend ein von Angebot und Nachfrage bestimmter Bildungsmarkt entstanden, bei dem die Eltern die Rolle von aktiven „Schulkonsumenten“ einnehmen.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich für mich die Frage, wie sich das zumeist spannungsreiche Verhältnis von Familie und Schule im Bereich der privaten Schuleinrichtungen gestaltet. Damit verbunden sind für mich die drei nachfolgenden Hypothesen: 1) Private Schulen sehen die Eltern als Kunden, auf die möglichst höflich und rücksichtsvoll einzugehen ist. 2) Mit der Bezahlung für den Schulbesuch seitens Eltern geht zugleich eine bewusstere Berücksichtigung der elterlichen Ansprüche und Wünsche durch die Schule einher. 3) An Privatschulen haben Eltern mehr Partizipationsmöglichkeiten, die sich besonders auf eine Mitentscheidung richten.
Ehe ich mich gezielt dem Verhältnis von Familie und Schule widmen werde, soll zunächst eine Darstellung des Privatschulwesens in Deutschland erfolgen. Anschließend werden einige historische und rechtliche Hintergründe sowie verschiedene theoretische Positions-bestimmungen zum Spannungsfeld „Familie – Schule“ aufgezeigt. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen zur Kooperation von Eltern und Schule in der Praxis, möchte ich den Blick speziell auf die Privatschulen lenken. Anhand eines Elternbriefes, den ich interpretieren und hinsichtlich des zugrundeliegenden Verhältnisses der Schule gegenüber dem Elternhaus analysieren werde, werde ich dann die von mir aufgestellten Hypothesen überprüfen. Ein abschließendes Resümee soll meine Erkenntnisse zusammenfassend reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Privatschulen als integraler Bestandteil des deutschen Schulwesens
- Allgemeine Bemerkungen zum Privatschulwesen
- Aktuelle Statistik
- Unterschiede von privaten und staatlichen Schulen
- Theoretische Hintergründe zum Verhältnis von Familie und Schule
- Historische Perspektiven
- Rechtliche Grundlagen
- Verschiedene Positionsbestimmungen im wissenschaftlichen Kontext
- Gestaltung der Kooperation von Elternhaus und Schule in der Praxis
- Analyse des Verhältnisses von Elternhaus und Privatschule
- Ansätze in der wissenschaftlichen Diskussion
- Interpretation eines Elternbriefes von einer Privatschule
- Ableitung von Thesen zum Verhältnis der Schule gegenüber den Eltern
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht das Verhältnis von Familie und Schule im Kontext von Privatschulen. Die Arbeit analysiert die Rolle der Eltern als „Schulkonsumenten“ und beleuchtet die Frage, ob an privaten Schulen eine engere Beziehung zwischen Elternhaus und Schule besteht als an staatlichen Schulen. Dabei werden drei Hypothesen aufgestellt und anhand wissenschaftlicher Literatur und der Interpretation eines Elternbriefes überprüft.
- Das Verhältnis von Familie und Schule an Privatschulen im Vergleich zu staatlichen Schulen.
- Die Rolle der Eltern als „Schulkonsumenten“ und deren Einfluss auf die Gestaltung der Schulpartnerschaft.
- Die Bedeutung der elterlichen Mitarbeit und Mitbestimmung in der schulischen Praxis.
- Die Auswirkungen von Schulgeldern auf die Beziehungen zwischen Eltern und Schule.
- Die spezifischen Besonderheiten der Kooperation von Elternhaus und Schule im Bereich der privaten Bildungseinrichtungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung setzt den aktuellen Diskurs über Bildung und Erziehung in den Kontext der steigenden Nachfrage nach Privatschulen. Die Autorin stellt drei Hypothesen auf, die im weiteren Verlauf der Arbeit überprüft werden.
Privatschulen als integraler Bestandteil des deutschen Schulwesens: Dieses Kapitel befasst sich mit der Geschichte und dem aktuellen Stand des Privatschulwesens in Deutschland. Es werden Statistiken zum Wachstum des Sektors und die Unterschiede zwischen staatlichen und privaten Schulen beleuchtet.
Theoretische Hintergründe zum Verhältnis von Familie und Schule: Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung und die rechtlichen Grundlagen des Verhältnisses von Elternhaus und Schule. Verschiedene wissenschaftliche Positionsbestimmungen im Kontext der Kooperation zwischen beiden Institutionen werden dargestellt.
Analyse des Verhältnisses von Elternhaus und Privatschule: Dieses Kapitel analysiert das Verhältnis von Elternhaus und Privatschule anhand wissenschaftlicher Literatur und der Interpretation eines Elternbriefes. Die Autorin untersucht, ob die Eltern an Privatschulen tatsächlich einen größeren Einfluss auf die Schule haben und ob sich die Kooperation von Familie und Schule gegenüber der allgemeinen Darstellung nach Krumm und Busse/Helsper anders gestaltet.
Schlüsselwörter
Privatschulen, Familie, Schule, Elternhaus, Kooperation, Schulpartnerschaft, elterliche Mitbestimmung, Schulgelder, Schulkonsumenten, wissenschaftliche Literatur, Elternbrief, Objektive Hermeneutik.
Häufig gestellte Fragen
Warum entscheiden sich Eltern für Privatschulen?
Oft steht der Wunsch nach besserer individueller Förderung, kleineren Klassen und einer stärkeren Berücksichtigung elterlicher Ansprüche im Vordergrund, was Eltern als „Schulkonsumenten“ agieren lässt.
Haben Eltern an Privatschulen mehr Mitbestimmungsrechte?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass Privatschulen ihren Eltern mehr Partizipationsmöglichkeiten bieten, da diese durch das Schulgeld direkt zur Finanzierung beitragen.
Werden Eltern an Privatschulen wie „Kunden“ behandelt?
Es wird analysiert, ob private Träger höflicher und rücksichtsvoller auf Elternwünsche eingehen, um im Wettbewerb des Bildungsmarktes bestehen zu können.
Welche rechtlichen Grundlagen regeln das Privatschulwesen in Deutschland?
Privatschulen sind als Ersatzschulen oder Ergänzungsschulen staatlich anerkannt und unterliegen bestimmten gesetzlichen Rahmenbedingungen, genießen aber pädagogische Freiheit.
Was ist das Ergebnis der Analyse des Elternbriefes?
Anhand der Interpretation eines Briefes wird überprüft, wie die Schule das Verhältnis zum Elternhaus sprachlich gestaltet und welche Rollenbilder dabei vermittelt werden.
- Quote paper
- Denise Krüger (Author), 2010, Das Verhältnis von Familie und Schule an Privatschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162029