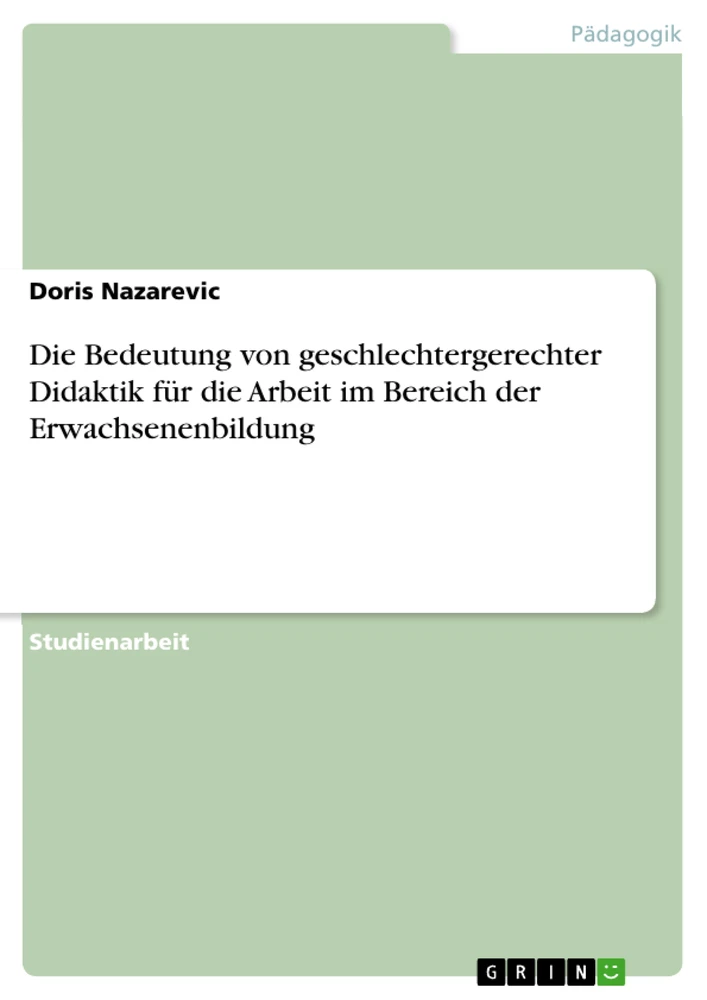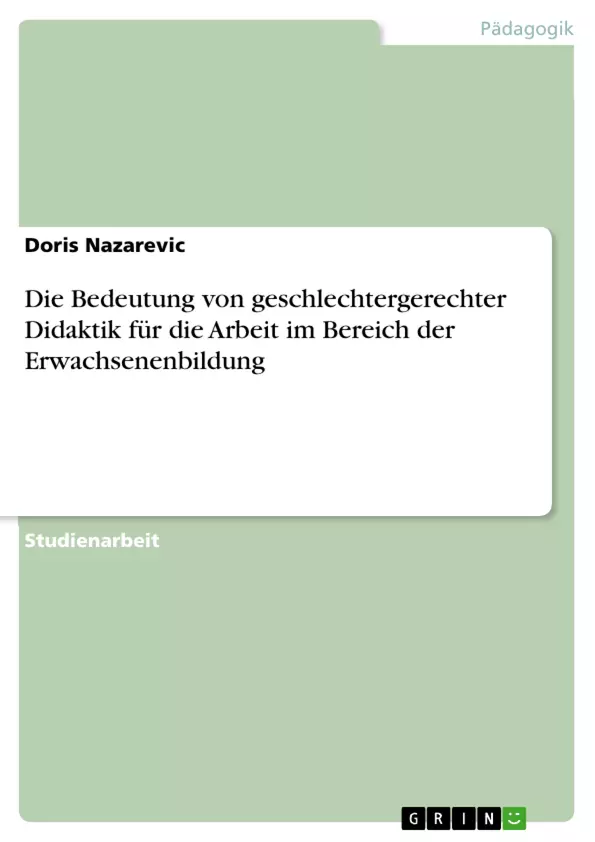In dieser Arbeit werde ich mich mit dem Thema geschlechtergerechte Didaktik in der Erwachsenenbildung auseinandersetzen.
Dazu werde ich die Sichtweise Horst Sieberts, sowie empirische
Untersuchungen unter anderem von Karin Derichs-Kunstmann zu diesem Thema heranziehen.
Zuerst möchte ich den Begriff der geschlechtergerechten Didaktik in der Erwachsenenbildung klären, um dann die Frage zu erörtern warum sie von Bedeutung für diesen Bereich ist. Danach werde ich einige Statistiken, Zahlen und empirische Untersuchungen zum Thema Frauen in Veranstaltungen der Erwachsenenbildung aufzeigen.
Ein weiterer Teil meiner Arbeit beschäftigt sich auch mit Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung einer geschlechterneutralen Didaktik. Die Einbeziehung von Geschlechterdifferenzen als Inhalt von Seminaren ist dabei ein zentraler Punkt, welcher genauer behandelt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erste Fragen zu diesem Thema
- Was bedeutet der Begriff Didaktik?
- Was bedeutet geschlechtergerechte Didaktik in der Erwachsenenbildung?
- Warum ist geschlechtergerechte Didaktik in der Erwachsenenbildung von Bedeutung?
- Allgemeine geschlechtertypische Zuschreibungen
- Horst Siebert über Geschlechterdifferenzen in der Erwachsenenbildung
- Frauen als Teilnehmerinnen von Erwachsenenbildungsveranstaltungen - Statistiken und Zahlen
- Werden Weiterbildungsseminare öfters von Frauen oder von Männern besucht?
- Gibt es Unterschiede bei der Wahl von Seminarangeboten zwischen Männern und Frauen?
- Welche Verhaltensauffälligkeiten gibt es bei Frauen und Männer in gemischtgeschlechtlichen Veranstaltungen?
- ,,Lernen Frauen anders? Empirische Befunde zur Inszenierung des Geschlechterverhältnisses in Lernsituationen“
- Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung von Geschlechterdemokratie in der Erwachsenenbildung
- Geschlechterdifferenzen als Inhalt von Seminaren
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung geschlechtergerechter Didaktik im Kontext der Erwachsenenbildung. Dabei werden verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter die Definition des Begriffs, die Relevanz von Geschlechtergerechtigkeit in diesem Bereich sowie empirische Befunde zu Frauen in der Erwachsenenbildung. Die Arbeit analysiert zudem Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung einer geschlechterneutralen Didaktik und befasst sich mit der Einbeziehung von Geschlechterdifferenzen als Inhalt von Seminaren.
- Definition und Relevanz von geschlechtergerechter Didaktik in der Erwachsenenbildung
- Empirische Befunde zu Frauen in der Erwachsenenbildung
- Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung einer geschlechterneutralen Didaktik
- Einbeziehung von Geschlechterdifferenzen als Inhalt von Seminaren
- Kritik an traditionellen Geschlechterrollen und deren Einfluss auf die Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung geschlechtergerechter Didaktik in der Erwachsenenbildung. Das zweite Kapitel widmet sich der Klärung des Begriffs der Didaktik und der geschlechtergerechten Didaktik im Kontext der Erwachsenenbildung. Es werden Argumente für die Relevanz einer geschlechtergerechten Didaktik in diesem Bereich aufgezeigt. Das dritte Kapitel beleuchtet allgemeine geschlechtertypische Zuschreibungen und ihre Auswirkungen auf die Erwachsenenbildung. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Ausführungen von Horst Siebert zu Geschlechterdifferenzen in der Erwachsenenbildung. Das fünfte Kapitel präsentiert Statistiken und Zahlen zu Frauen als Teilnehmerinnen von Erwachsenenbildungsveranstaltungen. Es werden Unterschiede in der Teilnahme von Frauen und Männern an Weiterbildungsseminaren sowie deren Wahl von Seminarangeboten analysiert. Das sechste Kapitel widmet sich der Frage, ob Frauen anders lernen und präsentiert empirische Befunde zur Inszenierung des Geschlechterverhältnisses in Lernsituationen.
Schlüsselwörter
Geschlechtergerechte Didaktik, Erwachsenenbildung, Geschlechterdifferenzen, Frauenbildung, Bildungsgerechtigkeit, Geschlechterrollen, Empirische Forschung, Seminargestaltung, Lernsituationen, Geschlechterdemokratie, Vorurteile, Klischees, Gleichstellungspolitik
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet geschlechtergerechte Didaktik in der Erwachsenenbildung?
Es bedeutet, Lehr- und Lernprozesse so zu gestalten, dass Geschlechterdifferenzen reflektiert werden und weder Frauen noch Männer durch Klischees oder Vorurteile benachteiligt werden.
Lernen Frauen anders als Männer?
Die Arbeit untersucht empirische Befunde zur Inszenierung des Geschlechterverhältnisses und fragt nach spezifischen Lernstilen oder Verhaltensauffälligkeiten in gemischten Gruppen.
Warum ist dieses Thema für die Erwachsenenbildung relevant?
Erwachsenenbildung soll Bildungsgerechtigkeit fördern. Eine geschlechterneutrale Didaktik hilft dabei, traditionelle Rollenzuweisungen aufzubrechen und die Teilnahmechancen zu verbessern.
Welche Statistiken werden in der Arbeit herangezogen?
Es werden Zahlen zur Seminarwahl und zur Häufigkeit des Besuchs von Weiterbildungsveranstaltungen durch Frauen im Vergleich zu Männern analysiert.
Wie können Geschlechterdifferenzen zum Seminarthema werden?
Indem die Reflexion über Geschlechterrollen explizit in die Inhalte von Seminaren integriert wird, um das Bewusstsein für Geschlechterdemokratie zu stärken.
- Citation du texte
- Doris Nazarevic (Auteur), 2009, Die Bedeutung von geschlechtergerechter Didaktik für die Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162351