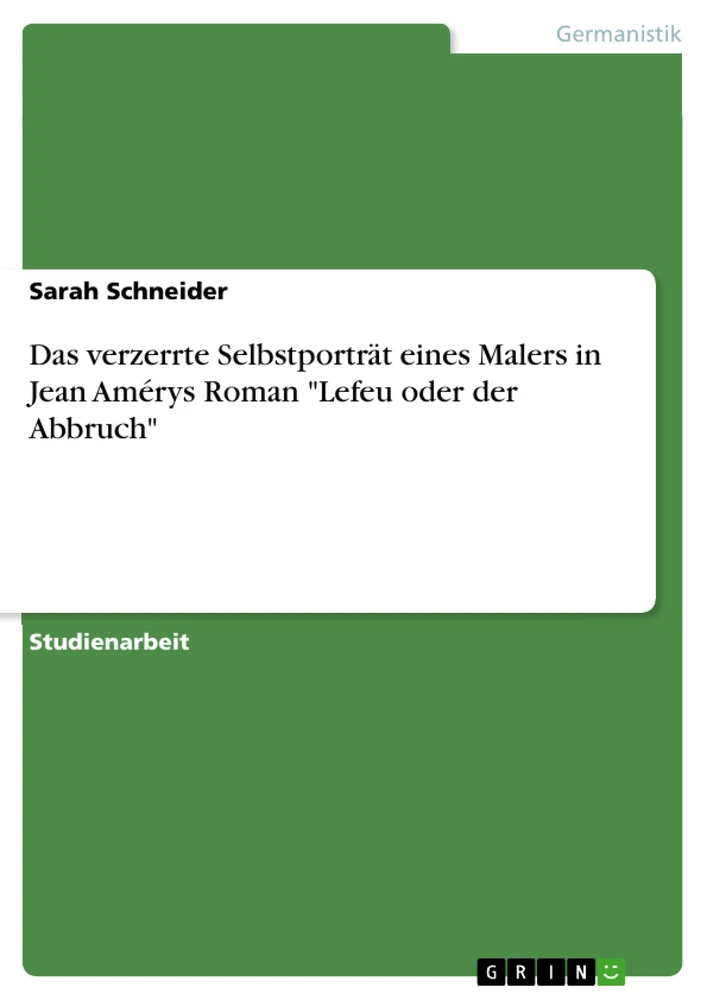Wer die zeitkritischen Aufsätze des jüdischen Schriftstellers Jean Améry, der 1912 als Hans Chaim Mayer in Wien geboren wurde, kennt, wie unter anderem „Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten“ und „Über das Altern: Revolte und Resignation“ aus den 1960er Jahren oder die autobiografische Schrift „Unmeisterliche Wanderjahre“ von 1971, die sich durch Amérys Fähigkeit der Analyse des Zeitgeschehens, der Geschichte und deren philosophischem wie auch politischem Hintergrund, auszeichnen, den mag der Wunsch „von der autobiographischen Thematik... loszukommen“ und einen Roman zu verfassen nicht sonderlich überrascht haben. Es war anzunehmen, dass Améry zwar „erzählen“ wolle, doch würde er dabei die Möglichkeit des Sinnens und Nachdenkens, der Reflexion, nicht zu Gunsten einer reinen Erzählwelt, wie es dem Roman eigen ist, aufgeben. Und somit entstand ein Werk, das von der gegenseitigen Durchdringung von Darstellerischem und Erzähltechnischem auf der einen Seite und Reflektierendem auf der anderen Seite geprägt ist: Jean Amérys Roman-Essay „Lefeu oder der Abbruch“, welcher Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit ist.
...
Die Figur des Lefeu, welche das Romangeschehen bestimmt, hatte einen tatsächlich lebenden Künstler zum Vorbild: Erich Schmid. Über ihn fantasiert Améry seine Kunstfigur jedoch hinaus, bis hin zu „künstlerischen Selbstbefragungen und -vergewisserungen, die uns in den Porträts von Thomas Manns Aschenbach (aus dem „Tod in Venedig“, mit dem Amérys Buch sehr viel verbindet) oder dem Adrian Leverkühn (aus dem „Doktor Faustus“) schon vertraut waren“ .
In wie weit der Maler Erich Schmid nun Vorlage für die Figur des Lefeu war, wie viel Autobiografisches diese Romangestalt entgegen des Wunsches des Autors, wie es aus dem voranstehenden Zitat desselben zu entnehmen war, in sich trägt und besonders in welcher Beziehung Schmid, Lefeu und Améry zueinander stehen, soll im Folgenden erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Roman „Lefeu oder der Abbruch“
- Zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Romans
- Zum Gehalt des Romans
- Anmerkungen zur Figur des Lefeu
- Erich Schmid – Das Vorbild für die literarische Figur des Lefeu
- Das Leben des Erich Schmid und seine Beziehung zu Jean Améry
- Exkurs: „Die neuen Mönche. Bildnisse (un)berühmter Zeitgenossen. Unbekannter Maler E. S.“
- „Lefeu oder der Abbruch“ – Das verzerrte Selbstporträt eines Malers?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Roman-Essay "Lefeu oder der Abbruch" des jüdischen Schriftstellers Jean Améry. Ziel ist es, die Entstehung, den Gehalt und die Bedeutung des Werks im Kontext des Gesamtwerks Amérys zu analysieren, insbesondere in Hinblick auf die Figur des Malers Lefeu und deren Vorbild, den realen Künstler Erich Schmid. Die Arbeit beleuchtet, inwiefern das autobiographische Element in Amérys Text angelegt ist und wie sich das Verhältnis zwischen Améry, Schmid und Lefeu im Werk widerspiegelt.
- Analyse der Entstehungsgeschichte von "Lefeu oder der Abbruch"
- Interpretation des Gehalts des Romans und dessen Verhältnis zu Amérys anderen Werken
- Untersuchung der Beziehung zwischen Améry und Schmid
- Exploration der Frage nach autobiographischen Elementen in "Lefeu oder der Abbruch"
- Bedeutung des Romans im Kontext der literarischen und philosophischen Debatten der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel erfahren wir vom Abbruch des Hauses, in dem Lefeu lebt und malt. Améry reflektiert über die Bedeutung des Verfalls und die Wertsetzung des Naturgegebenen gegenüber der geistigen Wertsetzung des Todes. Das zweite Kapitel widmet sich der geplanten Ausstellung von Lefeus Bildern in einer Düsseldorfer Kunstgalerie. Améry stellt die Frage nach dem Erfolg als gesellschaftliches Phänomen und die Unberechenbarkeit des Erfolgs als Ergebnis des Wirklichkeitsverlustes. Im dritten Kapitel tritt Irene, Lefeus Geliebte, in den Vordergrund. Améry reflektiert über das Verhältnis von Sprache und Welt und die Sprachlosigkeit der modernen Kunst. Das vierte Kapitel behandelt den Fortschritt des Abbruchs und Lefeus Auseinandersetzung mit der Logik der Anpassung. Das fünfte Kapitel beschreibt Lefeus Fahrt durch die Provinz Béarn, die ihn mit der Bedrohung des Feuerreiters konfrontiert. Das sechste Kapitel schildert Lefeus Entscheidung, die Gespräche mit den Galeristen aus Düsseldorf abzubrechen und die sich verschlimmernde Situation um Irene. Lefeu kapituliert angesichts des bevorstehenden Abbruchs seines Ateliers und malt sein letztes Bild.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Romans "Lefeu oder der Abbruch" sind die künstlerische Autonomie, die gesellschaftliche Verwertung von Kunst, die Verweigerung des Erfolgs, der Abbruch als Metapher für den Verfall der Werte, die Suche nach einer authentischen Wirklichkeit und die Frage nach dem Umgang mit dem Tod. Weitere Schlüsselbegriffe sind der autobiographische Charakter des Romans, die Beziehung zwischen Améry und Schmid, die Rolle des Malers Lefeu als Figur des Widerstandes und die philosophischen Ansätze von Sartre und Améry.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Jean Amérys Roman "Lefeu oder der Abbruch"?
Der Roman-Essay thematisiert das Leben des Malers Lefeu, der sich gegen die gesellschaftliche Verwertung seiner Kunst und den Verfall seiner Lebenswelt wehrt.
Wer war das reale Vorbild für die Figur des Lefeu?
Das Vorbild war der Maler Erich Schmid, ein Freund Amérys, dessen Leben und künstlerische Haltung die Grundlage für die Romanfigur bildeten.
Ist der Roman autobiografisch geprägt?
Obwohl Améry versuchte, von der autobiografischen Thematik loszukommen, enthält die Figur des Lefeu viele Reflexionen, die Amérys eigenen philosophischen und politischen Ansichten entsprechen.
Was symbolisiert der "Abbruch" im Roman?
Der physische Abbruch des Hauses steht metaphorisch für den Verfall von Werten, die Vergänglichkeit und die Kapitulation des Individuums vor dem Fortschritt.
Welche Rolle spielt die künstlerische Autonomie bei Améry?
Lefeu lehnt den kommerziellen Erfolg ab, um seine künstlerische Integrität zu bewahren, was als Akt des Widerstands gegen eine entfremdete Welt dargestellt wird.
- Citation du texte
- Sarah Schneider (Auteur), 2009, Das verzerrte Selbstporträt eines Malers in Jean Amérys Roman "Lefeu oder der Abbruch", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162397