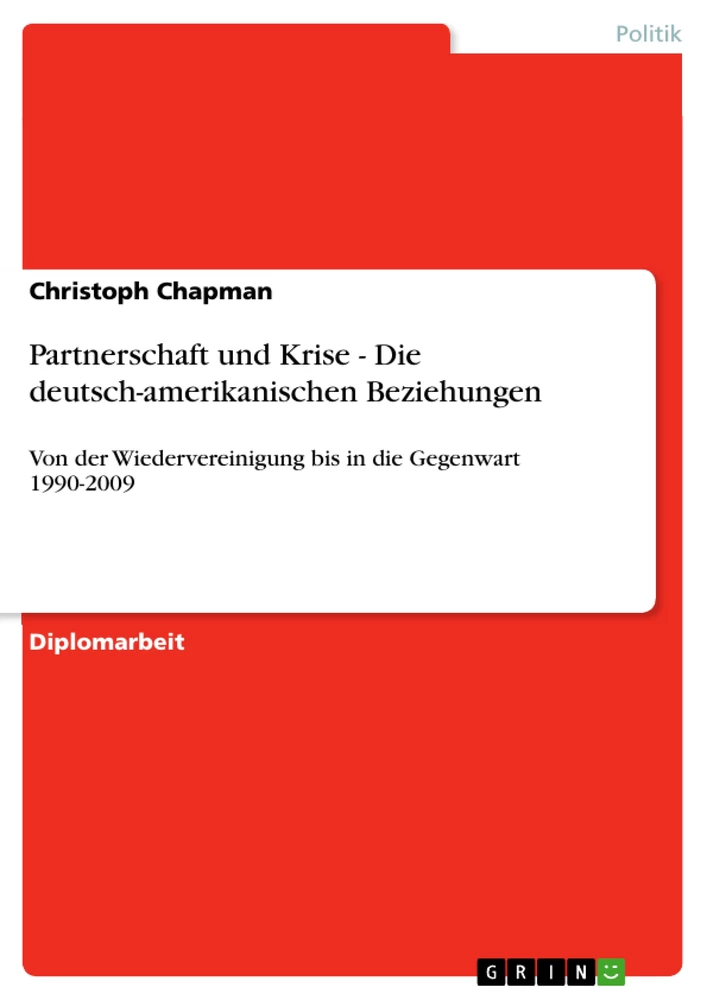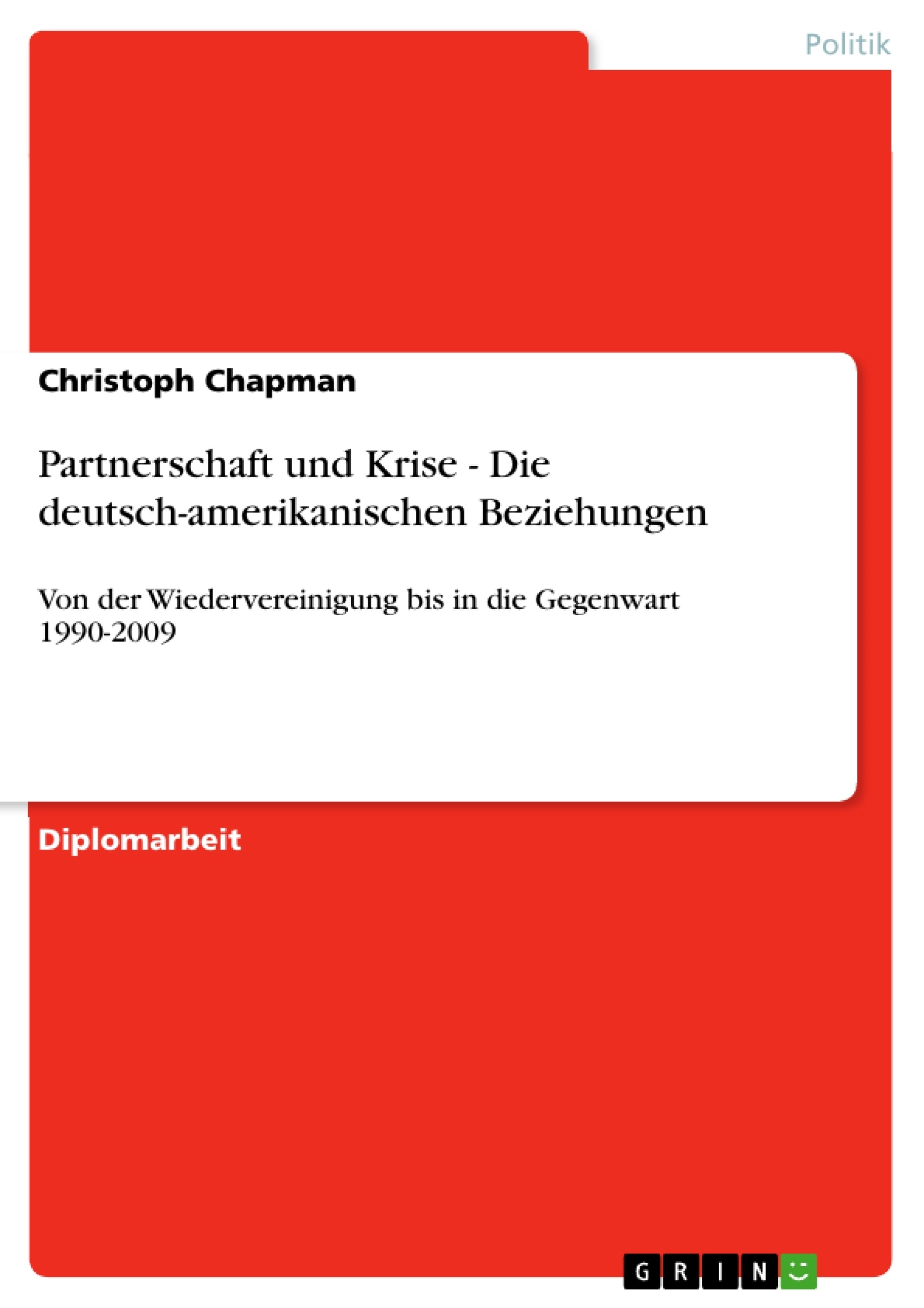Nach der Wiedervereinigung 1990 und mit dem Ende des Kalten Krieges wurde das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und den USA ambivalenter. Deutschland konzentrierte sich stärker auf die europäische Ebene. Im Zeitalter der Globalisierung folgte Amerika hingegen den Märkten, die z.B. in Asien neue Chancen eröffneten.
Die Kontakte zu Europa blieben eng, doch die USA waren längst nicht mehr so auf Europa fixiert, wie in den Jahrzehnten des Ost-West-Konfliktes. Sicherheitspolitisch blieb das zusammenwachsende Europa auf die USA angewiesen. Die Konflikte auf dem Balkan bezeugen das eindrücklich. Die USA waren als letzte verbliebene Supermacht und „Weltpolizist“ die einzige Kraft, die genug Durchsetzungsvermögen zur Lösung solcher Konflikte hatte. Die neu geborene europäische „Großmacht“ oder, wie Hans-Peter Schwarz schreibt, „Zentralmacht“ Bundesrepublik Deutschland musste hingegen ihre neue Rolle erst allmählich finden. Die Anpassung Deutschlands und der USA an die Herausforderungen der neuen Weltlage sind ein wichtiger Aspekt, um die Entwicklung ihrer Beziehungen zu verstehen. Desweiteren erfuhren die deutsch-amerikanischen Beziehungen durch die Ereignisse nach dem World-Trade-Center-Anschlag von 2001 eine erneute Veränderung.
In den letzten 20 Jahren haben sich die Beziehungen somit weit mehr verschoben als dies im gesamten Zeitraum des Kalten Krieges denkbar war. Die Arbeit setzt sich mit dieser Veränderung auseinander und diskutiert Perspektiven und Gefährdungen für die transatlantischen Beziehungen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die zunehmende Entwicklung der EU zum "Global Player". Werden die deutsch-amerikanischen Beziehungen in Zukunft durch europäisch-amerikanische Beziehungen ersetzt? Welche Rolle spielt die "Berliner Republik" in diesem Kontext und welche strebt sie an?
Im Zeitalter rapider Globalisierung und einer starken Machtverschiebung weg vom "Westen" ist das Thema der Arbeit von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Bundesrepublik, Europas und der USA.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Historische und theoretische Grundlagen
- 2.1 Historische Grundlagen der deutsch-amerikanischen Beziehungen 1945-1989
- 2.1.1 Deutschland und die USA nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2.1.2 Von der Gründung der Bundesrepublik bis zum Ende der 1960er Jahre
- 2.1.3 Von der Ostpolitik bis zur Wiedervereinigung
- 2.2 Theoretische Entwürfe der Weltordnung nach dem Kalten Krieg
- 2.1 Historische Grundlagen der deutsch-amerikanischen Beziehungen 1945-1989
- III Deutsch-amerikanische Beziehungen von der Wiedervereinigung bis zum Kosovo-Konflikt 1991-1999
- 3.1 Die USA und die Bundesrepublik nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes
- 3.1.1 Ausgangsbedingungen und außenpolitische Leitlinien der wiedervereinigten Bundesrepublik
- 3.1.2 Ausgangsbedingungen und außenpolitische Leitlinien der USA
- 3.2 Neue Krisen und Kriege und die deutsch-amerikanischen Beziehungen
- 3.2.1 Der Erste Irak-Krieg und die Zivilmacht Bundesrepublik
- 3.2.2 Der UNO-Einsatz in Somalia und das Scheitern kollektiver Sicherheit
- 3.2.3 Die Kriege in Jugoslawien und das Scheitern Europas
- 3.2.4 Bosnien und die Rückkehr der europäischen Ordnungsmacht USA
- 3.2.5 Der Kosovo-Krieg und die veränderte Bundesrepublik
- 3.3 Die Entwicklung von EU und NATO im Kontext der deutsch-amerikanischen Beziehungen
- 3.3.1 USA und Europa zwischen Konkurrenz und Partnerschaft
- 3.3.2 Die Anpassung der NATO an die neue Weltordnung: Erweiterung und Strategiewechsel
- 3.4 Zusammenfassung
- 3.1 Die USA und die Bundesrepublik nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes
- IV Deutsch-amerikanische Beziehungen und der Krieg gegen den Terror
- 4.1 Deutschlands „Uneingeschränkte Solidarität“ und der amerikanische Kreuzzug
- 4.1.1 Der 11. September und die Folgen
- 4.1.2 Der Krieg in Afghanistan
- 4.2 Exkurs: Die Macht der Ideen: Die neue Ausrichtung der US-Außenpolitik
- 4.3 Der Irak-Krieg und die Krise der deutsch-amerikanischen Beziehungen
- 4.3.1 Entwicklung der Irak-Krise im deutschen Wahlkampf 2002
- 4.3.2 Der Irak-Krieg und der Streit in der UNO
- 4.3.3 Deutschland, die USA und der Irak - Nachbetrachtung
- 4.4 Die Beinahe-Spaltung Europas
- 4.5 Zusammenfassung
- 4.1 Deutschlands „Uneingeschränkte Solidarität“ und der amerikanische Kreuzzug
- V Normalisierung der deutsch-amerikanischen Beziehungen und Ausblick
- 5.1 Entwicklung der Beziehungen nach dem Amtsantritt Angela Merkels
- 5.2 Die erweiterte EU, Deutschland und die transatlantischen Beziehungen
- 5.2.1 Europa als internationaler Akteur und das Verhältnis zu den USA
- 5.2.2 Von deutsch-amerikanischen zu europäisch-amerikanischen Beziehungen?
- 5.3 Der Westen - Quo vadis?
- 5.3.1 Ideelle und moralische Herausforderungen
- 5.3.2 Der Westen und die neue Weltordnung
- 5.4 Die USA und die Bundesrepublik: Neue Perspektiven mit Barack Obama?
- 5.4.1 Chancen und Risiken der Obama-Präsidentschaft
- 5.4.2 Partnership in Leadership? - Nagelprobe Afghanistan
- VI Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die deutsch-amerikanischen Beziehungen von der Wiedervereinigung 1990 bis in die Gegenwart (2009). Sie analysiert, wie sich die Beziehung zwischen beiden Ländern nach dem Ende des Kalten Krieges entwickelt hat und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus ergeben haben. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle Deutschlands in der neuen Weltordnung und den Auswirkungen des 11. Septembers 2001 und des Irak-Krieges auf das transatlantische Verhältnis.
- Die Entwicklung der deutsch-amerikanischen Beziehungen im Kontext des Wandels der Weltordnung nach dem Kalten Krieg
- Die Rolle Deutschlands in der europäischen Integration und die Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen
- Die Auswirkungen des 11. Septembers 2001 und des Irak-Krieges auf das deutsch-amerikanische Verhältnis
- Die Bedeutung von Sicherheitspolitik und der transatlantischen Zusammenarbeit für beide Länder
- Die Herausforderungen und Chancen der deutsch-amerikanischen Beziehungen in einer globalisierten Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beschreibt die historische Entwicklung der deutsch-amerikanischen Beziehungen im Kontext des Kalten Krieges. Sie hebt die Bedeutung der Wiedervereinigung für die beiden Länder hervor und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
- Historische und theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Grundlagen der deutsch-amerikanischen Beziehungen von 1945 bis 1989. Es untersucht die Rolle der USA im Prozess der deutschen Wiedervereinigung und analysiert die theoretischen Entwürfe der Weltordnung nach dem Kalten Krieg.
- Deutsch-amerikanische Beziehungen von der Wiedervereinigung bis zum Kosovo-Konflikt 1991-1999: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der deutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes. Es betrachtet die Ausgangsbedingungen und außenpolitischen Leitlinien beider Länder sowie die Konflikte auf dem Balkan und die Rolle der USA und Deutschlands in diesen Konflikten.
- Deutsch-amerikanische Beziehungen und der Krieg gegen den Terror: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen des 11. Septembers 2001 auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Es analysiert die deutsche Reaktion auf die Ereignisse des 11. Septembers, den Krieg in Afghanistan und die Entstehung der Krise im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg.
- Normalisierung der deutsch-amerikanischen Beziehungen und Ausblick: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der deutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Irak-Krieg und der Amtsübernahme von Angela Merkel. Es analysiert die Bedeutung der Europäischen Union für das transatlantische Verhältnis und die Herausforderungen und Chancen der deutsch-amerikanischen Beziehungen in der Zukunft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen deutsch-amerikanische Beziehungen, transatlantisches Verhältnis, Wiedervereinigung, Kalter Krieg, Weltordnung, Europäische Union, NATO, Irak-Krieg, 11. September 2001, Sicherheitspolitik, Globalisierung, Führungsrolle, Partnerschaft, Krise.
Häufig gestellte Fragen
Wie haben sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen nach 1990 verändert?
Nach der Wiedervereinigung wurde das Verhältnis ambivalenter. Deutschland fokussierte sich auf Europa, während die USA sich stärker globalen Märkten wie Asien zuwandten.
Welche Rolle spielten die Balkankonflikte für das transatlantische Verhältnis?
Sie zeigten die Abhängigkeit Europas von der militärischen Durchsetzungskraft der USA als "Weltpolizist", während Deutschland seine neue Rolle als "Zentralmacht" erst finden musste.
Welchen Einfluss hatte der 11. September 2001 auf die Partnerschaft?
Zunächst lösten die Anschläge "uneingeschränkte Solidarität" aus, führten aber später durch den Irak-Krieg zu einer tiefen Krise im deutsch-amerikanischen Verhältnis.
Wird die deutsch-amerikanische Beziehung durch eine europäisch-amerikanische ersetzt?
Die Arbeit diskutiert, ob Deutschland zunehmend als Teil eines geeinten Europas (Global Player) agiert und ob bilaterale Kontakte zugunsten EU-weiter Absprachen an Bedeutung verlieren.
Wie entwickelte sich das Verhältnis unter Angela Merkel und Barack Obama?
Unter Merkel fand eine Normalisierung statt. Die Präsidentschaft Obamas bot neue Perspektiven für eine "Partnership in Leadership", etwa in der Afghanistan-Politik.
Was war der Hauptstreitpunkt während der Irak-Krise 2002/2003?
Der Streit entzündete sich an der völkerrechtlichen Legitimation des Krieges in der UNO und der expliziten Ablehnung einer deutschen Beteiligung durch die Regierung Schröder.
- Quote paper
- Christoph Chapman (Author), 2010, Partnerschaft und Krise - Die deutsch-amerikanischen Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162434