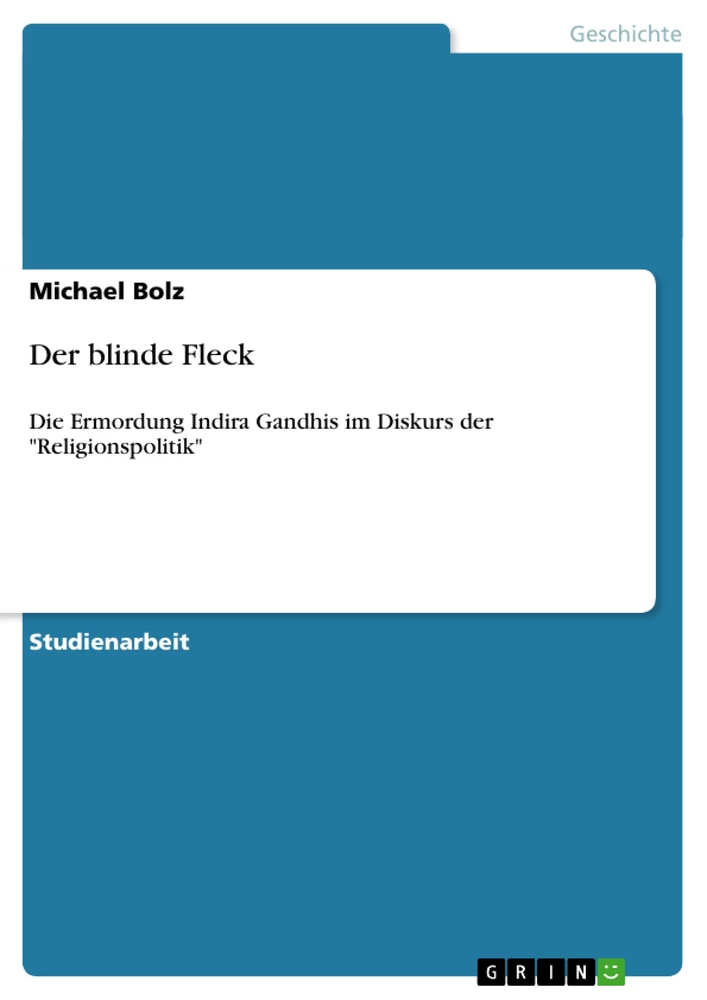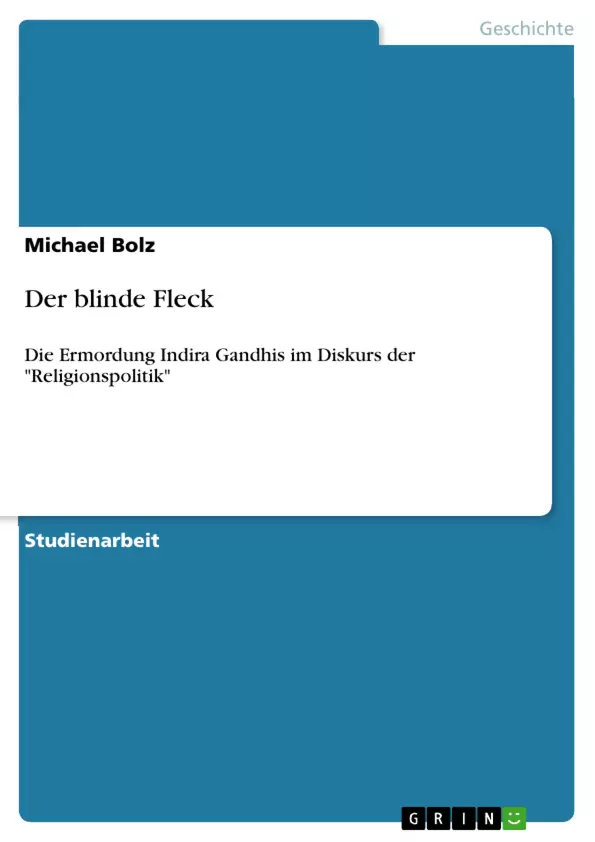Anhand der Untersuchung der Massaker von Delhi 1984 - in Folge der Ermordung von Indira Gandhi - versucht der Aufsatz nachzuweisen, wie Wissensdiskurse in der Forschung einseitig auf andere Wissensdiskurse übertragen werden, was einen blinden Fleck in der Untersuchung zur Folge hat.
Die These dieser Arbeit lautet, dass die Massaker von Delhi wesentlich von religiösen Unterschieden konstituiert waren, die man aber in der westlichen Forschung als politische ausgab.
Der Beleg der These erfolgt über eine Kontextualierung des Konflikts vor den Folien der Religion und der Praxis der Gewalt während der Massaker in Form einer dichten Beschreibung nach Sofsky.
Fazit: der blinde Fleck existiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Nach der Ermordung Indira Gandhis
- II. Meine These
- III. Gandhi selbst hat noch kurz vor ihrer Ermordung
- IV. In Folge kontextualisiere ich die Massaker
- a) Der Hinduismus trägt als wichtigstes Strukturunterscheidungsmerkmal im Herzen das Kastenwesen.
- b1) Beim Hinduismus handelt es sich nur dem Augenschein nach um eine polytheistische Religion.
- a2) Die Chaostheorie besagt, dass es hier in Europa einen Sturm geben kann, wenn im entferntesten Zipfel von Asien ein Schmetterling mit seinen Flügeln schlägt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Werk analysiert die Massaker von Delhi im Jahr 1984, die auf die Ermordung Indira Gandhis folgten, und beleuchtet dabei den Konflikt zwischen hinduistischer Mehrheitsgesellschaft und der Sikh-Minderheit. Der Text zielt darauf ab, die religionspolitischen Dimensionen des Konflikts aufzuzeigen und die Rolle des Kastenwesens im Hinduismus als ein zentrales Element der Gewaltbereitschaft zu untersuchen.
- Religionspolitische Machtkämpfe
- Kastenwesen im Hinduismus
- Die Rolle des Sikhismus im Konflikt
- Die Auswirkungen von Gewalt auf die Gesellschaft
- Die Einseitigkeit der Forschung zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Der Text schildert die gewalttätigen Übergriffe gegen die Sikh-Gemeinschaft in Delhi nach der Ermordung Indira Gandhis. Es wird die politische und religiöse Motivation des Attentats diskutiert und die Bedeutung des „Diskurses der Religionspolitik“ hervorgehoben.
- Kapitel II: Die These des Autors besagt, dass der Konflikt in Delhi von religionspolitischen Machtkämpfen geprägt war, mit der hinduistischen Mehrheit als dominantem Akteur. Die Führer beider Seiten werden als Akteure dieses Konflikts vorgestellt.
- Kapitel III: Der Text beleuchtet Gandhis Versuch, den Konflikt als rein politisch darzustellen und die Rolle der Sikh-Gemeinschaft im gesellschaftlichen Leben Indiens aufzuzeigen. Der Autor diskutiert die Unterschiede zwischen den religionspolitischen Praktiken von Hinduismus und Sikhismus.
- Kapitel IV: Der Autor kontextualisiert die Massaker von Delhi vor dem Hintergrund der verschiedenen religionspolitischen Diskurse von Hinduismus und Sikhismus. Er kritisiert die einseitige Forschungsperspektive und betont die Bedeutung der religionspolitischen Verschiedenheit.
Schlüsselwörter
Der Text beleuchtet die Massaker von Delhi 1984 als Beispiel für die Auswirkungen des religionspolitischen Konflikts zwischen Hinduismus und Sikhismus. Zentrale Themen sind das Kastenwesen im Hinduismus, die Integrationsprozesse innerhalb des Hinduismus, die Rolle des Sikhismus im Konflikt und die einseitige Herangehensweise der Forschung. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Religion, Politik und Gewalt.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Massaker von Delhi 1984?
Gewaltsame Ausschreitungen gegen die Sikh-Minderheit in Indien, die auf die Ermordung der Premierministerin Indira Gandhi folgten.
Was ist der "blinde Fleck" in der Forschung zu diesem Thema?
Die These besagt, dass westliche Forschung den Konflikt fälschlicherweise als rein politisch darstellte und die tiefen religiösen Wurzeln übersah.
Welche Rolle spielt das Kastenwesen im Hinduismus dabei?
Das Kastenwesen wird als zentrales Strukturmerkmal analysiert, das die gesellschaftliche Hierarchie und die Gewaltbereitschaft gegenüber "Anderen" mitprägte.
Wie wird die Gewalt in der Arbeit beschrieben?
Der Autor nutzt die Methode der "dichten Beschreibung" nach Sofsky, um die Praxis der Gewalt während der Massaker detailliert zu kontextualisieren.
Wer ermordete Indira Gandhi?
Sie wurde von ihren eigenen Sikh-Leibwächtern erschossen, was die darauffolgenden Racheakte gegen die gesamte Sikh-Gemeinschaft auslöste.
- Quote paper
- Michael Bolz (Author), 2010, Der blinde Fleck, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163501