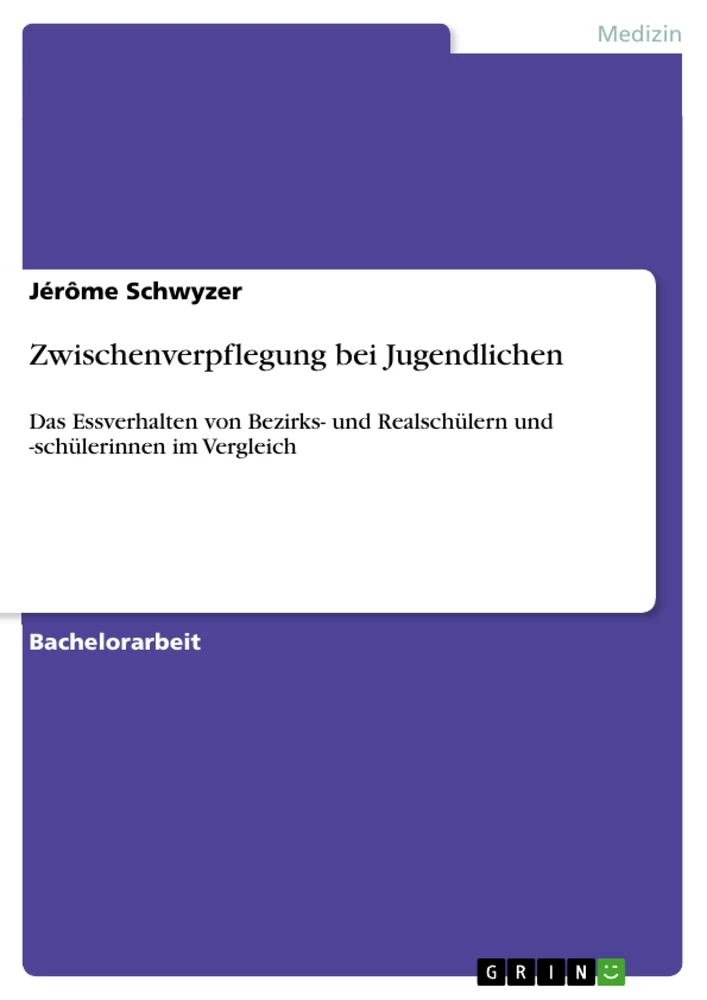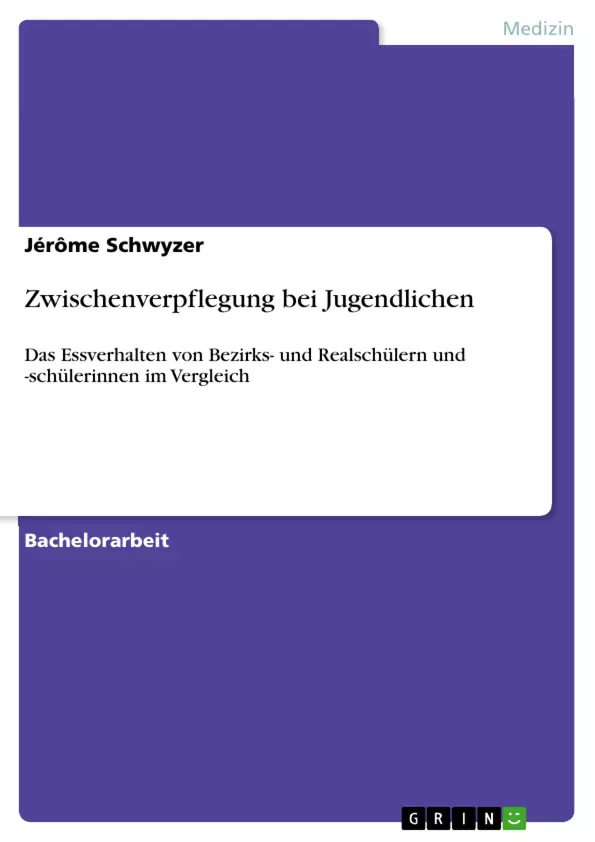Aus dem Vorwort:
Die vorliegende Arbeit setzt sich damit auseinander, welchen Einfluss das Elternhaus
auf das Essverhalten Jugendlicher hat. Aus der Leseforschung ist bekannt,
dass der Bildungsstand der Eltern bzw. das intellektuelle Interesse im Allgemeinen
und im Besonderen das Interesse an Lesetexten sich signifikant auswirkt auf die
zu erwerbenden Lesekompetenzen der Schülerinnen und Schüler (Hurrelmann
2004, in Groeben/Hurrelmann, S. 169 f). Als angehender Deutsch- und Hauswirtschaftslehrer
interessiere ich mich im Speziellen dafür, ob die Erkenntnisse der
Leseforschung auch auf die Essgewohnheiten ausgeweitet werden können, konkret,
ob sich Schüler und Schülerinnen höherer Niveauzüge in Bezug auf den Verzehr
von Obst und Gemüse und die Zufuhr von Energie liefernden Nährstoffen
günstiger ernähren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Beschrieb des Vorgehens
- Sozialwissenschaftlicher Teil: Begründung des Forschungsvorhabens
- Ernährungswissenschaftlicher Teil: Referenzwerte und Lebensmittelpyramide
- Allgemeine Aussagen und Nährstoffzufuhr
- Referenzwerte zur Energiezufuhr
- Die Lebensmittelpyramide
- Die blaue Gruppe
- Die grüne Gruppe
- Die braune Gruppe
- Die rote Gruppe
- Die gelbe und die rosa Gruppe
- Forschender Teil: Bezirks- und Realschüler und -schülerinnen im Vergleich
- Lebensstile und Orientierungen
- Wohneigentum
- Zeitungsabonnemente
- Berufe der Eltern und Muttersprache
- Lebensgewohnheiten der Jugendlichen
- Essverhalten in den Familien
- Zwischenmahlzeiten im Vergleich
- Lebensstile und Orientierungen
- Diskussion und Interpretation
- Fazit und Forderungen an die Ernährungsbildung
- Persönliches Schlusswort und Danksagung
- Lerngewinn
- Dank
- Quellenverheichnis
- Literaturverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Bildverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Elternhauses auf das Essverhalten von Jugendlichen, insbesondere den Konsum von Obst und Gemüse sowie die Zufuhr energieliefernder Nährstoffe. Sie analysiert, ob sich Schülerinnen und Schüler höherer Niveauzüge in diesen Bereichen gesünder ernähren als ihre Altersgenossen aus niedrigeren Niveauzügen.
- Der Zusammenhang zwischen elterlichem Bildungsstand und dem Essverhalten von Jugendlichen.
- Die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung und die Rolle der Lebensmittelpyramide.
- Die Analyse des Essverhaltens von Bezirks- und Realschülern im Vergleich.
- Die Identifizierung von Faktoren, die das Essverhalten von Jugendlichen beeinflussen.
- Die Ableitung von Forderungen an die Ernährungsbildung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Forschungsvorhaben und die Zielsetzung der Arbeit vor. Der sozialwissenschaftliche Teil beleuchtet den Einfluss des Elternhauses auf das Essverhalten von Jugendlichen und bezieht sich auf bestehende Forschungsergebnisse. Der ernährungswissenschaftliche Teil erklärt die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung und die Lebensmittelpyramide. Der forschende Teil analysiert das Essverhalten von Bezirks- und Realschülern anhand von Fragebögen und stellt die Ergebnisse dar. Die Diskussion und Interpretation der Ergebnisse beleuchtet die wichtigsten Erkenntnisse der Studie. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und leitet Forderungen an die Ernährungsbildung ab.
Schlüsselwörter
Essverhalten, Jugendliche, Elternhaus, Bildungsstand, Ernährung, Lebensmittelpyramide, Bezirks- und Realschüler, Zwischenmahlzeiten, Ernährungsbildung.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat das Elternhaus auf das Essverhalten von Jugendlichen?
Das Elternhaus prägt durch Vorbildfunktion, Bildungsstand und sozioökonomischen Status maßgeblich die Ernährungsgewohnheiten, insbesondere den Konsum von Obst und Gemüse.
Ernähren sich Schüler höherer Niveauzüge gesünder?
Die Untersuchung analysiert, ob ein Zusammenhang zwischen dem schulischen Niveau (z. B. Bezirksschule vs. Realschule) und einer günstigeren Nährstoffzufuhr besteht.
Was ist die Lebensmittelpyramide?
Ein grafisches Modell, das die empfohlenen Mengenverhältnisse verschiedener Lebensmittelgruppen für eine ausgewogene Ernährung darstellt.
Welche Rolle spielen Zwischenmahlzeiten bei Jugendlichen?
Zwischenmahlzeiten sind oft eine Quelle für überschüssige Energie durch Zucker und Fett, können aber bei richtiger Wahl (Obst/Gemüse) zur Nährstoffdeckung beitragen.
Was kann die Ernährungsbildung in Schulen leisten?
Schulen können Wissensdefizite ausgleichen und Jugendliche zu einem eigenverantwortlichen, gesunden Essverhalten befähigen, unabhängig vom Elternhaus.
- Quote paper
- Jérôme Schwyzer (Author), 2010, Zwischenverpflegung bei Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163558