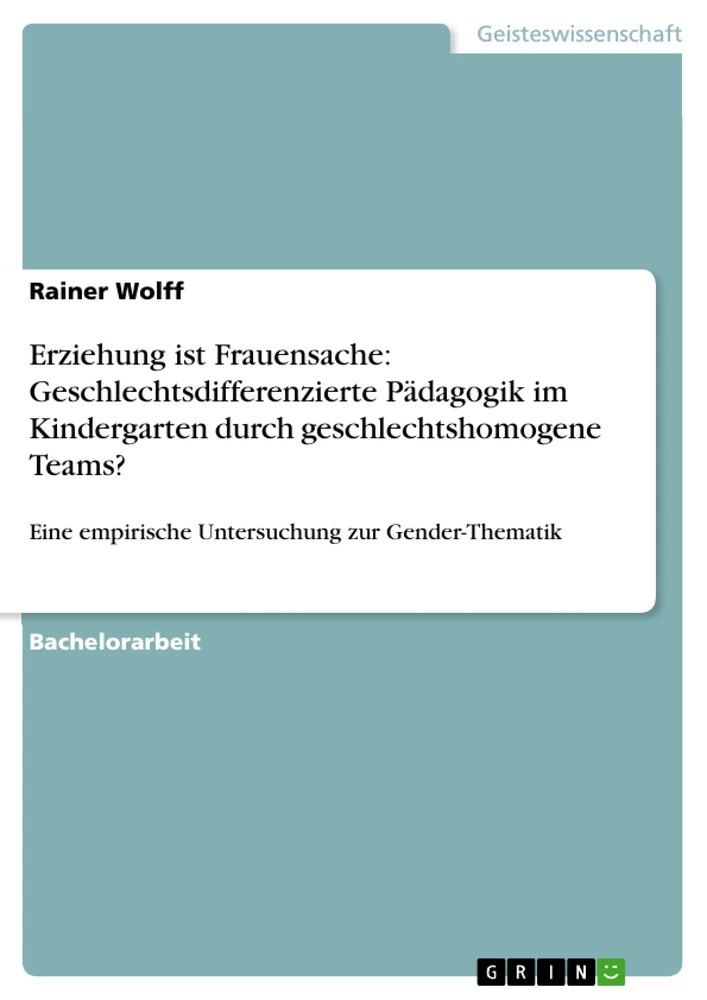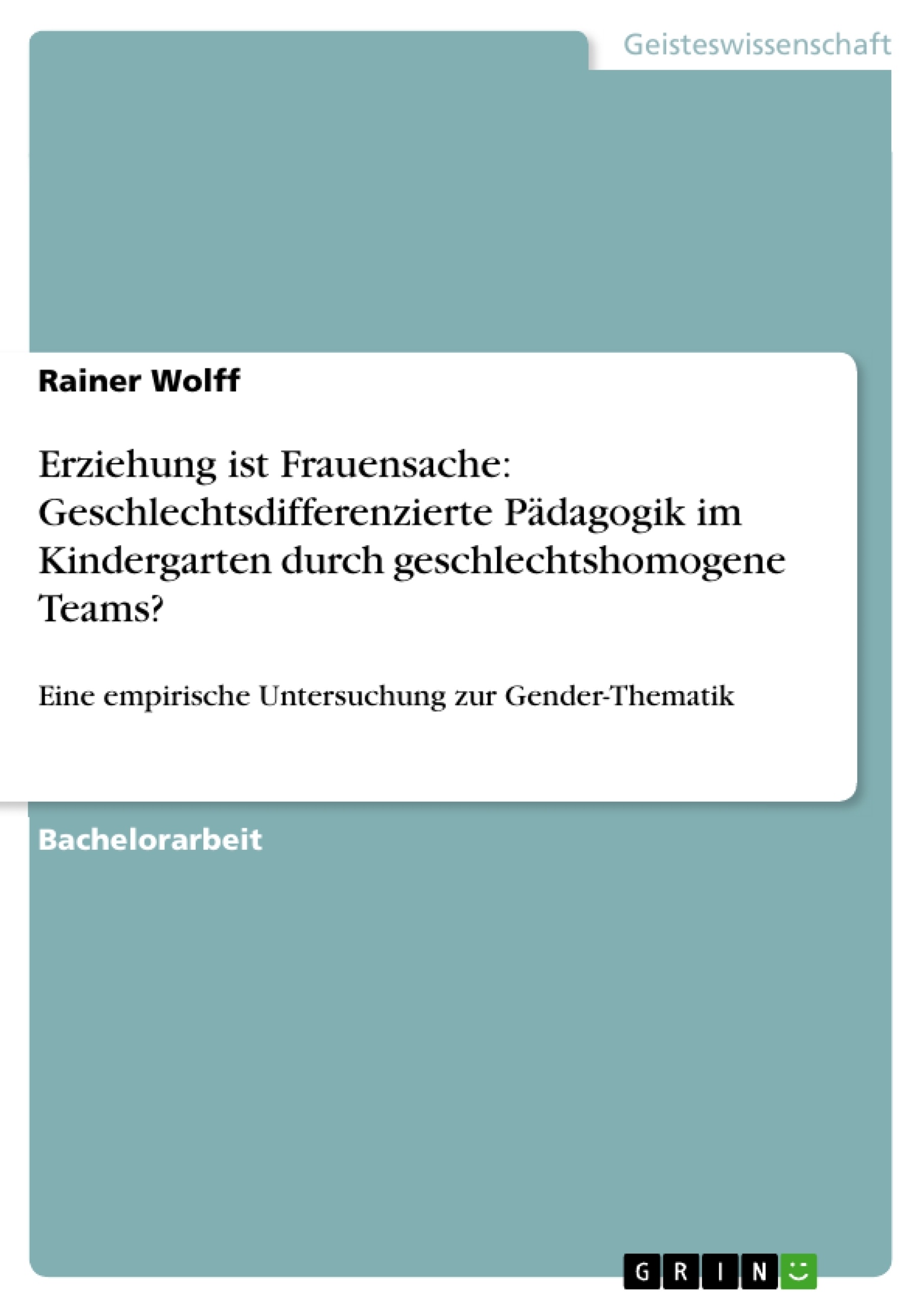Geschlechtsrollenstereotype, denen Rollenklischees zugrunde liegen, sind kollektive Vorstellungen einer sozialen Gemeinschaft, welches Verhalten für einen Mann oder eine Frau als angemessen, also zu erwartend gilt, und welches eben nicht. Wer sich deutlich außerhalb dieser Rollenerwartungen bewegt läuft Gefahr, sich oben beschriebener Etikettierung, oft genug gar einer Stigmatisierung ausgesetzt zu sehen.
Niemand kann von sich behaupten er/sie sei frei von derartigen Vorstellungen, Ansichten und Erwartungen.
Welche äußeren Faktoren bedingen diese Geschlechterrollenstereotype, wie und wann werden sie konstituiert und weshalb sind die damit verbundenen Erwartungshaltungen so schwer aufzubrechen? Im Kindergarten bekomme ich von Eltern immer wieder die Rückmeldung, wie toll es doch sei, wenigstens einen männlichen Erzieher im Kindergarten zu wissen.
Würden Mädchen und Jungen davon profitieren, wenn mehr männliche Fachkräfte in Kindergärten tätig wären oder nur die Jungen? Welchen Einfluß hat die Anwesenheit oder das Fehlen von Männern in diesem Arbeitsbereich für die Entwicklung der Geschlechtsidentität der Kinder – könnten Rollenstereotype aufgebrochen werden oder fände deren Reproduktion schlicht eine männliche Ergänzung?
Im Rahmen dieser Bachelor-Abschlußarbeit beleuchte ich diese Fragestellungen im theoretischen Teil (Teil A) mit Hilfe entsprechender Fachliteratur zu folgenden Themenkomplexen:
Zunächst lege ich die übergeordnete Strategie des Gender Mainstreaming kurz dar und schildere die Aktualität der Gesamtdebatte bezogen auf den Bereich Kindergarten. Im Anschluß daran folgt eine deskriptive Darstellung geschlechtsbezogenen Verhaltens von Mädchen und Jungen sowie eine ausführliche Analyse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im Kindergartenalter.
Komplettiert wird die theoretische Ausarbeitung durch eine Betrachtung genderbezogener Anteile in der Erzieherinnenausbildung und die Darstellung der Aspekte geschlechtsdifferenzierter Pädagogik im Kindergarten.
Die beiden empirischen Teile (Teil B+C) dienen dazu, mich den Antworten auf folgende Fragen zu nähern:
Wie wird das Verhalten von Mädchen und Jungen im Kindergarten von Erzieherinnen wahrgenommmen und hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen interpretiert?
Inwieweit setzen sich die pädagogischen Fachkräfte mit ihren eigenen geschlechtsbezogenen Sozialisationserfahrungen auseinander und sind sich der Subjektivität ihrer Wahrnehmung von Mädchen und Jungen bewußt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil A: Die Gender-Thematik im Kindergarten
- Die Strategie des Gender Mainstreaming
- Definition
- Herkunft und gesetzliche Grundlagen
- Aktualität des Gender Mainstreaming im Kindergarten
- Die Wahrnehmung des Verhaltens von Mädchen und Jungen
- Konfliktverhalten und Aggressionen
- Spielverhalten und Interessenlagen
- Die Interaktion mit den Erzieherinnen
- Die Entwicklung der Geschlechtsidentität
- Definition
- Biologische Faktoren
- Entwicklungspsychologische Konzepte
- Lerntheorien
- Modelle von Piaget und Kohlberg
- Die Entwicklung von Geschlechtsidentität als Sozialisationsprozess
- Die Bedeutung von Vater und Mutter
- Die Bedeutung von Frauen und Männern im Kindergarten
- Frauen im Arbeitsfeld Kindergarten
- Männer im Arbeitsfeld Kindergarten
- Fazit
- Die Ausbildung zur Erzieherin
- Tätige Personen im Bereich Kindergarten
- Genderkompetenz
- Definition
- Die Ausbildung zur Erzieherin unter dem Aspekt der Gender-Thematik
- Biografiearbeit und Selbstreflexion in der Erzieher-ausbildung
- Fort- und Weiterbildungen
- Fazit
- Geschlechtsdifferenzierte Pädagogik im Kindergarten
- Was zeichnet geschlechtsdifferenzierte Pädagogik aus?
- Konkrete Möglichkeiten der Umsetzung
- Die Zusammenarbeit im Team
- Männer und Frauen im Kindergartenteam
- Die gesellschaftliche Anerkennung des Erziehers und der Erzieherin
- Zusammenfassung des theoretischen Teils
- Die Strategie des Gender Mainstreaming
- Teil B: Planung und Durchführung der Untersuchung
- Das Forschungsanliegen
- Darstellung der Untersuchungsmethode
- Der Fragebogen als Untersuchungsinstrument
- Aufbau und Konstruktion des Fragebogens
- Wahrnehmung geschlechtsspezifischer Stereotype bei Kindern im Kindergartenalter (Fragen 0-5)
- Erfahrungen mit Biografiearbeit bezogen auf die Gender-Thematik (Fragen 6-11)
- Die pädagogischen Handlungsfelder im Fokus der Gender-Thematik
- Die Durchführung der Untersuchung
- Auswahl der teilnehmenden Einrichtungen
- Verteilung und Abholung der Fragebögen
- Rücklaufquote
- Qualitative Resonanz und Besonderheiten
- Teil C: Auswertungsverfahren und Ergebnisse
- Auswertungsmethodologie
- Gesamtheit der Erhebung
- Auswertungs Bereiche
- Wahrnehmung geschlechtsspezifischer Stereotype (Fragen 0-5)
- Erfahrungen mit Biografiearbeit und Selbstreflexion bezogen auf die Gender-Thematik (Fragen 6-11)
- Männer im Arbeitsfeld Kindergarten (Fragen 12-17)
- Die pädagogischen Handlungsfelder im Fokus der Gender-Thematik
- Zusammenfassung des empirischen Teils
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Gender-Thematik im Kindergarten, insbesondere die Rolle von geschlechtshomogenen Teams und deren Einfluss auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Kindern. Die Arbeit analysiert die Wahrnehmung geschlechtsspezifischen Verhaltens durch Erzieherinnen und hinterfragt die geschlechtsdifferenzierte Pädagogik im Kontext der Erzieherinnenausbildung und der gesellschaftlichen Erwartungen.
- Gender Mainstreaming im Kindergarten
- Entwicklung der Geschlechtsidentität im Kindesalter
- Geschlechtsspezifische Stereotype und deren Wahrnehmung
- Geschlechtsdifferenzierte Pädagogik
- Rolle männlicher Erzieher im Kindergarten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen im Kindergarten ein und beschreibt die persönliche Motivation der Autorin für die Wahl dieses Themas. Ausgehend von eigenen Beobachtungen im Kindergartenalltag werden zentrale Forschungsfragen formuliert, die im theoretischen und empirischen Teil der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Autorin skizziert dabei den Aufbau der Arbeit und die Methode der Untersuchung.
Teil A: Die Gender-Thematik im Kindergarten: Dieser Teil bietet einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen der Gender-Thematik im Kontext des Kindergartens. Es werden die Strategien des Gender Mainstreaming erläutert und die aktuelle Relevanz der Thematik im Kindergarten hervorgehoben. Die Arbeit analysiert die Wahrnehmung des Verhaltens von Mädchen und Jungen durch Erzieherinnen, beleuchtet die Entwicklung der Geschlechtsidentität und diskutiert die Rolle der Erzieherinnenausbildung in Bezug auf Genderkompetenz. Schließlich werden verschiedene Aspekte geschlechtsdifferenzierter Pädagogik im Kindergarten vorgestellt und kritisch diskutiert.
Teil B: Planung und Durchführung der Untersuchung: Dieser Teil beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Es wird die Wahl des Fragebogens als Untersuchungsinstrument begründet, der Aufbau des Fragebogens erläutert und das Vorgehen bei der Auswahl der teilnehmenden Einrichtungen, der Verteilung und Abholung der Fragebögen sowie die Rücklaufquote dargestellt. Qualitative Aspekte der Untersuchung und besondere Beobachtungen werden ebenfalls berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Gender Mainstreaming, Geschlechtsidentität, Geschlechtsrollenstereotype, geschlechtsdifferenzierte Pädagogik, Kindergarten, Erzieherinnenausbildung, Männer im Kindergarten, empirische Untersuchung, Fragebogen.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Gender-Thematik im Kindergarten
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Gender-Thematik im Kindergarten, insbesondere die Rolle von geschlechtshomogenen Teams und deren Einfluss auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Kindern. Analysiert werden die Wahrnehmung geschlechtsspezifischen Verhaltens durch Erzieherinnen, die geschlechtsdifferenzierte Pädagogik im Kontext der Erzieherinnenausbildung und die gesellschaftlichen Erwartungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Gender Mainstreaming im Kindergarten, Entwicklung der Geschlechtsidentität im Kindesalter, geschlechtsspezifische Stereotype und deren Wahrnehmung, geschlechtsdifferenzierte Pädagogik und die Rolle männlicher Erzieher im Kindergarten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus drei Teilen: Teil A bietet einen theoretischen Überblick über die Gender-Thematik im Kindergarten, inklusive Gender Mainstreaming, Geschlechtsidentitätsentwicklung und Erzieherinnenausbildung. Teil B beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung mit Fragebögen. Teil C präsentiert die Auswertung der Ergebnisse.
Welche Methode wurde zur Untersuchung verwendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf Fragebögen, die in ausgewählten Kindergärten verteilt wurden. Der Fragebogen erfasst die Wahrnehmung geschlechtsspezifischer Stereotype bei Kindern, Erfahrungen mit Biografiearbeit und die pädagogischen Handlungsfelder im Fokus der Gender-Thematik.
Welche Aspekte der Gender-Thematik werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die Wahrnehmung des Verhaltens von Mädchen und Jungen, die Entwicklung der Geschlechtsidentität (inkl. biologischer Faktoren und lerntheoretischer Konzepte), die Rolle von Frauen und Männern im Kindergarten, die Genderkompetenz in der Erzieherinnenausbildung und die Umsetzung geschlechtsdifferenzierter Pädagogik.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Teil C der Arbeit präsentiert die Auswertung der Fragebögen zu den Themen Wahrnehmung geschlechtsspezifischer Stereotype, Erfahrungen mit Biografiearbeit, die Rolle männlicher Erzieher im Kindergarten und die pädagogischen Handlungsfelder im Fokus der Gender-Thematik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gender Mainstreaming, Geschlechtsidentität, Geschlechtsrollenstereotype, geschlechtsdifferenzierte Pädagogik, Kindergarten, Erzieherinnenausbildung, Männer im Kindergarten, empirische Untersuchung, Fragebogen.
Wo finde ich ein detailliertes Inhaltsverzeichnis?
Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis mit allen Kapiteln und Unterkapiteln befindet sich im oberen Teil des bereitgestellten Dokuments.
- Citation du texte
- Rainer Wolff (Auteur), 2010, Erziehung ist Frauensache: Geschlechtsdifferenzierte Pädagogik im Kindergarten durch geschlechtshomogene Teams? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164038