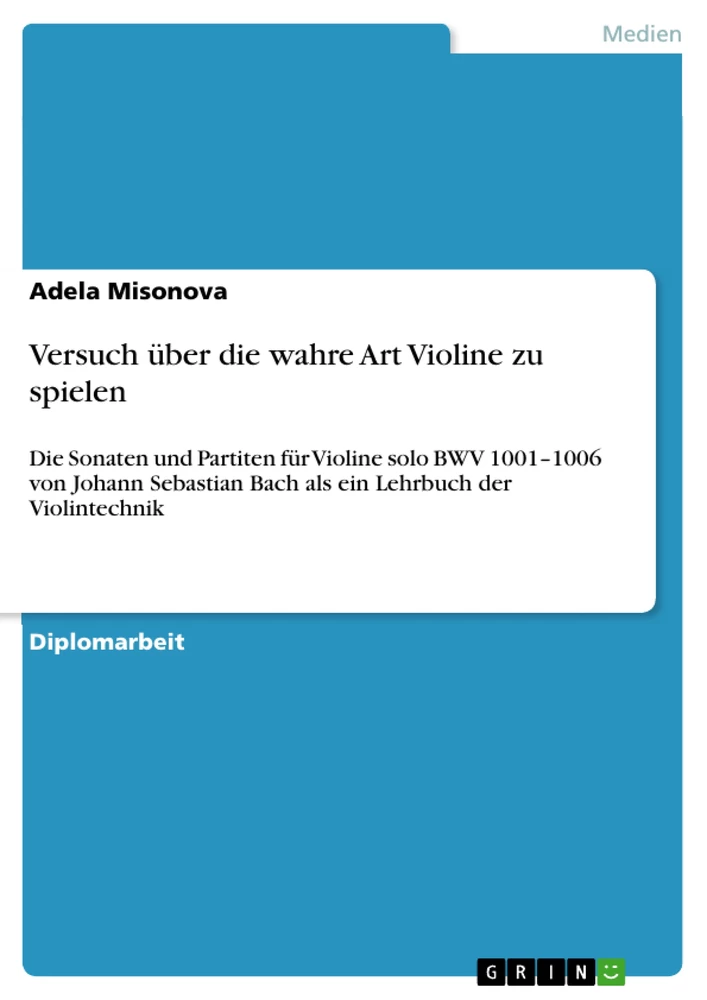Seit der Komposition der Sonaten und Partiten für Violine solo lassen sich beinahe 300 Jahre zählen. Das Werk weist außer den hohen künstlerischen Qualitäten auch praktischmethodische Inhalte vor. Als solches brachte es in der Geschichte einige Kontroversen hervor und wurde zum Thema in mehreren theoretischen und wissenschaftlichen Analysen und Diskussionen. Heutzutage ist das Werk aus dem Konzertleben nicht mehr wegzudenken.
Wegen seiner hohen geigerischen Ansprüche wird es aber auch als Bestandteil verschiedener Prüfungen, Probespiele und Violin-Wettbewerbe genutzt. Leider setzen sich viele Studenten mit der Komposition nur in diesem Zusammenhang auseinander.
Es ist nicht direkt nachzuweisen, warum Johann Sebastian seinen großen Violinzyklus schrieb. Es wurde von ihm kein Vorwort, keine „Gebrauchsanweisung“ hinterlassen. Wenn man Bachs Persönlichkeit so betrachtet, wie sie viele seiner Zeitgenossen beschrieben, erscheint die Theorie einer autodidaktischen Schaffensarbeit als sehr wahrscheinlich.
In den ersten Kapiteln meiner Arbeit versuche ich Bachs Leben bis hin zur Köthener Zeit zu schildern. Daraus ergibt sich, dass Bach in den Lehrjahren ein scharfsinniger Schüler und später ein fleißiger Autodidakt war. Es ist also denkbar, dass Bach seine Sonaten und Partiten schrieb, um damit die geschmackvolle Umsetzung des Kontrapunkts auf einem Melodieinstrument auszuloten.
Was ist das Besondere an diesem Werk? Warum sind die Violinisten der vielen zurück greifenden Generationen begierig das Werk immer wieder zur Aufführung zu bringen? Mit den Sonaten und Partiten übergibt Bach jedem Geiger ein Werk von überzeugender Geschlossenheit, dessen Aufführung eine technische Voraussetzung auf professionellem Niveau erfordert. Ebenso wichtig ist aber auch eine gründliche musiktheoretische und musikgeschichtliche Grundlage zu besitzen, die das Werk im Kontext der Entstehungszeit zeigt.
Nach dem Vorbild von Carl Philipp Emanuel Bach fasse ich in der vorliegenden Diplomarbeit diese erforderliche Zusammenwirkung vom geigerischen Können auf möglicht höchstem Niveau mit theoretischen und geschichtlichen Kenntnissen unter dem Begriff „die wahre Art Violine zu spielen“ zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Vorwort
- Teil I. HISTORISCHER HINTERGRUND
- 1. Bachs Werdegang zum Musiker und die ersten Anstellungen
- 1.1 Bach als Schüler
- 1.2 Lüneburg
- 1.3 Arnstadt
- 1.4 Mühlhausen
- 1.5 Weimar
- 1.6 Köthen
- 2. Bachs Bildung und musikalische Fertigkeiten im Spiegel der Zeit
- 2.1 Gelehrsamkeit des rechten Kapellmeisters
- 2.2 Septem artes liberales
- 2.2.1 Trivium - Wortwissenschaften
- 2.2.1.1 Grammatik
- 2.2.1.2 Rhetorik und Poetik
- 2.2.1.3 Dialektik
- 2.2.2 Quadrivium - Zahlenwissenschaften
- 2.2.2.1 Musik und Mathematik
- 2.2.2.2 Astronomie
- 2.2.2.3 Logik
- 2.3 Bach als Geiger und Organist
- Teil II. AUFFÜHRUNGSPRAKTISCHE GESICHTSPUNKTE EINER INTERPRETATION
- 3. Glaubwürdige Quellen als Grundlage zur verständnisvollen Wiedergabe
- 3.1 Was ist Aufführungspraxis?
- 3.2 Probleme der Notation
- 3.3 Bachs Autograph und andere Manuskripte
- 3.4 Erst- und Neudrucke
- 3.4.1 Ausgabe Johann Joachims vom Jahr 1908
- 4. Wichtige Merkmale der Musizierpraxis im 17. und 18. Jahrhundert
- 4.1 Musik als Fremdsprache
- 4.2 Takthierarchie
- 4.3 Zur Tongebung
- 4.4 Zur Artikulation
- 4.4.1 Bindebögen
- 4.4.2 Staccato und spiccato
- 4.4.3 Passagen
- 4.5 Instrumentarium
- 4.6 Abstrichregel
- Teil III. PRAKTISCHE ANWEISUNGEN UND EMPFEHLUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN PASSAGEN
- 5. Partita E-Dur als Beispiel pars pro toto
- 6. Beschreibung der Tanzcharaktere und daraus resultierende Hilfe zur Interpretation
- 6.1 Tempo, Stil und Charakter
- 6.2 Tanzcharaktere im Einzelnen
- 6.2.1 Preludium
- 6.2.2 Loure
- 6.2.3 Gavotte en Rondeau
- 6.2.4 Menuett
- 6.2.5 Bourée
- 6.2.6 Gigue
- 7. Detaillierte Betrachtung einiger wichtiger Prinzipien und Klangeffekte für die Musizierpraxis
- 7.1 inégal-Spiel
- 7.2 Bindebögen
- 7.3 Arpeggio
- 7.4 Besonderheiten und Klangeffekte
- 7.5 Vibrato
- Bachs musikalischer Werdegang und die Entwicklung seiner Fähigkeiten
- Die Aufführungspraxis im 17. und 18. Jahrhundert
- Die technischen Anforderungen der Sonaten und Partiten
- Die musiktheoretischen und musikgeschichtlichen Hintergründe des Werks
- Praktische Interpretationshilfe anhand ausgewählter Passagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Johann Sebastian Bachs Sonaten und Partiten für Violine solo BWV 1001-1006 als Lehrbuch der Violintechnik. Sie betrachtet das Werk im Kontext von Bachs Leben und musikalischer Entwicklung sowie der historischen Aufführungspraxis. Die Arbeit zielt darauf ab, die geigerischen Herausforderungen des Werks zu beleuchten und die Bedeutung der theoretischen und musikgeschichtlichen Grundlagen für eine authentische Interpretation zu verdeutlichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: Der erste Teil widmet sich dem historischen Hintergrund und beleuchtet Bachs Leben und musikalische Entwicklung. Dabei werden wichtige Stationen seiner Karriere sowie seine musikalische Ausbildung und seine Fähigkeiten als Geiger und Organist hervorgehoben. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Aufführungspraktischen Gesichtspunkten, die für eine authentische Interpretation der Sonaten und Partiten unerlässlich sind. Hier werden Themen wie die historische Notation, die Rekonstruktion der Aufführungspraxis und die Bedeutung von Quellenstudien behandelt. Im dritten Teil der Arbeit werden praktische Hinweise und Empfehlungen zu ausgewählten Passagen aus den Sonaten und Partiten gegeben. Dabei werden wichtige Prinzipien der Violintechnik wie das inégal-Spiel, Bindebögen, Arpeggio und Vibrato erläutert. Der Fokus liegt auf der Interpretation der einzelnen Tanzcharaktere und der Bedeutung der technischen und musikalischen Details für die Gestaltung der Musik.
Schlüsselwörter
Johann Sebastian Bach, Sonaten und Partiten für Violine solo, Violintechnik, Aufführungspraxis, Musikgeschichte, Musiktheorie, Interpretation, inegal-Spiel, Bindebögen, Arpeggio, Vibrato.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Bachs Sonaten und Partiten für Violine solo?
Es handelt sich um einen Zyklus von sechs Werken (BWV 1001–1006), die höchste geigerische und kompositorische Meisterschaft vereinen.
Warum schrieb Bach diesen Violinzyklus?
Es wird vermutet, dass Bach die Möglichkeiten des Kontrapunkts auf einem Melodieinstrument ausloten und ein autodidaktisches Lehrwerk schaffen wollte.
Was bedeutet „historische Aufführungspraxis“?
Dabei geht es um die Interpretation von Musik unter Berücksichtigung der Instrumente, Techniken und des Wissens der Entstehungszeit.
Welche Rolle spielt die Rhetorik in Bachs Musik?
Musik wurde im Barock als „Klangrede“ verstanden. Bach nutzte rhetorische Figuren, um Emotionen und Inhalte musikalisch auszudrücken.
Was ist das Besondere an der Partita E-Dur?
Diese Partita besteht aus verschiedenen Tanzcharakteren wie Preludium, Loure und Gavotte, die jeweils spezifische Anforderungen an Tempo und Stil stellen.
Welche technischen Prinzipien werden in der Arbeit erläutert?
Die Arbeit behandelt unter anderem das Inégal-Spiel, Arpeggio-Techniken, Bindebögen und die historische Artikulation.
- Quote paper
- Adela Misonova (Author), 2010, Versuch über die wahre Art Violine zu spielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164204