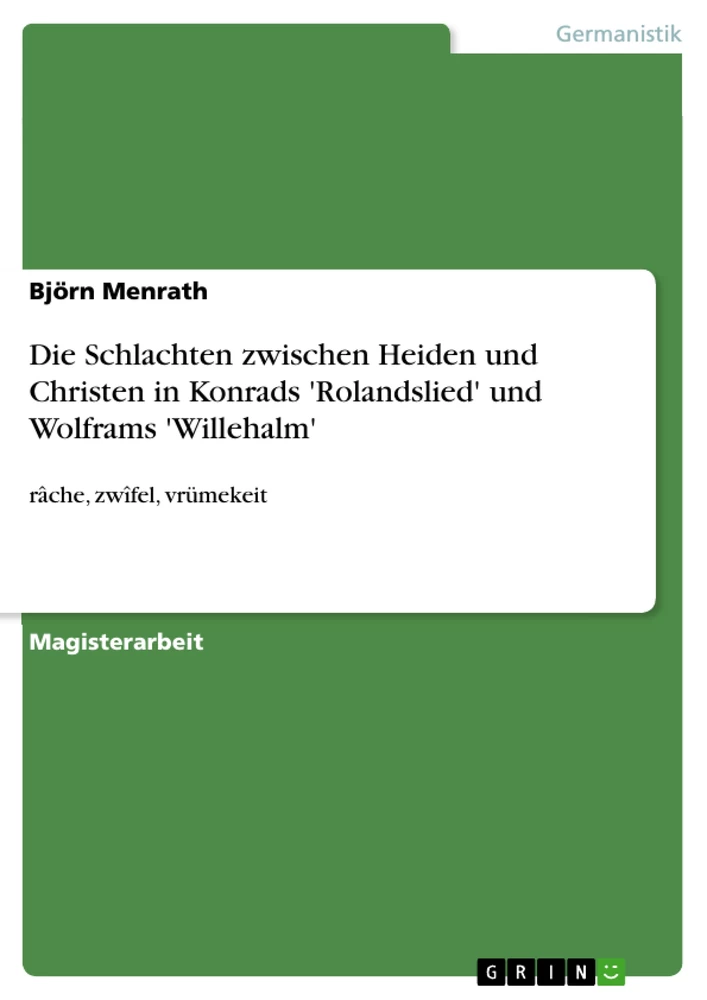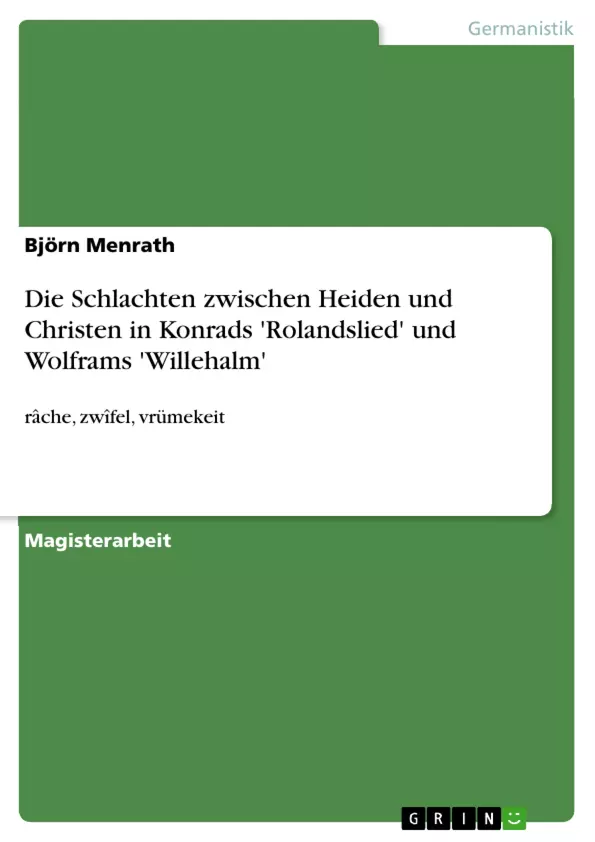In der Arbeit werden die unterschiedlichen Darstellungen des Schlachtgeschehens im Rolandslied (RL) des Pfaffen Konrad und im Willehalm (Wh) Wolframs v. Eschenbach analysiert. Ausgehend von der Annahme, dass beide Autoren divergierende Wirkungsabsichten verfolgen, werden mittels Einzeluntersuchungen die gewählten Darstellungsmodi der Schlachten miteinander verglichen u. hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Textaussage befragt. Dabei zeigt sich, dass die schlichtere Komposition des RL, in der die Schlachten in eine Reihe von Einzelkämpfen zerlegt werden, die dualistische Grundposition des Textes konsequent unterstreicht, während Wolfram für die Gestaltung von Differenzen und die Problematisierung der Gewalt einen komplexeren Aufbau benötigt.
Die Arbeit besteht aus 4 Kapiteln, welche die Schlachtdarstellungen jeweils mit Hilfe verschiedener Untersuchungsparadigma miteinander vergleichen. Begonnen wird im 1. Kapitel mit den Gründen, Begründungen u. Rechtfertigungen, welche in den Texten o. von einzelnen Figuren genannt werden, um zu erläutern, warum gekämpft wird. Dann rücken die Kämpfer selbst in den Mittelpunkt, um die Rolle des Einzelnen im Verhältnis zum Kollektiven der Schlacht zu klären. Dabei spielen die Relationen zwischen Zweikämpfen u. Massenschlachten genauso eine Rolle, wie die zuvor herausgearbeiteten Motive einzelner Akteure u. ihre Verknüpfung mit den allgemeinen Zielen der kämpfenden Kollektive. Ein Exkurs erörtert dann die Rolle des Genelun aus dem RL.
Das 3. Kap. widmet sich den Inszenierungen von Gewalt. Um zu klären, wie Gewalt im Text dargestellt wird, werden einige Arten von Gewaltdarstellungen, die dort zu finden sind, untersucht, indem ihr jeweils quantitativ u. qualitativ unterschiedlicher Einsatz analysiert wird. Akustische Phänomene u. verbale Gewaltakte spielen dabei eine Rolle, aber auch drastische Tötungen, Blutströme u. monströse Kämpfer. Als besonderer Akteur wird Rennewart aus dem Wh untersucht. Im 4. Kap. wird die These von Bumke – „Während sonst der Krieg die Folie bildet für die Darstellung des Handelns Einzelner, wird im Wh der Krieg selbst zum Thema.“ – überprüft. Dazu wird geklärt, wie u. von wem der Krieg selbst im Wh thematisiert wird, u. was dieses Nachdenken über den Krieg für die Dichtung bedeutet. Ein Vergleich mit dem RL zeigt dann, warum der Krieg dort nur eine Folie zur Darstellung des Handelns einzelner Figuren bildet. Im Schlusswort werden die erarbeiteten Unterschiede zusammengefasst u. abschließend bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Warum kämpfen sie überhaupt?
- Exkurs: Theologische Kriegslegitimation im Christentum
- 2.2. Die Rolle des Einzelnen im Verhältnis zum Kollektiven der Schlacht
- Exkurs: Genelun - der Feind in den eigenen Reihen
- 2.3. Die Ausdrucksformen (Inszenierungen) der Gewalt
- 2.4. Der Krieg als Folie oder als eigenes Thema: zur These von Joachim Bumke
- 2.1. Warum kämpfen sie überhaupt?
- 3. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert die unterschiedlichen Darstellungen von Schlachten im Rolandslied Konrads und im Willehalm Wolframs von Eschenbach. Die Arbeit vergleicht die Darstellungsmodi der Schlachten und untersucht deren Bedeutung für die jeweilige Textaussage, ausgehend von der Annahme divergierender Wirkungsabsichten beider Autoren. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Kompositionsweisen und der Darstellung von Gewalt.
- Vergleich der Schlachtdarstellungen im Rolandslied und im Willehalm
- Analyse der unterschiedlichen Wirkungsabsichten der Autoren
- Untersuchung der Komposition und des Aufbaus der Schlachten
- Bedeutung der Darstellung von Gewalt für die Textaussage
- Intertextuelle Beziehungen zwischen beiden Epen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die beiden zu vergleichenden Texte, das Rolandslied und den Willehalm, vor. Sie betont die Bedeutung von Kriegs- und Schlachtdarstellungen in der Literatur und den Einfluss französischer Heldendichtungen auf die deutsche Literatur des Mittelalters. Die Einleitung hebt die Unterschiede in der Komposition und Beschreibung der Kämpfe in beiden Epen hervor und kündigt die vergleichende Analyse an, die im Hauptteil erfolgen wird. Die enge kulturelle und stoffliche Nähe beider Texte wird als Grundlage für den Vergleich hervorgehoben, insbesondere die Bezugnahme Wolframs auf Konrads Werk. Der Willehalm wird als Fortsetzung des Rolandslieds präsentiert, mit intertextuellen Anspielungen und einer Verwendung des Rolandslieds als quasi-historische Quelle.
2. Hauptteil: Der Hauptteil bildet das Herzstück der Arbeit und gliedert sich in mehrere Unterkapitel, die sich jeweils mit spezifischen Aspekten der Schlachtdarstellungen in beiden Epen befassen. Die Analyse beleuchtet die Motive der Kämpfer, die Rolle des Einzelnen im Kollektiv, die Inszenierung von Gewalt und die Bedeutung des Krieges als Thema. Der Hauptteil vergleicht die jeweilige Darstellung der Kämpfe und analysiert deren Funktion innerhalb der Gesamtkomposition der Texte. Die unterschiedlichen Erzählweisen und die unterschiedlichen Schwerpunkte, die jeweils gesetzt werden, werden im Detail untersucht. Es wird gezeigt, dass der einfache Aufbau des Rolandslieds, mit seinen Einzelkämpfen, die dualistische Struktur des Textes verstärkt, während Wolfram einen komplexeren Aufbau nutzt, um Differenzen und die Problematik der Gewalt darzustellen.
Schlüsselwörter
Rolandslied, Willehalm, Wolfram von Eschenbach, Pfaffe Konrad, Kreuzzugsepik, Schlachtdarstellung, Gewaltinszenierung, Intertextualität, Kriegslegitimation, Einzelkämpfer, Kollektiv, Heiden, Christen.
Häufig gestellte Fragen zum Vergleich von Rolandslied und Willehalm
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Diese Magisterarbeit vergleicht die Darstellung von Schlachten im Rolandslied Konrads und im Willehalm Wolframs von Eschenbach. Der Fokus liegt auf der Analyse der Darstellungsmodi, der Bedeutung für die jeweilige Textaussage und den unterschiedlichen Wirkungsabsichten der Autoren. Besonderes Augenmerk wird auf den Vergleich der Kompositionsweisen und der Darstellung von Gewalt gelegt.
Welche Aspekte der Schlachtdarstellungen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Motive der Kämpfer (Warum kämpfen sie?), die Rolle des Einzelnen im Kollektiv, die Inszenierung von Gewalt und die Bedeutung des Krieges als zentrales Thema oder als bloße Folie. Der einfache Aufbau des Rolandslieds mit seinen Einzelkämpfen wird dem komplexeren Aufbau des Willehalms gegenübergestellt, um die unterschiedlichen Darstellungsweisen und ihre Funktion innerhalb der Gesamtkomposition zu beleuchten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Hauptteil und Schlussteil. Der Hauptteil analysiert die Schlachtdarstellungen in mehreren Unterkapiteln, die sich mit spezifischen Aspekten befassen. Die Einleitung stellt die beiden Texte vor, betont die Bedeutung von Kriegs- und Schlachtdarstellungen in der Literatur und kündigt die vergleichende Analyse an. Der Schlussteil fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt die Intertextualität?
Die Arbeit untersucht die intertextuellen Beziehungen zwischen Rolandslied und Willehalm. Wolfram von Eschenbachs Willehalm wird als Fortsetzung des Rolandslieds betrachtet, mit intertextuellen Anspielungen und der Nutzung des Rolandslieds als quasi-historische Quelle. Die enge kulturelle und stoffliche Nähe beider Texte bildet die Grundlage des Vergleichs.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rolandslied, Willehalm, Wolfram von Eschenbach, Pfaffe Konrad, Kreuzzugsepik, Schlachtdarstellung, Gewaltinszenierung, Intertextualität, Kriegslegitimation, Einzelkämpfer, Kollektiv, Heiden, Christen.
Welche konkreten Fragen werden im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil befasst sich mit folgenden Fragen: Warum kämpfen die Figuren? Welche Rolle spielt der Einzelne im Kollektiv der Schlacht? Wie wird Gewalt inszeniert? Ist der Krieg das Hauptthema oder nur eine Folie für andere Aspekte der Erzählung (Bumkes These)?
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit zeigt, dass der einfache Aufbau des Rolandslieds mit seinen Einzelkämpfen die dualistische Struktur des Textes verstärkt. Im Gegensatz dazu nutzt Wolfram einen komplexeren Aufbau, um Differenzen und die Problematik der Gewalt darzustellen. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Erzählweisen und Schwerpunkte beider Autoren und deren Auswirkungen auf die Gesamtkomposition und Wirkungsabsicht.
- Citar trabajo
- Björn Menrath (Autor), 2010, Die Schlachten zwischen Heiden und Christen in Konrads 'Rolandslied' und Wolframs 'Willehalm', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164376