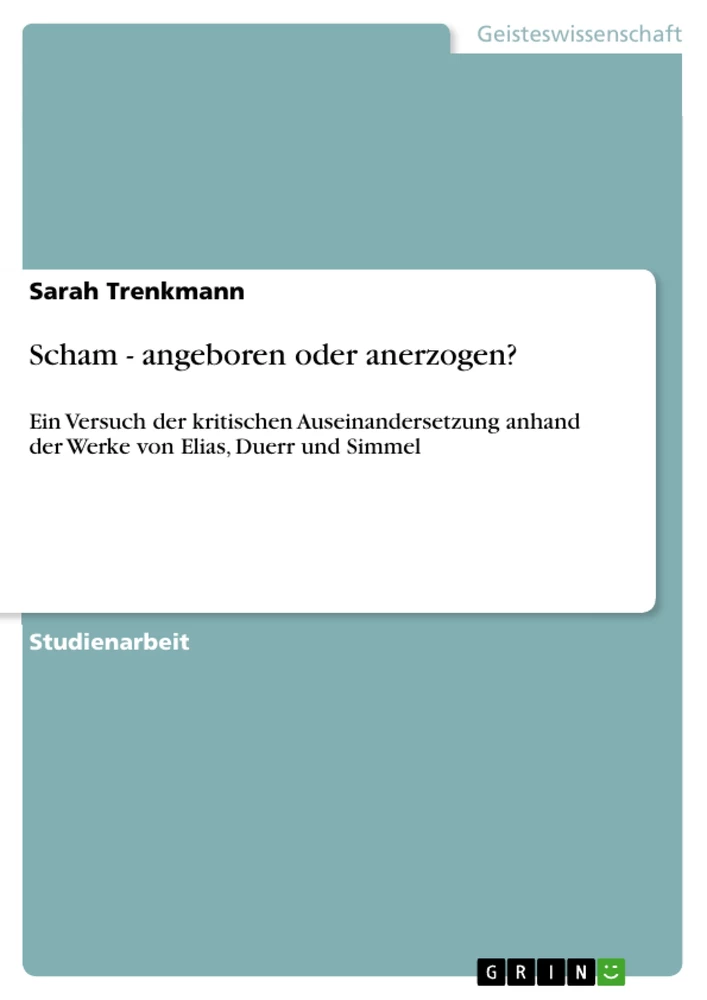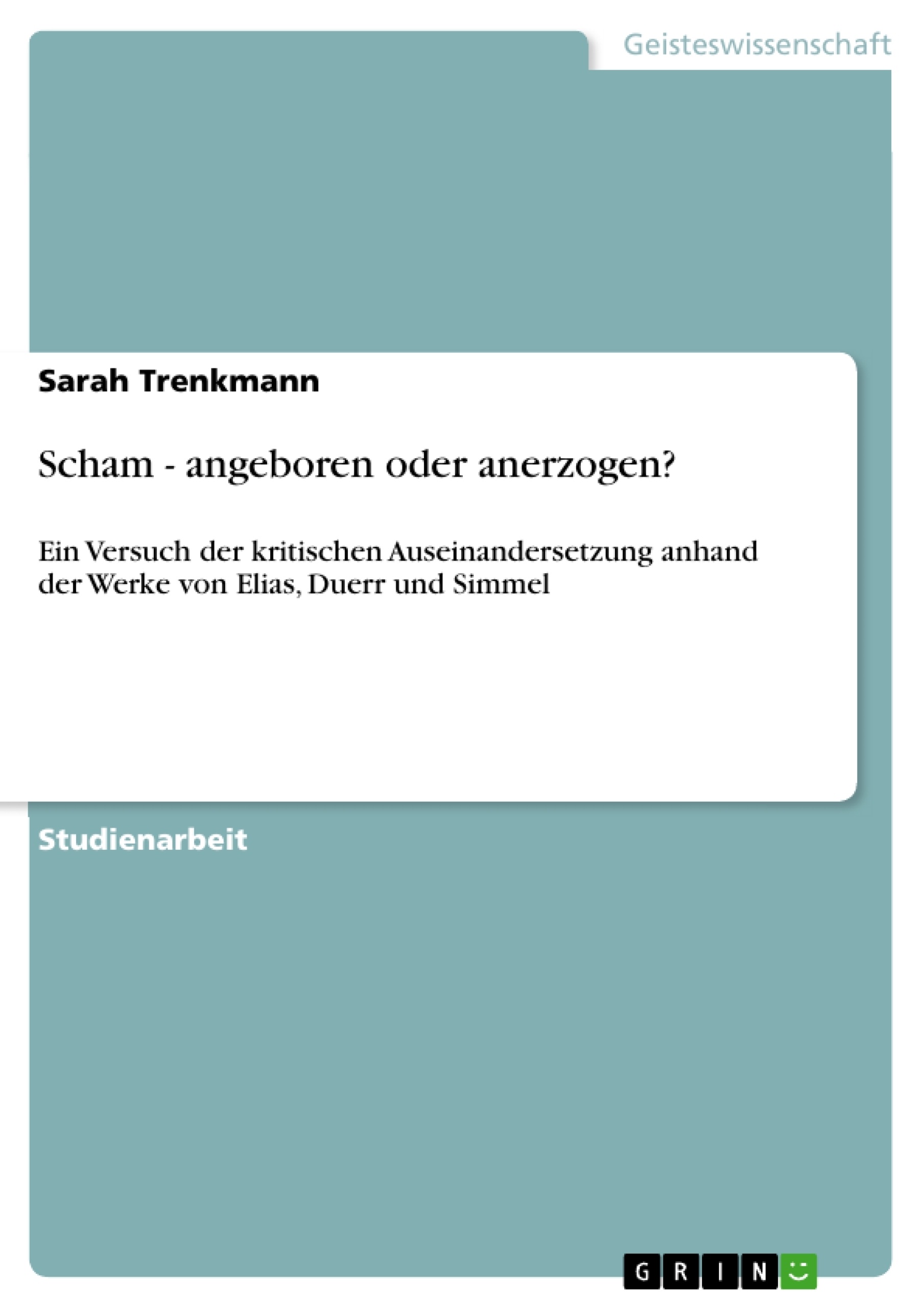Scham- damit assoziiere ich ein durchweg unangenehmes Gefühl, aufsteigende Wärme in meinem Körper und ein knallrotes Gesicht. Das sind gute Gründe, um Situationen, die Scham auslösen könnten, stets von vornherein aus dem Weg zu gehen. Und da würden mir unendliche viele Möglichkeiten einfallen, „Scham ist allgegenwärtig“ (Kalbe 2002: 19). Und genau diese Mannigfaltigkeit dieser Emotion hat gerade in den letzen Jahren viele Autoren dazu bewegt, sich der Thematik intensiver zu widmen. Die Tendenz ist deswegen so auffällig, da die Scham als wissenschaftlicher Gegenstand viele Jahrzehnte lang so gut wie unbeachtet blieb. Ich bin im Rahmen des Seminars „Das Phänomen der Höflichkeit. Funktion und Soziogenese“, für welches diese Arbeit geschrieben wurde, auf die Besonderheiten des Schamgefühls aufmerksam geworden. Aufgrund der Begebenheiten konnte dieser Sachverhalt leider nur oberflächlich bearbeitet werden. Die für mich interessanteste Frage blieb dabei leider offen. Woher kommt Scham? Was ist ihre Ursache? Im Seminar wurden zwei Thesen kurz angesprochen und diskutiert. Zum einen ist da die Position Scham wäre angeboren. Andere behaupten, dass sie ein Resultat der Erziehung darstellt. Ist dieses Gefühl tief in uns Menschen verankert, sprich Bestandteil unserer Gene oder unvermeidbare Folge der Entwicklung des Höflichkeitsempfindens? Eine eindeutige und wissenschaftlich gültige Antwort auf diese Fragestellungen ist mir nicht bekannt. Im Kontext der Literaturrecherche zu dieser Arbeit bin ich auf ein aussagekräftiges Zitat gestoßen. Der Ausspruch „Je mehr ein Mensch sich schämt, desto anständiger ist er.“ von George Bernard Shaw aus seiner Komödie „Man and Superman“ von 1903 hat mich verstärkt zur Untersuchung dieser Problematik angeregt. Ist es wahr, dass sich ein Mensch umso öfter und intensiver schämt, je besser er erzogen ist? Das gilt meine Arbeit zu klären. Festzuhalten ist jedenfalls, dass sich kein anderes Wesen außer dem Menschen schämt. „Scham ist ein zentrales Merkmal, durch das sich der Mensch auszeichnet und das ihn von anderen Lebewesen unterscheidet.“ (Lietzmann 2003: 7)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine soziologische Begriffsbestimmung der Scham
- Abgrenzung des Begriffs
- Körperliche Reaktionen der Scham
- Eine erzieherische Perspektive: Norbert Elias Zivilisationstheorie
- Der Prozess der Zivilisation
- Scham im Zivilisationsprozess
- Resümee
- Genetische Perspektiven
- Hans Peter Duerrs Mythos vom Zivilisationsprozess
- Georg Simmels Psychologie der Scham
- Anlässe von Schamgefühlen
- Bedingungen der Entstehung von Scham
- Resümee
- Aktueller Forschungsstand der Humangenetik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob das Gefühl der Scham angeboren oder anerzogen ist. Sie analysiert die Thesen von Norbert Elias, Hans Peter Duerr und Georg Simmel im Hinblick auf die soziologische und genetische Entstehung von Scham. Ziel ist es, die verschiedenen Perspektiven auf die Scham und deren Einfluss auf das menschliche Verhalten und das Zusammenleben zu beleuchten.
- Soziologische Definition von Scham und Abgrenzung von verwandten Begriffen
- Zivilisationstheorie von Norbert Elias und die Rolle von Scham in der Sozialisation
- Genetische Perspektive auf Scham nach Hans Peter Duerr und Georg Simmel
- Aktueller Forschungsstand der Humangenetik zur Entstehung von Scham
- Bedeutung von Scham als Schutzmechanismus und Sozialisationsfaktor
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Scham ein und stellt die Forschungsfrage nach ihrer Entstehung. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der soziologischen Definition von Scham, grenzt den Begriff von verwandten Begriffen ab und beschreibt die körperlichen Reaktionen auf Schamgefühle. Kapitel 3 präsentiert die Zivilisationstheorie von Norbert Elias und die Rolle von Scham im Zivilisationsprozess. Kapitel 4 analysiert die genetische Perspektive auf Scham, insbesondere die Thesen von Hans Peter Duerr und Georg Simmel, sowie den aktuellen Forschungsstand der Humangenetik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Konzepte von Scham, Zivilisationstheorie, Sozialisation, Genetik, Humangenetik, Höflichkeit, Normbruch, Angst, Selbstbild, Identität, Sozialisation, und Identität.
- Citation du texte
- Sarah Trenkmann (Auteur), 2010, Scham - angeboren oder anerzogen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164462