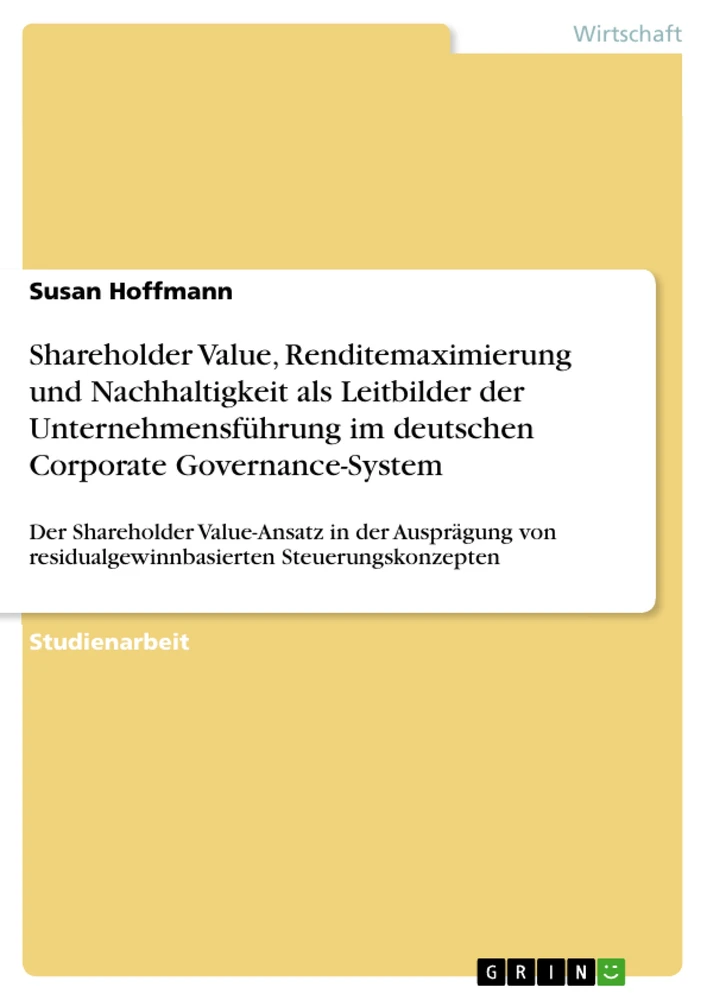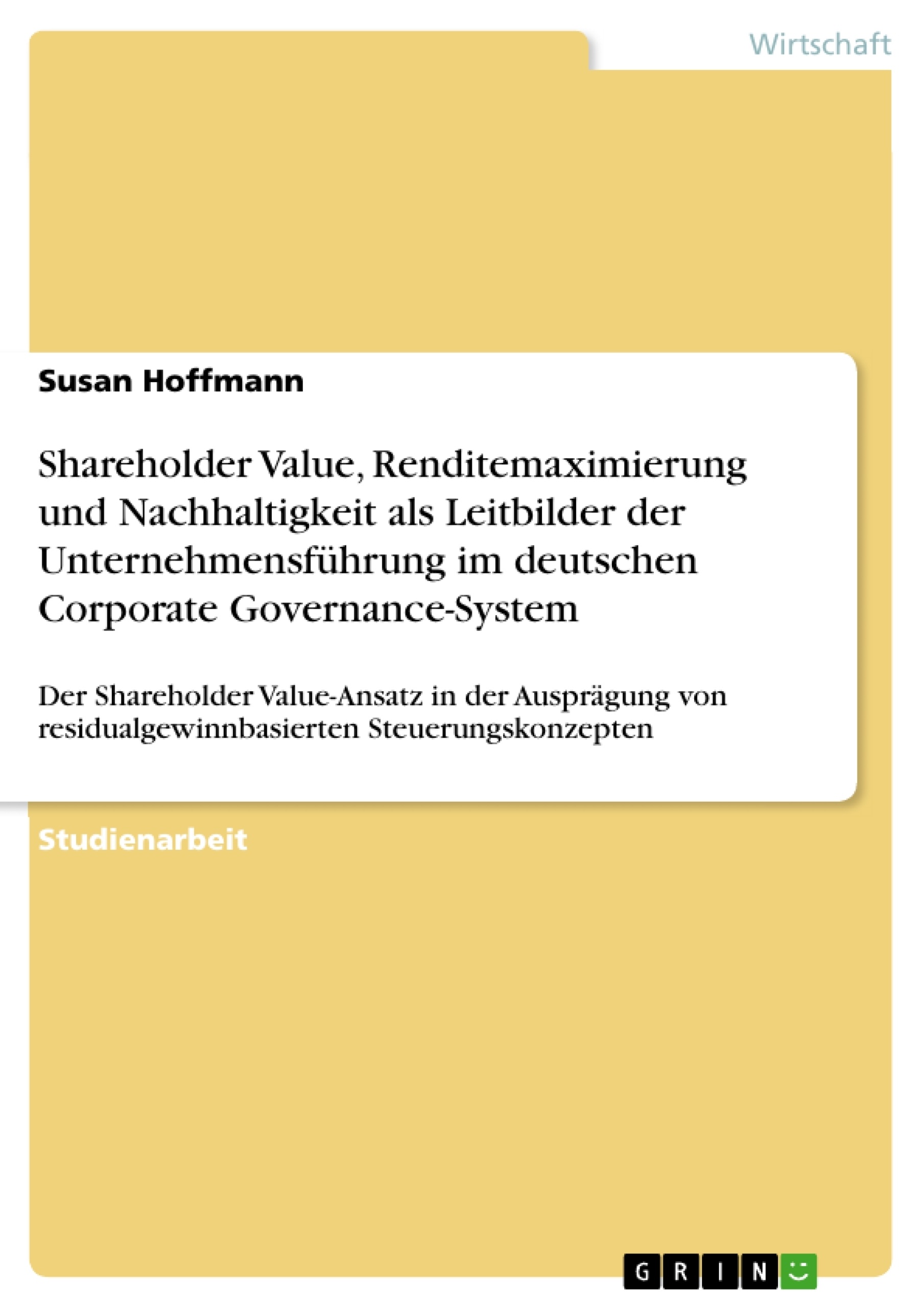Die Veröffentlichungen Alfred Rappaports über den Shareholder-Value-Ansatz (SV-Ansatz) vor über 20 Jahren waren Auslöser für zahlreiche kontroverse Dis-kussionen. Unter dem Konzept versteht man die Ausrichtung der Unterneh-mensführung auf die Interessen der Anteilseigner - der Shareholder.
Im Rahmen der Globalisierung herrscht auf den Kapitalmärkten verstärkt Konkur-renz. Immer mehr deutsche Unternehmen folgen dem angloamerikanischen Vorbild und gehen zu vermehrter Eigenkapitalfinanzierung (EK-Finanzierung) über. Dadurch geraten potentielle Investoren zunehmend in das Blickfeld unternehmeri-schen Interesses. Der Wunsch der vielumworbenen Anteilseigner nach einer marktgerechten Verzinsung - den es zu erfüllen gilt - bringt die Bedeutsamkeit des SV-Ansatzes zum Ausdruck: Unternehmen wollen attraktiv sein. Auch die Sorge um feindliche Übernahmen hat dazu beigetragen, dass das Konzept der Wertorien-tierung inzwischen zu einer weitgehend akzeptierten Zielmaxime geworden ist.
Das Institut der Wirtschaftsprüfer empfiehlt die Berechnung des Unternehmens-wertes nach dem Ertragswert- oder den Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF-Verfahren). Für die praktische Unternehmensführung werden residualgewinnba-sierte Konzepte jedoch immer bedeutsamer, da sie einen Rückgriff auf bereits vor-liegende buchhalterische Daten ermöglichen.
Angesichts dessen sowie aufgrund der Kritik am SV stellt sich die Frage, welche Relevanz Wertorientierung in der Praxis deutscher Unternehmen hat und welche Implementierungsfortschritte vorgewiesen werden können.
Inhaltsverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Problemstellung
2 Entstehung und Fundament des Shareholder Values
2.1 Grundlagen des Shareholder-Value-Ansatzes
2.2 Der Shareholder Value im Vergleich zu traditionellen Kennzahlen
2.3 Die Bestimmung des Shareholder Value auf Basis von Cash Flows und Residualgewinnen
3 Ausgewählte residualgewinnbasierte Steuerungskonzepte
3.1 Der Economic Value Added nach Stern/Stewart
3.2. Der Economic Profit nach Copeland/Koller/Murrin
3.3 Der Cash Value Added nach Lewis
3.4 Kritische Würdigung der vorgestellten Steuerungskonzepte
4 Relevanz des Shareholder-Value-Ansatzes für deutsche Unternehmen
4.1 Der Shareholder-Value-Ansatz als theoretisches Managementkonzept
4.2 Der Shareholder-Value-Ansatz in der Praxis deutscher Unternehmen
5 Thesenförmige Zusammenfassung und Ausblick
Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsanweisungen
Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Entstehung und Fundament des Shareholder Values
- 2.1 Grundlagen des Shareholder-Value-Ansatzes
- 2.2 Der Shareholder Value im Vergleich zu traditionellen Kennzahlen
- 2.3 Die Bestimmung des Shareholder Value auf Basis von Cash Flows und Residualgewinnen
- 3. Ausgewählte residualgewinnbasierte Steuerungskonzepte
- 3.1 Der Economic Value Added nach Stern/Stewart
- 3.2 Der Economic Profit nach Copeland/Koller/Murrin
- 3.3 Der Cash Value Added nach Lewis
- 3.4 Kritische Würdigung der vorgestellten Steuerungskonzepte
- 4 Relevanz des Shareholder-Value-Ansatzes für deutsche Unternehmen
- 4.1 Der Shareholder-Value-Ansatz als theoretisches Managementkonzept
- 4.2 Der Shareholder-Value-Ansatz in der Praxis deutscher Unternehmen
- 5 Thesenförmige Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit befasst sich mit dem Shareholder-Value-Ansatz und seiner Anwendung in der Praxis. Ziel ist es, die Entstehung und die Grundlagen des Ansatzes zu erläutern, sowie ausgewählte residualgewinnbasierte Steuerungskonzepte zu analysieren. Dabei soll insbesondere die Relevanz des Shareholder-Value-Ansatzes für deutsche Unternehmen beleuchtet werden.
- Entstehung und Grundlagen des Shareholder-Value-Ansatzes
- Residualgewinnbasierte Steuerungskonzepte
- Kritik und Bewertung der Steuerungskonzepte
- Relevanz des Shareholder-Value-Ansatzes für deutsche Unternehmen
- Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Studienarbeit widmet sich der Problemstellung und führt in die Thematik des Shareholder-Value-Ansatzes ein. Kapitel zwei beleuchtet die Entstehung und die Grundlagen des Shareholder-Value-Ansatzes, sowie dessen Vergleich zu traditionellen Kennzahlen. Die Bestimmung des Shareholder Value auf Basis von Cash Flows und Residualgewinnen wird ebenfalls erläutert. Kapitel drei beschäftigt sich mit ausgewählten residualgewinnbasierten Steuerungskonzepten, wie dem Economic Value Added, dem Economic Profit und dem Cash Value Added. Eine kritische Würdigung der vorgestellten Konzepte rundet das Kapitel ab. Im vierten Kapitel wird die Relevanz des Shareholder-Value-Ansatzes für deutsche Unternehmen untersucht. Dabei werden sowohl theoretische Aspekte als auch praktische Anwendungen in der Praxis betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Studienarbeit fokussiert auf die Themen Shareholder Value, Residualgewinnbasierte Steuerungskonzepte, Economic Value Added, Economic Profit, Cash Value Added, Managementkonzepte und deren Relevanz für deutsche Unternehmen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Shareholder-Value-Ansatz?
Der Shareholder-Value-Ansatz (SV-Ansatz) richtet die Unternehmensführung primär an den Interessen der Anteilseigner (Shareholder) aus, mit dem Ziel, den Unternehmenswert langfristig zu steigern.
Warum gewinnt der SV-Ansatz in Deutschland an Bedeutung?
Durch die Globalisierung und den Wettbewerb auf den Kapitalmärkten nutzen deutsche Unternehmen verstärkt Eigenkapitalfinanzierung. Um für Investoren attraktiv zu bleiben und feindliche Übernahmen zu verhindern, wird die Wertorientierung wichtiger.
Welche Methoden zur Bestimmung des Unternehmenswertes werden empfohlen?
Das Institut der Wirtschaftsprüfer empfiehlt das Ertragswertverfahren oder das Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF). In der Praxis gewinnen zudem residualgewinnbasierte Konzepte an Bedeutung.
Was ist der Economic Value Added (EVA) nach Stern/Stewart?
EVA ist ein residualgewinnbasiertes Steuerungskonzept, das misst, ob ein Unternehmen über seine Kapitalkosten hinaus einen Wert für die Aktionäre geschaffen hat.
Welche weiteren Steuerungskonzepte werden in der Arbeit analysiert?
Neben dem EVA werden der Economic Profit nach Copeland/Koller/Murrin sowie der Cash Value Added (CVA) nach Lewis untersucht und kritisch gewürdigt.
Wie steht es um die Umsetzung des SV-Ansatzes in deutschen Unternehmen?
Die Arbeit untersucht die Relevanz des Ansatzes in der Praxis und beleuchtet die Fortschritte sowie die Kritik bei der Implementierung dieser wertorientierten Führungskonzepte.
- Citation du texte
- Susan Hoffmann (Auteur), 2009, Shareholder Value, Renditemaximierung und Nachhaltigkeit als Leitbilder der Unternehmensführung im deutschen Corporate Governance-System , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164561