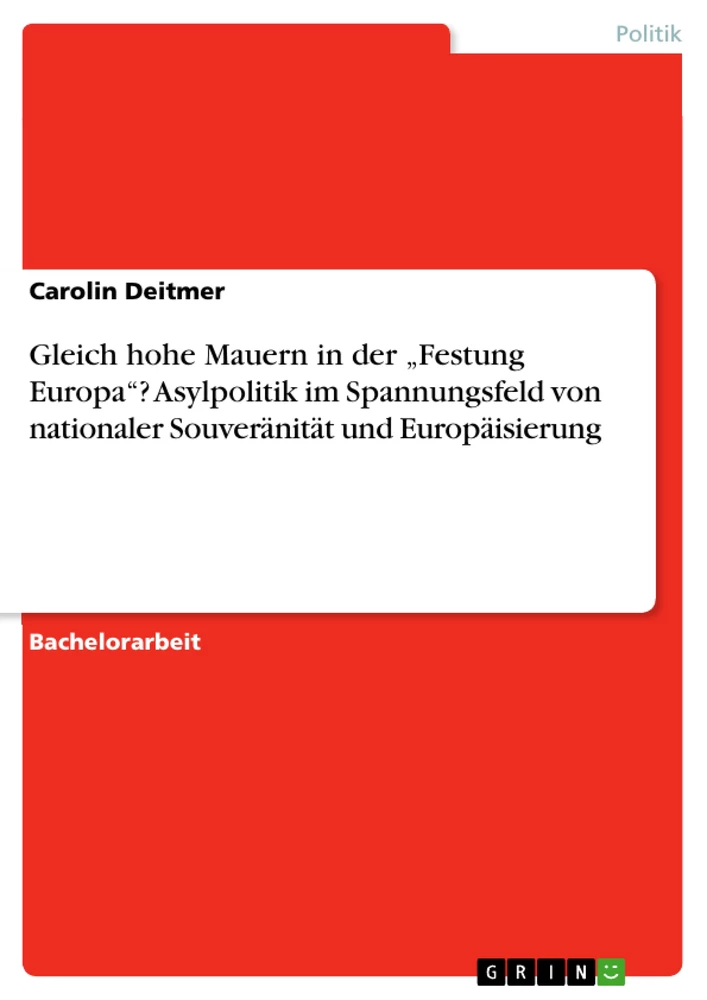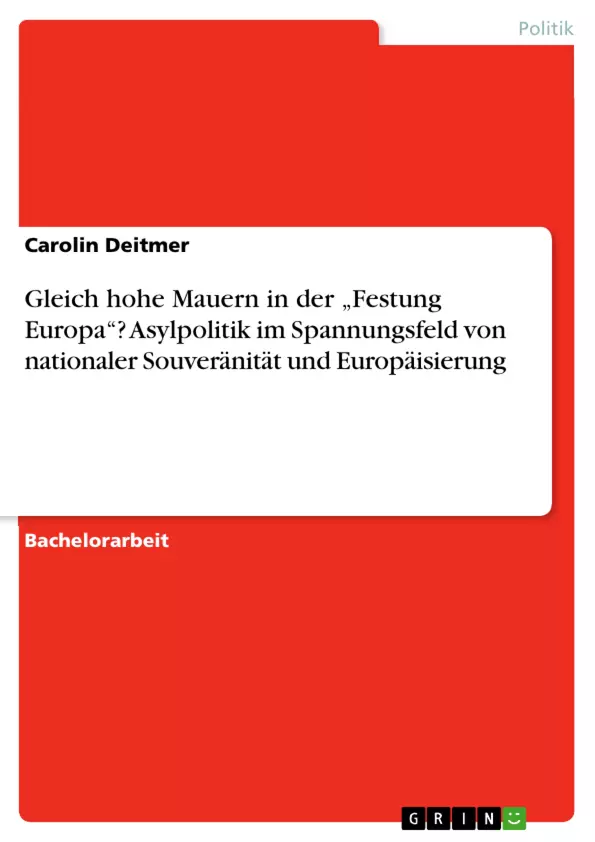Mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften in den 1950er Jahren wurde der Grundstein zu einer (vorerst) wirtschaftlichen Kooperation unter den kontinentaleuropäischen Staaten gelegt. Diese Kooperation weitete sich in den folgenden Jahrzehnten auf diverse Politikfelder aus, so auch auf das Feld Asyl. Bis 1997 wurde hier intergouvernemental kooperiert, das heißt unter der Führung einiger europäischer Regierungen.
Seit dem Vertrag von Amsterdam 1997 ist Asylpolitik Teil des Gemeinschaftsrechts. Die Asylpolitik avancierte also zu einem Element des Primärrechts der EU, dies weisen Artikel 63 bis 69 unter Titel IV und der Überschrift „Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken betreffend den freien Personenverkehr“ des Vertrages eindeutig aus. In zahlreichen Konferenzen legte die Europäische Union in der Folgezeit das Ziel fest, bis ins Jahr 2010 ein „gemeinsames Asylsystem“ zu errichten. Doch dieser neue Politikbereich der Europäischen Union stößt eindeutig an Grenzen: Asyl war lange Zeit unumstrittener Kernbereich nationaler Souveränität. Jedes Land sollte selber entscheiden können, wer und aus welchen Gründen Zutritt erhält – und wer aus welchen Gründen nicht.
Seit der Ausformulierung des Ziels eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und der Ergreifung einschlägiger sekundärrechtlicher Maßnahmen durch die EU herrschen Diskussionen vor, inwieweit dieses Politikfeld europäisiert ist bzw. bereits wurde.
Die Arbeit geht also der Frage nach, ob Asylsuchende in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union gleiche Aufnahmechancen finden, da es sich ja um einen Asylraum handeln sollte. Sind die Mauern, die die Staaten schützend umgeben, in jedem Land der Europäischen Union gleich hoch? Ist das Politikfeld Asyl wirklich schon Feld der Europäischen Union oder noch Handlungsfeld der Nationalstaaten? Wie weit geht die oft zitierte „Europäisierung“ wirklich?
Um diese Fragen auf einen Nenner zu bringen: Inwiefern ist Asylpolitik nun wirklich europäisiert?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DAS THEMA DER ARBEIT UND DIE FRAGESTELLUNG
- DIE VORHANDENE LITERATUR UND DER AKTUELLE FORSCHUNGSSTAND
- AUFBAU DER ARBEIT UND VORGEHENSWEISE BEI DER ANALYSE
- DEFINITION DER WICHTIGSTEN BEGRIFFE
- ASYL UND ASYLPOLITIK
- Nationale Souveränität
- Europäisierung
- VERGEMEINSCHAFTUNG
- GRÜNDE FÜR EINE KOOPERATION IN DER ASYLPOLITIK
- Asylpolitische Ausgangssituation: Offene Binnengrenzen und hoher Zuwanderungsdruck
- Europäische Zusammenarbeit als Folge des hohen Zuwanderungsdrucks?
- Sonstige Motive zur Erklärung der Kooperation
- ANALYSE DES GRADES DER EUROPÄISIERUNG DER ASYLPOLITIK
- Darlegung der verschiedenen Etappen und Maßnahmen
- Grundlegende Fakten zur Genese einer gemeinsamen Asylpolitik
- Die TREVI-Gruppe als Keimzelle intergouvernementaler Zusammenarbeit
- Intergouvernementale Fortschritte: Die Schengener Abkommen und Dublin-1
- Erste vertragsrechtliche Grundlage für eine zwischenstaatliche Kooperation: Der Vertrag von Maastricht
- Von der „dritten in die erste Säule“: Der Vertrag von Amsterdam
- Tampere 1999-2004 als erste Phase und Haag 2005-2010 als zweite Phase der Errichtung eines „Gemeinsamen Europäischen Asylsystems“
- Das Grünbuch der Kommission über das künftige Gemeinsame Asylsystem 2007 und die neue Asylstrategie 2008
- Das Stockholmer Programm 2009-2014 als dritte Phase der Errichtung eines „Gemeinsamen Europäischen Asylsystems“ und die Unterstützungsbüros
- Die wichtigsten sekundärrechtlichen Maßnahmen zur Europäisierung der Asylpolitik:
- Grundlage für die weitere Untersuchung I: Die Dublin-II-Verordnung
- Grundlage für die weitere Untersuchung II: Die Asylverfahrensrichtlinie
- Grundlage für die weitere Untersuchung III: Die Aufnahmerichtlinie
- Grundlage für die weitere Untersuchung IV: Die Qualifikationsrichtlinie
- die Etappen und MAßNAHMEN in der Bewertung
- Die Etappen als Hinweis auf eine starke Europäisierung?
- Die sekundärrechtlichen Maßnahmen als Hinweis auf eine starke Europäisierung?
- Richtlinien enthalten nur Mindeststandards
- (Zu) Großer Umsetzungsspielraum
- Inkohärentes Gesamtsystem an Richtlinien
- Vereinheitlichung - aber trotzdem kein starker Eingriff in nationales Asylrecht
- Praxistest: Führen die Maßnahmen zu einer starken Europäisierung?
- Die Dublin-II-VO: Weder gerechte Lastenteilung noch Gerechtigkeit für Asylbewerber
- Die Asylverfahrensrichtlinie: Die Fiktion gleicher Standards
- Die Aufnahmerichtlinie: Ähnliche Probleme wie bei der Asylverfahrensrichtlinie
- Die Qualifikationsrichtlinie: Mangelhafte Umsetzung
- FRONTEX als Hort nationaler Souveränität?
- Die Neufassungen der wichtigsten sekundärrechtlichen Instrumente im Zuge der Asylstrategie
- die Nationalstaaten als Hindernis einer starken Europäisierung
- Die Kompetenzverschiebung ALS ZEICHEN einer STARKEN EUROPÄISIERUNG?
- Die Kompetenzverschiebung als Zeichen einer zunehmenden Europäisierung
- Die Kompetenzverschiebung als Hindernis einer starken Europäisierung
- Der Vertrag von Lissabon in der Diskussion
- Der Vertrag von Lissabon als Wegbereiter einer stärkeren Europäisierung
- Der Vertrag von Lissabon als Hindernis einer stärkeren Europäisierung
- Die Sonderrollen einiger Mitgliedstaaten als Hindernis einer starken Europäisierung?
- Die Entwicklung der Europäischen Asylpolitik und ihre wichtigsten Etappen
- Der Grad der Europäisierung der Asylpolitik
- Die Rolle nationaler Souveränität im Kontext der Asylpolitik
- Die Herausforderungen und Chancen der Europäisierung der Asylpolitik
- Die Auswirkungen der Asylpolitik auf das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit die Asylpolitik in der Europäischen Union durch den Prozess der Europäisierung zu einem stärker integrierten Politikfeld geworden ist. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Asylpolitik im Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und Europäisierung, wobei sie insbesondere die Auswirkungen der verschiedenen Etappen und Maßnahmen der EU-Asylpolitik auf die nationale Souveränität der Mitgliedstaaten untersucht.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die Fragestellung vor. Sie erläutert den aktuellen Forschungsstand und den Aufbau der Arbeit. Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Begriffe wie Asyl, Asylpolitik, nationale Souveränität und Europäisierung definiert. Das dritte Kapitel untersucht die Gründe für eine Kooperation in der Asylpolitik. Das vierte Kapitel analysiert den Grad der Europäisierung der Asylpolitik, indem es die verschiedenen Etappen und Maßnahmen der EU-Asylpolitik sowie deren Auswirkungen auf die nationale Souveränität der Mitgliedstaaten beleuchtet. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet ein Fazit zum Thema der Asylpolitik als schwach europäisiertes Politikfeld.
Schlüsselwörter
Asylpolitik, Europäisierung, nationale Souveränität, Gemeinsames Europäisches Asylsystem, Dublin-Verordnung, Asylverfahrensrichtlinie, Aufnahmerichtlinie, Qualifikationsrichtlinie, FRONTEX, Kompetenzverschiebung, Vertrag von Lissabon
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Arbeit zur Asylpolitik?
Die Arbeit untersucht die Asylpolitik der EU im Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und Europäisierung und geht der Frage nach, inwieweit ein gemeinsames Asylsystem tatsächlich existiert.
Ab wann wurde die Asylpolitik Teil des EU-Gemeinschaftsrechts?
Mit dem Vertrag von Amsterdam im Jahr 1997 wurde die Asylpolitik Teil des Gemeinschaftsrechts und damit ein Element des Primärrechts der Europäischen Union.
Was versteht man unter der „Europäisierung“ der Asylpolitik?
Unter Europäisierung versteht man den Prozess, in dem nationale Kompetenzen im Bereich Asyl auf die europäische Ebene übertragen werden, um ein einheitliches System zu schaffen.
Welche Rolle spielt die nationale Souveränität in diesem Kontext?
Asyl war lange Zeit ein Kernbereich nationaler Souveränität, in dem Staaten selbst entschieden, wer Zutritt erhält. Dies stellt heute oft ein Hindernis für eine vollständige Europäisierung dar.
Was ist die Dublin-II-Verordnung?
Die Dublin-II-Verordnung ist eine der wichtigsten sekundärrechtlichen Maßnahmen zur Regelung der Zuständigkeit für Asylverfahren innerhalb der EU-Mitgliedstaaten.
Sind die Mauern der „Festung Europa“ in jedem Land gleich hoch?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob Asylsuchende in allen Mitgliedstaaten die gleichen Aufnahmechancen finden oder ob nationale Unterschiede trotz EU-Vorgaben fortbestehen.
- Quote paper
- Carolin Deitmer (Author), 2010, Gleich hohe Mauern in der „Festung Europa“? Asylpolitik im Spannungsfeld von nationaler Souveränität und Europäisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164732