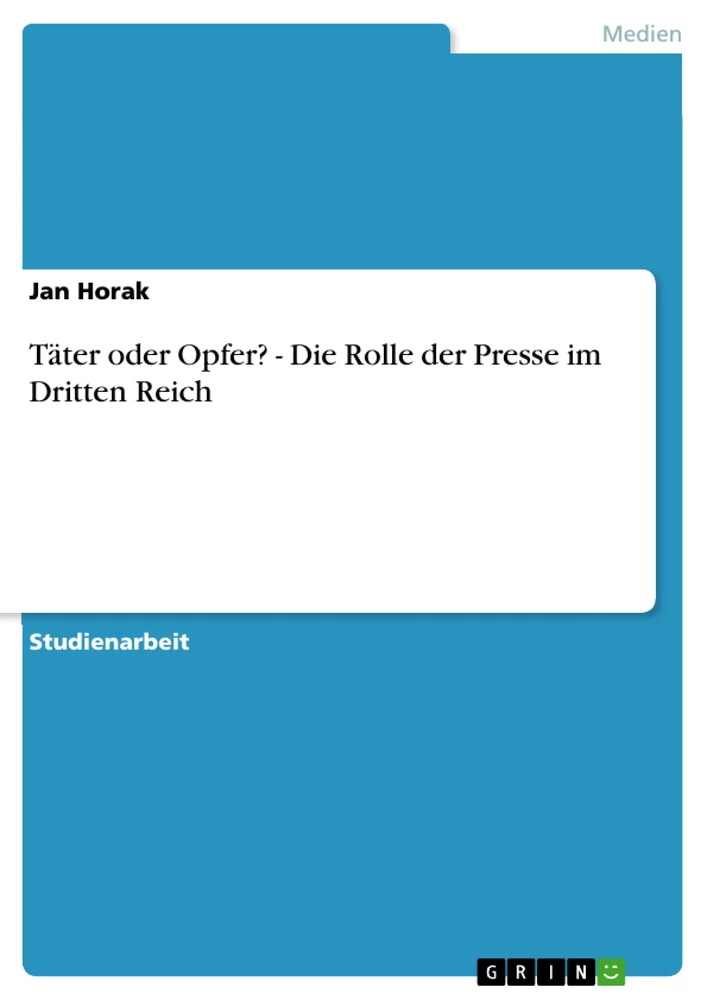Thomas Mann stellte sich diese Fragen im Sommer 1945 vor dem Hintergrund der Nürnberger Gerichtsverfahren, in denen den überlebenden Vertretern der nationalsozialistischen Führungsriege der Prozess gemacht wurde. Doch der bekannte Exilant und Gegner des NS-Regimes war nicht der einzige. In den Folgejahren und bis in die Gegenwart wurde die „Schuldfrage“ in Bezug auf die Presse immer wieder gestellt und von zahlreichen Historikern und Publizistikwissenschaftlern untersucht. Diese Arbeit erhebt infolge dessen und aufgrund des eng bemessenen Rahmens nicht den Anspruch, neue Forschungsergebnisse zu liefern. Vielmehr sollen ein Überblick über die Pressepolitik der Nationalsozialisten und Einblicke in die veränderten Arbeitsbedingungen der Redakteure geboten werden. Da es sich um einen sehr komplexen und aufgrund der zahlreichen betroffenen persönlichen Schicksale in starkem Maße emotionsgeladenen Teil deutscher Geschichte handelt, ist eine wertfreie, ausschließlich an historischen Tatsachen orientierte Darstellungsweise jedoch nur bedingt geeignet. Denn die Antwort auf die Frage, ob die deutsche Presse im Dritten Reich eher in der Täter- oder in der Opferrolle zu sehen ist, lässt sich kaum durch die undifferenzierte Einzelbetrachtung historischer Ereignisse ermitteln. Die folgenden Ausführungen sollen den Leser vielmehr in die Lage versetzen, sich sowohl auf Basis der gelieferten Fakten als auch unter Berücksichtigung der aus den skizzierten Entwicklungen resultierenden Konsequenzen für die involvierten „Zeitungsmacher“ – für die Menschen hinter der „Institution Presse“ – selbst ein Urteil zu bilden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die deutsche Presse zum Zeitpunkt der Machtübernahme
- Nationalsozialistische Presselenkung
- Rechtlich-Institutionelle Kontrolle
- Ökonomische Kontrolle
- Inhaltliche Kontrolle
- Widerstand unmöglich?
- Die „Reichspressekonferenz“ als Lenkungsorgan
- Sanktionsdrohungen und redaktionelle Realität
- Der Widerstand zwischen den Zeilen
- Rudolf Pechel: Ein Journalist gegen das System?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Presse im Dritten Reich und untersucht die Frage, ob die deutsche Presse eher als Täter oder Opfer des NS-Regimes zu betrachten ist. Sie bietet einen Überblick über die Pressepolitik der Nationalsozialisten und beleuchtet die veränderten Arbeitsbedingungen der Redakteure in dieser Zeit.
- Die Kontrolle der Presse durch das NS-Regime
- Die Auswirkungen der nationalsozialistischen Presselenkung auf die redaktionelle Arbeit
- Die Möglichkeiten und Grenzen des Widerstands in der NS-Presse
- Die Rolle der „Reichspressekonferenz“ als Lenkungsorgan
- Die Bedeutung der „Tradition der Einflussnahme“ des Staates auf die Presse
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort
Das Vorwort beleuchtet die Kontroverse um die „Schuldfrage“ der Presse im Dritten Reich und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Es betont die Komplexität des Themas und die Schwierigkeit einer wertfreien Darstellung.
Die deutsche Presse zum Zeitpunkt der Machtübernahme
Dieses Kapitel beschreibt die Situation der deutschen Presse während der Weimarer Republik und analysiert die Voraussetzungen für die nationalsozialistische Presselenkung. Es zeigt, wie die Pressefreiheit bereits in der Weimarer Republik eingeschränkt wurde und wie die wirtschaftliche Abhängigkeit der Presse vom Staat eine wichtige Rolle spielte.
Nationalsozialistische Presselenkung
Dieses Kapitel behandelt die umfassenden Maßnahmen der Nationalsozialisten zur Kontrolle und Manipulation der Presse. Es beleuchtet die rechtlich-institutionellen, ökonomischen und inhaltlichen Kontrollmechanismen, die die Pressefreiheit effektiv unterdrückten.
Widerstand unmöglich?
Dieses Kapitel untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des Widerstands in der NS-Presse. Es beleuchtet die Rolle der „Reichspressekonferenz“ als Lenkungsorgan und zeigt, wie Sanktionsdrohungen die redaktionelle Realität beeinflussten.
Der Widerstand zwischen den Zeilen
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Widerstand, der sich in Form von subtilen Botschaften und indirektem Protest innerhalb der NS-Presse manifestierte. Es stellt das Beispiel von Rudolf Pechel vor, einem Journalisten, der sich gegen das System auflehnte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie Pressefreiheit, Presselenkung, Propaganda, NS-Regime, Widerstand, „Reichspressekonferenz“, „Tradition der Einflussnahme“ und Journalismus im Dritten Reich. Sie analysiert die Rolle der Presse in der NS-Diktatur und untersucht die Auswirkungen der nationalsozialistischen Propaganda auf die Medienlandschaft.
Häufig gestellte Fragen
War die Presse im Dritten Reich Täter oder Opfer?
Die Arbeit zeigt, dass eine undifferenzierte Antwort kaum möglich ist; die Presse war sowohl Instrument der Propaganda (Täter) als auch Objekt totalitärer Kontrolle (Opfer).
Was war die Reichspressekonferenz?
Sie war das zentrale Lenkungsorgan des NS-Regimes, über das Journalisten tägliche Anweisungen zur inhaltlichen Gestaltung ihrer Zeitungen erhielten.
Gab es Widerstand in der deutschen Presse?
Ja, es gab „Widerstand zwischen den Zeilen“ und subtilen Protest, wie die Arbeit am Beispiel des Journalisten Rudolf Pechel erläutert.
Wie kontrollierten die Nationalsozialisten die Zeitungen?
Die Kontrolle erfolgte auf rechtlich-institutioneller, ökonomischer und inhaltlicher Ebene, was die Pressefreiheit faktisch abschaffte.
War die Presse schon vor 1933 eingeschränkt?
Die Arbeit analysiert die „Tradition der Einflussnahme“, die bereits in der Weimarer Republik begann und den Nationalsozialisten die Übernahme erleichterte.
- Citar trabajo
- Jan Horak (Autor), 2008, Täter oder Opfer? - Die Rolle der Presse im Dritten Reich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164929