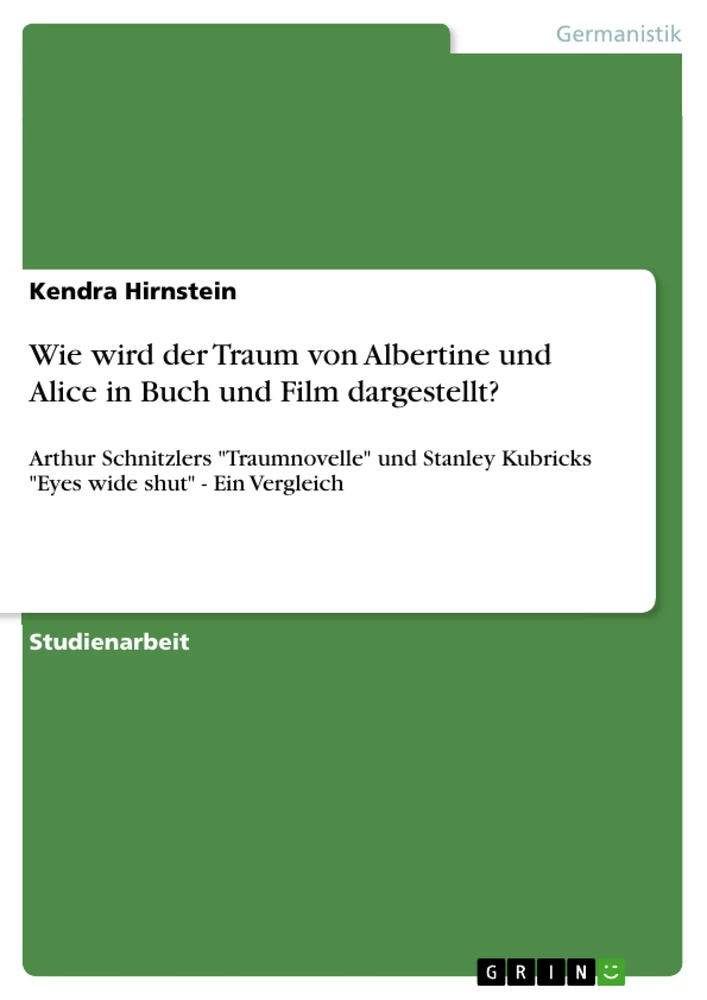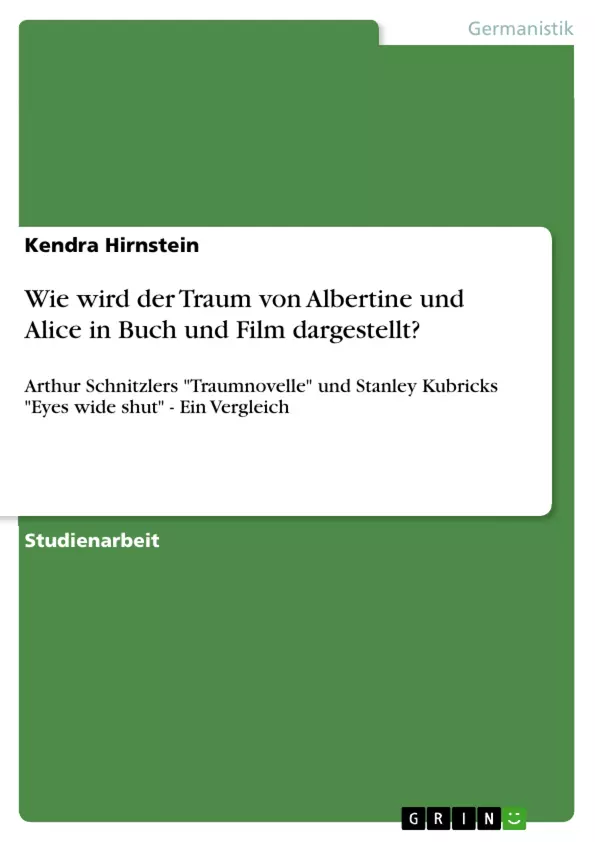Arthur Schnitzlers Traumnovelle, die 1926 veröffentlicht wurde, kreist um die Frage, ob sich der Wunsch nach sexueller Erfüllung mit den Konventionen der bürgerlichen Ehe decken kann. Die Eheleute Fridolin und Albertine geraten nach dem wechselseitigen Geständnis
außerehelicher erotischer Wünsche in eine Krise, finden jedoch zum Schluss wieder zueinander. Der Autor spielt in der Erzählung auf verschiedenen Ebenen mit dem Verschwimmen von Traum, Wachtraum und Realität. Stanley Kubrick versetzte die Traumnovelle vom Wien der 20er ins New York der 90er Jahre. Seine filmische Umsetzung bleibt trotz dieser entscheidenden Änderung nah an der literarischen Vorlage, angefangen von Inhalt und Struktur über die Darstellung der Figuren
bis hin zu wichtigen Dialogen. Trotz dieser Nähe ist der Film keine Illustration des Buches, sondern nach Kreutzer eine – von der Kritik ebenso gelobte wie kritisierte – interpretierende Transformation.
Diese Arbeit fokussiert beim Vergleich von literarischer Vorlage und Film auf die Frage, wie der Traum Albertines im jeweiligen Medium dargestellt wird, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt werden können und warum an bestimmten Stellen literarische
Vorlage und Film übereinstimmen oder voneinander abweichen. Die charakteristischen Darstellungsformen des jeweiligen Mediums werden in diesem Rahmen ebenfalls berücksichtigt. Um die Fragestellung in einen größeren Zusammenhang einbetten zu können, werden die Figuren Albertine und Alice vor der Untersuchung des Traums in ihrer
Gesamtheit miteinander verglichen, unter anderem in Bezug auf die verschiedenen Epochen und Schauplätze. Zum Schluss werden wichtige Aussagen zur Deutung des Traums diskutiert, die auf den Theorien Freuds zur Traumdeutung basieren. An dieser Stelle schließt sich die Frage nach der, möglicherweise verschiedenen, Bedeutung des Traums in Buch und Film an.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ARTHUR SCHNITZLERS TRAUMNOVELLE.
- Kontextualisierung der Novelle.......
- STANLEY KUBRICKS EYES WIDE SHUT..
- Kontextualisierung des Films.......
- BUCH UND FILM IM VERGLEICH......
- Allgemeiner Vergleich der Figuren Albertine und Alice.
- Darstellung des Traums in Buch und Film.
- Deutung des Traumes.
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, den Traum Albertines in Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ und Stanley Kubricks Verfilmung „Eyes Wide Shut“ zu vergleichen. Im Fokus steht dabei die Frage, wie der Traum in den jeweiligen Medien dargestellt wird und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich zwischen Buch und Film feststellen lassen. Zudem wird untersucht, warum an bestimmten Stellen literarische Vorlage und Film übereinstimmen oder voneinander abweichen. Die charakteristischen Darstellungsformen der beiden Medien werden in diesem Zusammenhang ebenfalls berücksichtigt.
- Vergleich der Traumdarstellungen in Buch und Film
- Analyse der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen literarischer Vorlage und Film
- Bedeutung des Traums in Buch und Film
- Bedeutung des Mediums für die Darstellung des Traums
- Kontextualisierung der Traumnovelle und des Films
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Fragestellung vor. Anschließend wird die „Traumnovelle“ von Arthur Schnitzler in ihrer Entstehung und Thematik beleuchtet. In Kapitel 3 wird der Film „Eyes Wide Shut“ von Stanley Kubrick vorgestellt und in Bezug auf die literarische Vorlage analysiert. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Vergleich von Buch und Film, wobei die Figuren Albertine und Alice sowie die Darstellung des Traums im Zentrum stehen. Die Deutung des Traums und dessen mögliche Bedeutung in Buch und Film runden die Arbeit ab.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen „Traumnovelle“, „Eyes Wide Shut“, „Arthur Schnitzler“, „Stanley Kubrick“, „Traumdeutung“, „Freud“, „Literaturverfilmung“, „Albertine“, „Alice“, „Ehebruch“, „sexuelle Sehnsüchte“, „Realität“, „Wachtraum“, „Medium“, „Darstellungsformen“ und „Kontextualisierung“.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich die Schauplätze in Buch und Film?
Schnitzlers Novelle spielt im Wien der 1920er Jahre, während Kubricks Film die Handlung ins New York der 1990er Jahre versetzt.
Was ist das zentrale Thema der Traumnovelle?
Es geht um die Frage, ob sexuelle Erfüllung und außereheliche Wünsche mit den Konventionen einer bürgerlichen Ehe vereinbar sind.
Welche Rolle spielt die Psychoanalyse (Freud)?
Der Traum wird als Ausdruck unterdrückter Wünsche interpretiert, wobei die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen.
Wie nah bleibt Kubricks Film an der Vorlage?
Trotz des modernen Settings bleibt der Film in Struktur, Dialogen und Figurendarstellung sehr nah an Schnitzlers literarischer Vorlage.
Wer sind die Protagonisten?
In der Novelle sind es Fridolin und Albertine, im Film (Eyes Wide Shut) heißen sie Bill und Alice.
- Quote paper
- Kendra Hirnstein (Author), 2008, Wie wird der Traum von Albertine und Alice in Buch und Film dargestellt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165222