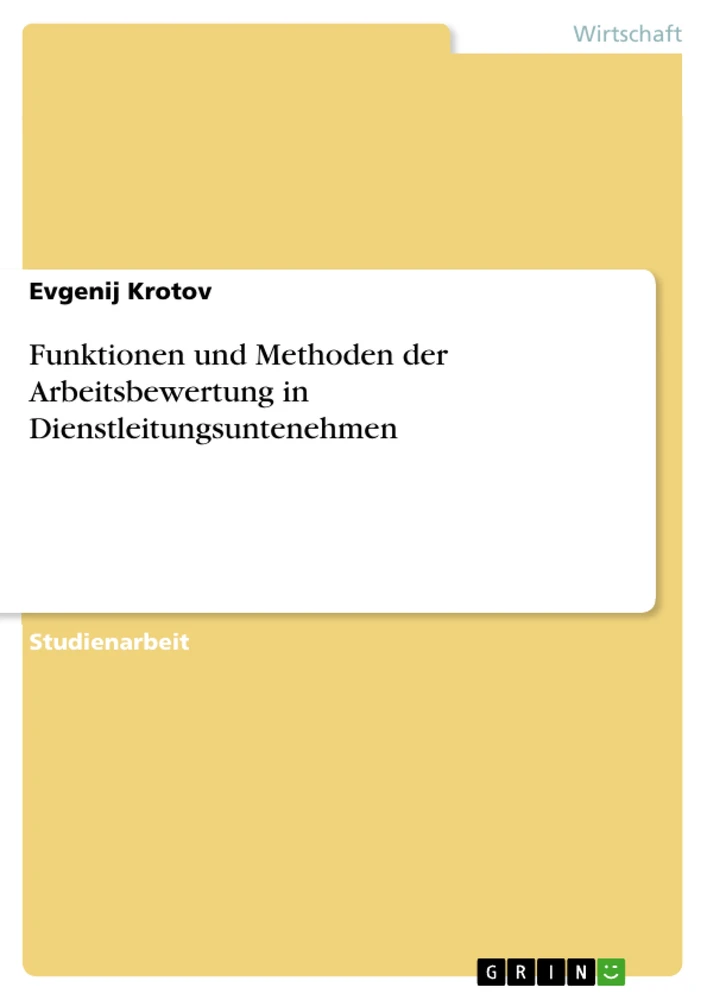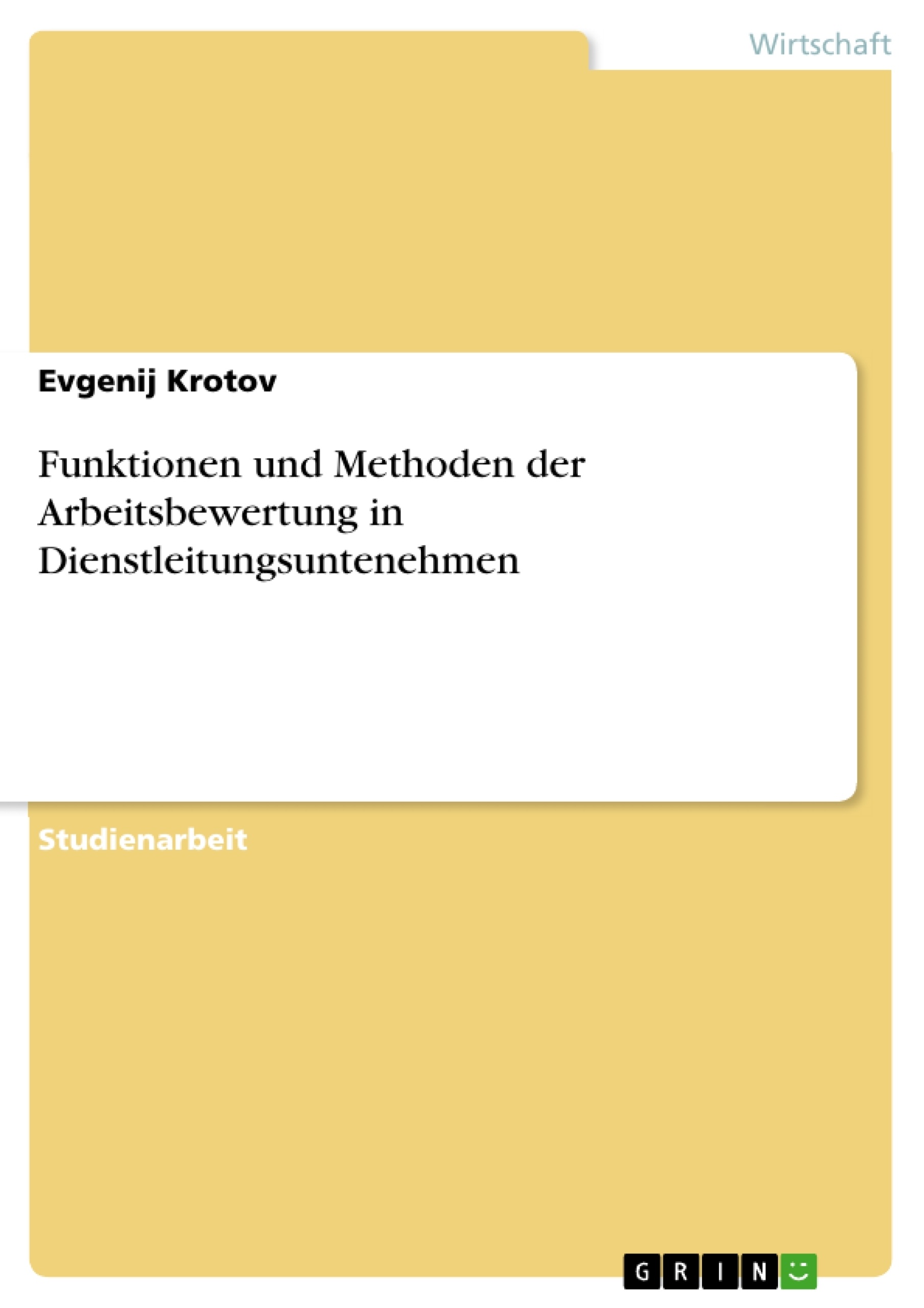In Zeiten der immer lauter werdenden Rufe nach Lohngerech¬tigkeit ist die Arbeitsbewertung ein wichtiges Instrument, um die Höhe eines anforderungsorientierten Entgeltes zu bestimmen.
Durch sie besteht die Möglichkeit ein Entgelt für einen Ar¬beitsplatz festzulegen, welches nicht auf der Person des Arbeitnehmers beruht, sondern rein auf den Arbeitsplätzen des Unternehmens mit ihren individuellen Schwierigkeitsgra¬den. Die Unternehmen haben somit ein Instrument zur Hand, die Arbeitsschwierigkeit in die Entlohnung einfließen zu lassen und das Entgelt besser zu differenzieren und somit zu mehr Lohngerechtigkeit beizutragen.
In dieser Seminararbeit wird auf den Zweck der Arbeitsbe¬wertung eingegangen, die verschiedenen Verfahren der Ar¬beitsbewertung mit ihren Vor- und Nachteilen werden aufge¬zeigt und es werden Beispiele zu den einzelnen Verfahren gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- A Einführung
- A 1 Einleitung
- A 2 Relevanz des Themas
- A 3 Aufbau der Arbeit
- B Definitionen
- B 1 Arbeitsbewertung
- B 2 Lohngerechtigkeit
- B 3 Dienstleistungen
- C Zweck der Arbeitsbewertung
- C 1 Geschichtliches
- C 2 Zweck der Arbeitsbewertung
- D Methoden der Arbeitsbewertung
- D 1 Das Prinzip der Reihung und Stufung
- D 1.1 Summarische Verfahren
- D 1.1.a Das Rangfolgeverfahren
- D 1.1.b Das Lohngruppenverfahren
- D 1.2 Analytische Verfahren
- D 1.2.a Feststellung und Gewichtung der Anforderungsarten
- D 1.2.b Das Rangreihenverfahren
- D 1.2.b)a Rangreihenverfahren mit getrennter Gewichtung
- D 1.2.b)b Rangreihenverfahren mit gebundener Gewichtung
- D 1.2.c Das Stufenverfahren
- E Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Funktionsweise und die verschiedenen Methoden der Arbeitsbewertung im Kontext von Dienstleistungsunternehmen. Ziel ist es, die Bedeutung der Arbeitsbewertung als Instrument zur Festlegung eines anforderungsorientierten Entgelts zu beleuchten und den Beitrag zur Lohngerechtigkeit aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung der Arbeitsbewertung
- Das Konzept der Lohngerechtigkeit und seine Anwendung
- Die Besonderheiten der Arbeitsbewertung in Dienstleistungsunternehmen
- Die verschiedenen Methoden der Arbeitsbewertung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile
- Die praktische Anwendung der Arbeitsbewertung in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der Arbeitsbewertung im Kontext der Forderung nach Lohngerechtigkeit. Sie skizziert den Aufbau der Seminararbeit.
- Definitionen: Dieses Kapitel erläutert die zentralen Begriffe Arbeitsbewertung, Lohngerechtigkeit und Dienstleistung. Es wird auf die Bedeutung der anforderungsorientierten Entgeltfindung eingegangen.
- Zweck der Arbeitsbewertung: Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung der Arbeitsbewertung und erläutert ihren Zweck als Instrument zur objektiven Bewertung von Arbeitsplätzen.
- Methoden der Arbeitsbewertung: Dieses Kapitel stellt verschiedene Methoden zur Arbeitsbewertung vor, darunter summarische und analytische Verfahren. Es werden sowohl Rangfolge- und Lohngruppenverfahren als auch Rangreihen- und Stufenverfahren detailliert erläutert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Arbeitsbewertung, Lohngerechtigkeit, Dienstleistungsunternehmen, Anforderungsorientierung, Entgeltfindung, Methoden der Arbeitsbewertung, Rangfolgeverfahren, Lohngruppenverfahren, Rangreihenverfahren, Stufenverfahren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Arbeitsbewertung?
Das Ziel ist die Ermittlung eines anforderungsorientierten Entgelts, das auf den Schwierigkeitsgraden des Arbeitsplatzes basiert und nicht auf der individuellen Person.
Was unterscheidet summarische von analytischen Verfahren?
Summarische Verfahren bewerten die Arbeit als Ganzes (z.B. Rangfolgeverfahren), während analytische Verfahren einzelne Anforderungsarten getrennt gewichten.
Wie trägt Arbeitsbewertung zur Lohngerechtigkeit bei?
Sie ermöglicht eine objektive Differenzierung der Entlohnung nach tatsächlichen Anforderungen, was Willkür verhindert und für mehr Transparenz sorgt.
Welche Besonderheiten gibt es in Dienstleistungsunternehmen?
In Dienstleistungsbetrieben müssen oft immaterielle Anforderungen und spezifische Interaktionen mit Kunden in die Bewertung der Arbeitsschwierigkeit einfließen.
Was ist das Lohngruppenverfahren?
Es ist ein summarisches Verfahren, bei dem Arbeitsplätze in vorab definierte Entgeltgruppen oder Stufen eingeordnet werden.
- Quote paper
- Evgenij Krotov (Author), 2010, Funktionen und Methoden der Arbeitsbewertung in Dienstleitungsuntenehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165265